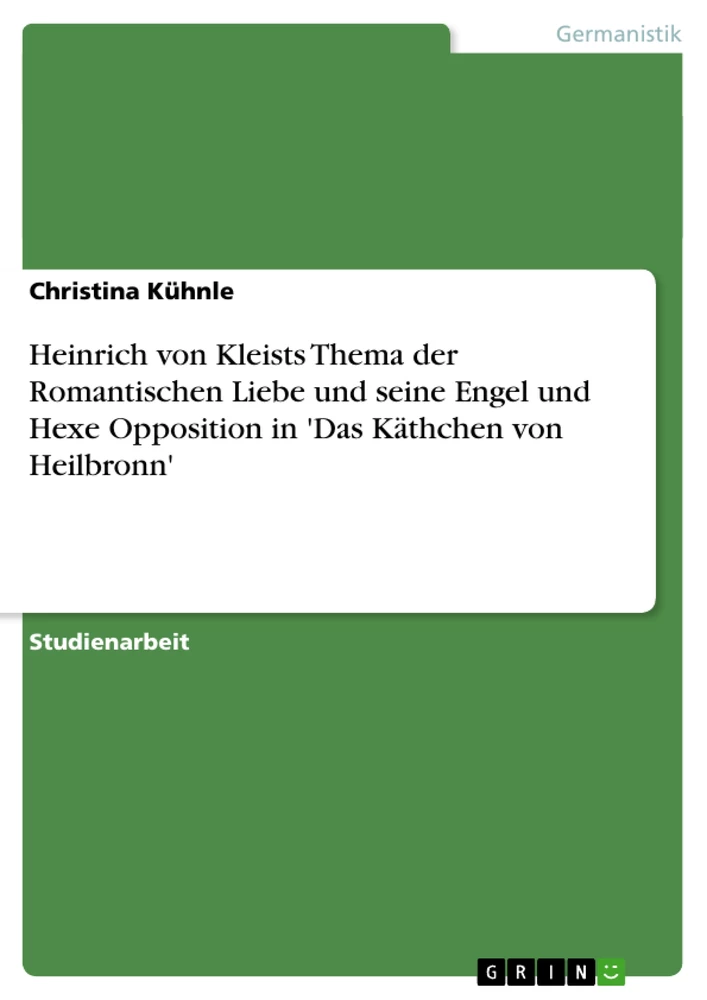Heinrich von Kleist, feierte mit seinem Das Käthchen von Heilbronn seinen ersten großen Dramenerfolg. So war es lange Zeit das einzige von Kleists Dramen, das vom zeitgenössischen Publikum angenommen wurde. , zeichneten sich die Kleistschen Werke doch stets durch Provokationen aus. Auch hier will Kleist genau genommen provozieren und orientiert sich weder stringent an klassizistischen noch an der romantischen Poetik. So stellt er mit seinem Werk jegliche romantischen Konzepte auf den Prüfstand, beispielsweise das der Geschlechterbeziehungen oder das Frauenbild.
Eine weitere Provokation besteht darin, dass er in Das Käthchen von Heilbronn oder die Feuerprobe, durch den Untertitel Ein großes historisches Ritterschauspiel als eine Art Heldenepos ankündigt, jegliche Form der Ritterlichkeit seitens der männlichen Figuren jedoch vermissen lässt.
Vorwiegend arbeitet er hier mit Mitteln, die uns aus dem Märchen bekannt sind. Ein Mann und eine Frau haben in der Silvesternacht einen Traum, in dem ihnen der zukünftige Ehepartner durch einen Cherub vorgeführt wird. Im Anschluss daran beginnt die verzweifelte Suche nach genau jenem. Als sie sich beinahe gefunden haben, tritt eine Nebenbuhlerin, vergleichbar auch mit den bösen Stiefschwestern in Aschenputtel auf, und das Traumpaar scheint getrennt. Zu guter letzt heiratet der Prinz dann doch die Richtige und „wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute“.
Ganz so indifferent darf die „Liebes“geschichte in Das Käthchen von Heilbronn jedoch nicht betrachtet werden. Heinrich von Kleist spielt in seinem zwischen Ende August 1807 und Ende April 1809, während seiner Dresdner Zeit, entstandenen Werk mit dem Thema der Liebe und parodiert die romantischen Elemente wohl eher als dass er sie idealisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Frauenfiguren in Das Käthchen von Heilbronn
- Die Figur des Käthchens von Heilbronn
- Die Figur der Kunigunde von Thurneck
- Der Engel und die Hexe
- Die Hexe Kunigunde
- Der Engel Käthchen
- Die ideale romantische Liebe
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert Heinrich von Kleists Das Käthchen von Heilbronn und untersucht insbesondere die Darstellung der romantischen Liebe im Kontext der Gegenüberstellung von Käthchen als Engel und Kunigunde als Hexe. Die Arbeit beleuchtet die Charaktere und ihre Rollen im Drama, um Kleists Auseinandersetzung mit romantischen Konzepten der Geschlechterbeziehungen und des Frauenbildes zu verstehen.
- Die Darstellung der Frauenfiguren Käthchen und Kunigunde als gegensätzliche Pole
- Kleists Kritik und Parodie romantischer Liebesideale
- Die Rolle der göttlichen Vorbestimmung in der Liebesgeschichte
- Die Konzeption der "Ménage à trois" und die Dynamik zwischen den drei Hauptfiguren
- Das Frauenbild im Kontext der damaligen Zeit und seine Entwicklung in der Rezeptionsgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt Heinrich von Kleists Das Käthchen von Heilbronn als provokatives Drama vor, das sich weder an klassizistischen noch an romantischen Poetiken orientiert. Kleist stellt mit seinem Werk romantische Konzepte auf den Prüfstand, insbesondere die Geschlechterbeziehungen und das Frauenbild. Das Stück wird als eine Art Heldenepos angekündigt, ironisch kontrastiert mit dem Fehlen von Ritterlichkeit bei den männlichen Figuren. Die Einleitung führt in das zentrale Thema der Liebe ein, die Kleist eher parodiert als idealisiert, und kündigt die Analyse der drei Hauptfiguren und ihrer Rollen an, wobei der Fokus auf den konträren Frauenfiguren liegt.
Die Frauenfiguren in Das Käthchen von Heilbronn: Dieses Kapitel analysiert die beiden weiblichen Hauptfiguren, Käthchen und Kunigunde. Es beschreibt Käthchen als Prototyp des damaligen Frauenbildes – schön, integer, natürlich und anmutig – wobei die spätere Rezeptionsgeschichte eine kritischere Sicht auf ihre Naivität und Hörigkeit hervorbrachte. Die Einführung Käthchens erfolgt durch Fremdbeschreibungen der männlichen Figuren, die sie als engelhaftes Wesen darstellen. Der Text beleuchtet die scheinbare Distanz des Vaters zu Käthchen, die auf die im Verlauf des Stückes offenbar werdende Scheinvaterschaft hindeuten könnte. Käthchens Gehorsam gegenüber ihrem Vater bezüglich einer Heirat mit Gottfried wird ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Heinrich von Kleist, Das Käthchen von Heilbronn, Romantische Liebe, Engel und Hexe, Frauenfiguren, Kunigunde, Käthchen, Geschlechterbeziehungen, Frauenbild, Parodie, göttliche Vorbestimmung, Ménage à trois, Rezeptionsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zu Heinrich von Kleists "Das Käthchen von Heilbronn"
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert Heinrich von Kleists Drama "Das Käthchen von Heilbronn" mit besonderem Fokus auf die Darstellung der romantischen Liebe und die Gegenüberstellung der weiblichen Hauptfiguren Käthchen und Kunigunde. Die Arbeit untersucht die Charaktere, ihre Rollen im Drama und Kleists Auseinandersetzung mit romantischen Konzepten der Geschlechterbeziehungen und des Frauenbildes.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Die Darstellung von Käthchen und Kunigunde als gegensätzliche Pole (Engel vs. Hexe); Kleists Kritik und Parodie romantischer Liebesideale; die Rolle der göttlichen Vorbestimmung in der Liebesgeschichte; die Dynamik der "Ménage à trois"; und das Frauenbild im Kontext der damaligen Zeit und seine Entwicklung in der Rezeptionsgeschichte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die Frauenfiguren Käthchen und Kunigunde, ein Kapitel über die Symbolik von Engel und Hexe, ein Kapitel über die ideale romantische Liebe und einen Schluss. Die Einleitung stellt das Stück als provokatives Drama vor, das romantische Konzepte auf den Prüfstand stellt. Das Kapitel über die Frauenfiguren analysiert Käthchen als Prototyp des damaligen Frauenbildes und Kunigunde als deren Gegenstück. Das Kapitel über Engel und Hexe vertieft die symbolische Bedeutung der Figuren. Das Kapitel über die romantische Liebe untersucht Kleists kritische Auseinandersetzung damit. Der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie werden die Frauenfiguren Käthchen und Kunigunde dargestellt?
Käthchen wird als naiv, integer und anmutig beschrieben, während Kunigunde eher als das Gegenstück, als Hexe, dargestellt wird. Die Arbeit analysiert, wie diese Gegenüberstellung Kleists Kritik an romantischen Liebesidealen verdeutlicht. Die Rezeptionsgeschichte wird herangezogen, um die Entwicklung der Sicht auf Käthchens Naivität zu beleuchten.
Welche Rolle spielt die romantische Liebe in dem Drama?
Die Seminararbeit argumentiert, dass Kleist die romantische Liebe eher parodiert als idealisiert. Die Analyse konzentriert sich darauf, wie Kleist durch die Darstellung der Beziehungen zwischen Käthchen, Kunigunde und dem Ritter die Konventionen der romantischen Liebe hinterfragt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Heinrich von Kleist, Das Käthchen von Heilbronn, Romantische Liebe, Engel und Hexe, Frauenfiguren, Kunigunde, Käthchen, Geschlechterbeziehungen, Frauenbild, Parodie, göttliche Vorbestimmung, Ménage à trois, Rezeptionsgeschichte.
- Arbeit zitieren
- Christina Kühnle (Autor:in), 2004, Heinrich von Kleists Thema der Romantischen Liebe und seine Engel und Hexe Opposition in 'Das Käthchen von Heilbronn', München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39391