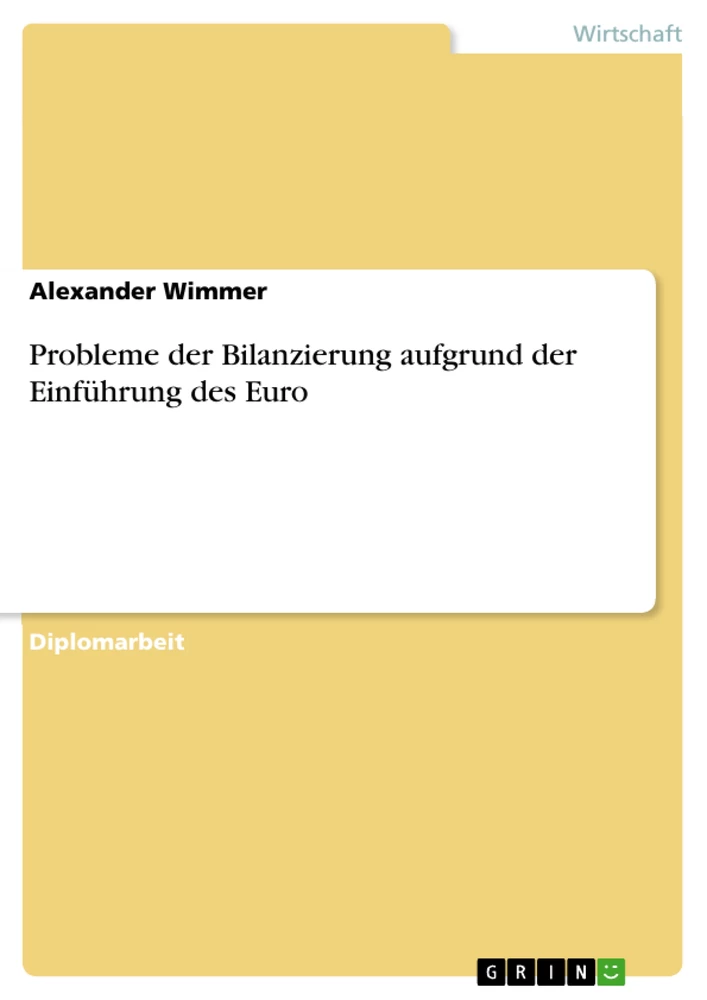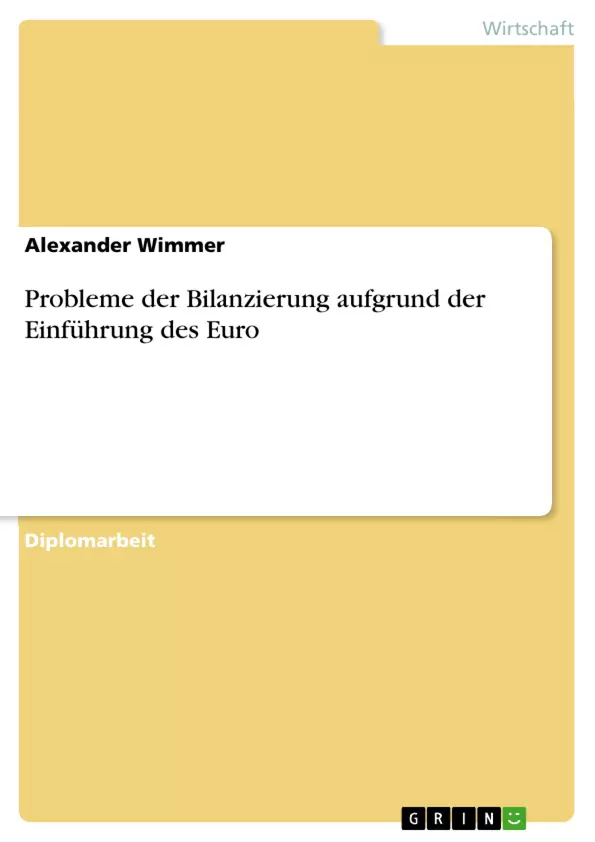Problemstellung
Die Einführung des Euro als Europäische Währungseinheit ist zur Zeit in den Medien eines der meistdiskutierten wirtschaftspolitischen Themen in Europa. Trotz der Annahme, daß der Euro rechtzeitig zum 1. Januar 1999 eingeführt wird, wovon in dieser Arbeit ausgegangen wird, ist den betroffenen Privatpersonen und Unternehmen im Einzelnen
oftmals nicht klar, wie diese Einführung vor sich gehen wird, welche Vorkehrungen getroffen werden müssen und welche Auswirkungen die neue Europäische Währungseinheit haben wird.
Die Tatsache, daß sich die Regierungen der Staaten der Europäischen Union bereits vor Jahren auf die Einführung des Euro geeinigt haben und die eigentliche Einführung der Währung nur noch eine Frage der Zeit, beziehungsweise der Erfüllung der vieldiskutierten Konvergenzkriterien ist, wird häufig übersehen. Der bisherige Ablauf und die getroffenen Entscheidungen werden in dieser Arbeit aufgezeigt.
Die Europäische Währungsunion wird in verschiedenen Bereichen Kosten verursachen, wobei im Rahmen dieser Arbeit nur auf Kosten für Unternehmen in Deutschland eingegangen wird. Diese Kosten entstehen beispielsweise für Schulungen der Mitarbeiter oder für Umstellungen der Software etc. Durch ihre unterschiedliche Art fallen die Kosten
teilweise vor oder nach der Einführung des Euro an.
An diesen Punkt knüpfen die Untersuchungen dieser Arbeit an, denn Kosten, die Unternehmen tatsächlich entstehen, müssen sowohl in deren Handels- als auch Steuerbilanz erfaßt werden. Es werden Möglichkeiten erarbeitet, wie diese Kosten den jeweiligen
Perioden zugerechnet werden können bzw. könnten.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1. Problemstellung
- 2. Rechtliche Rahmenbedingungen für die Einführung des Euro
- 2.1. Vertrag vom Maastricht
- 2.2. Vorbereitungsverordnung der EU nach Art. 235 EG-Vertrag
- 2.3. Entwurf einer Einführungsverordnung der EU nach Art. 109 I EGV
- 3. Die Auswirkungen der Stichtage auf die Bilanzierung
- 3.1. Drei-Stufen-Regelung
- 3.2. Drei-Phasen-Regelung
- 4. Die Auswirkungen auf den Jahresabschluß
- 4.1. Die Umrechnung der DM auf den Euro
- 4.1.1. Technik der Umstellung
- 4.1.2. Zeitpunkt der Umstellung
- 4.2. Die Umrechnung der anderen Teilnehmerwährungen auf den Euro
- 4.3. Die Umrechnung der Nicht-Teilnehmerwährungen auf den Euro
- 5. Bilanzielle Konsequenzen der Umrechnung
- 5.1. Die Behandlung von Umrechnungsgewinnen und -verlusten
- 5.1.1. Realisation von Erfolgsbeiträgen
- 5.1.1.1. Theoretische Grundlagen
- 5.1.1.2. Anwendbarkeit auf die Euro-Umstellung
- 5.1.2. Zeitpunkt der Realisation
- 5.1.2.1. Realisation zum 31. Dezember 1998
- 5.1.2.2. Realisation zum 1. Januar 1999
- 5.1.2.3. Zusammenfassung
- 5.2. Die Behandlung von Devisenkontrakten
- 5.2.1. Absicherung von Bilanzposten
- 5.2.2. Spekulationskontrakte
- 5.2.3. Antizipatorische Sicherungsgeschäfte
- 6. Die bilanzielle Behandlung von Euro-Umstellungskosten
- 6.1. Erfassung als Aufwand bei der Entstehung
- 6.1.1. Theoretische Grundlagen
- 6.1.2. Anwendbarkeit auf die Euro-Umstellung
- 6.2. Aktivierung als Bilanzierungshilfe
- 6.2.1. Theoretische Grundlagen
- 6.2.2. Anwendbarkeit auf die Euro-Umstellung
- 6.3. Rückstellungsbildung
- 6.3.1. Theoretische Grundlagen
- 6.3.1.1. Rückstellungskriterien
- 6.3.1.2. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
- 6.3.1.3. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften
- 6.3.1.4. Rückstellungen für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtung
- 6.3.1.5. Aufwandsrückstellungen
- 6.3.1.6. Andere Rückstellungen
- 6.3.2. Anwendbarkeit auf die Euro-Umstellung
- 6.3.2.1. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
- 6.3.2.2. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften
- 6.3.2.3. Rückstellungen für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtung
- 6.3.2.4. Aufwandsrückstellungen
- 7. Thesenförmige Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Ehrenwörtliche Erklärung
- Tabellarischer Lebenslauf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den bilanzrechtlichen Problemen, die durch die Einführung des Euro entstehen. Sie analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Euro-Umstellung und untersucht die Auswirkungen auf die Bilanzierung und den Jahresabschluss.
- Die Auswirkungen der Stichtage auf die Bilanzierung
- Die Umrechnung von Währungen auf den Euro
- Die bilanzielle Behandlung von Umrechnungsgewinnen und -verlusten
- Die bilanzielle Behandlung von Devisenkontrakten
- Die bilanzielle Behandlung von Euro-Umstellungskosten
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Euro-Einführung. Hierzu werden der Vertrag von Maastricht, die Vorbereitungsverordnung der EU sowie der Entwurf einer Einführungsverordnung der EU analysiert. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Stichtage auf die Bilanzierung und stellt die Drei-Stufen- und Drei-Phasen-Regelung dar. Kapitel 4 untersucht die Auswirkungen der Euro-Einführung auf den Jahresabschluss. Schwerpunkt ist dabei die Umrechnung der DM auf den Euro, inklusive der technischen Aspekte und des Zeitpunkts der Umstellung. Kapitel 5 widmet sich den bilanzrechtlichen Konsequenzen der Währungsumrechnung, insbesondere der Behandlung von Umrechnungsgewinnen und -verlusten. Kapitel 6 befasst sich mit der bilanzellen Behandlung von Euro-Umstellungskosten. Die verschiedenen Möglichkeiten, diese Kosten zu erfassen, werden diskutiert, darunter die Erfassung als Aufwand, die Aktivierung als Bilanzierungshilfe und die Bildung von Rückstellungen.
Schlüsselwörter
Euro-Umstellung, Bilanzierung, Jahresabschluss, Währungsumrechnung, Umrechnungsgewinne, Umrechnungsverluste, Devisenkontrakte, Euro-Umstellungskosten, Rückstellungen.
Häufig gestellte Fragen
Welche bilanziellen Probleme löst die Euro-Einführung aus?
Herausforderungen liegen in der Umrechnung der DM, der Behandlung von Umrechnungsgewinnen/-verlusten und der Erfassung von Umstellungskosten im Jahresabschluss.
Wann müssen Umrechnungserfolge realisiert werden?
Die Arbeit diskutiert den Zeitpunkt der Realisation, insbesondere ob diese zum 31. Dezember 1998 oder zum 1. Januar 1999 erfolgen sollte.
Wie werden Euro-Umstellungskosten verbucht?
Es gibt Möglichkeiten der Erfassung als sofortiger Aufwand, der Aktivierung als Bilanzierungshilfe oder der Bildung von Rückstellungen.
Was sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten?
Das sind Bilanzposten für Kosten, die durch die Euro-Umstellung sicher anfallen werden, deren genaue Höhe oder Zeitpunkt aber noch ungewiss ist.
Welche rechtlichen Grundlagen regeln die Euro-Bilanzierung?
Wichtige Rahmenbedingungen sind der Vertrag von Maastricht sowie spezifische EU-Vorbereitungsverordnungen.
- Citar trabajo
- Alexander Wimmer (Autor), 1997, Probleme der Bilanzierung aufgrund der Einführung des Euro, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/394