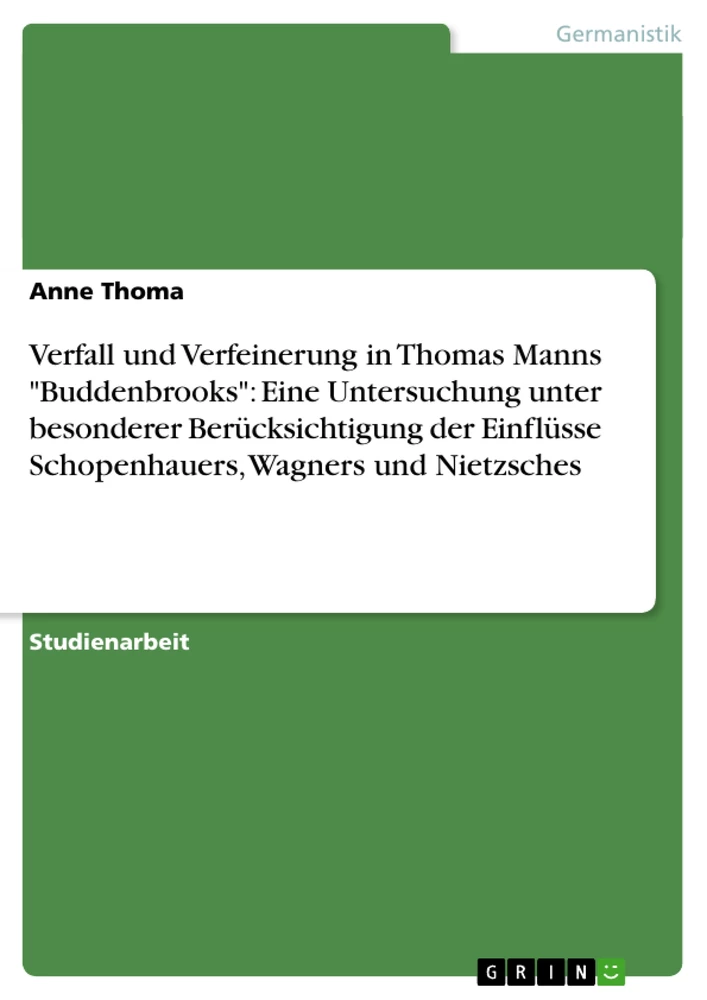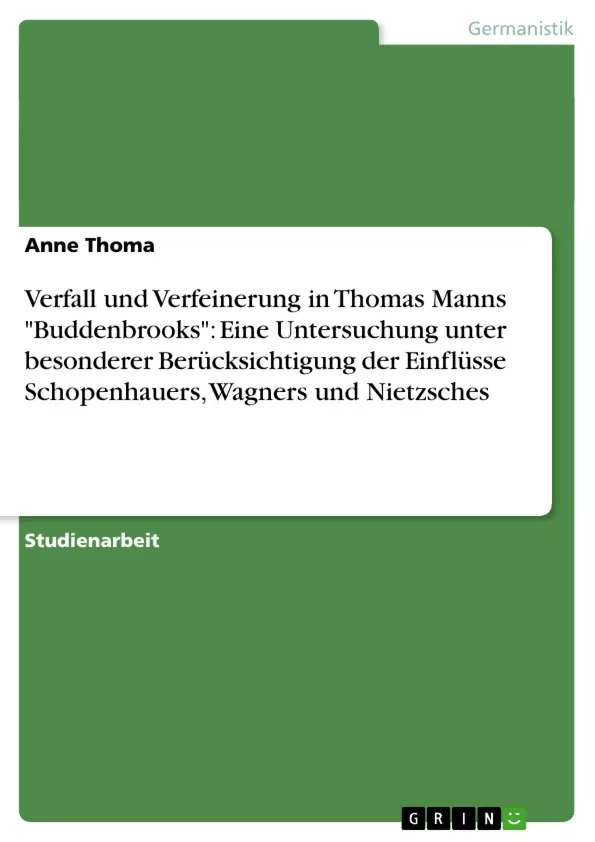[...] Einerseits kann man Nietzsche als Ausgangspunkt nehmen und den Vertretern der letzten drei Generationen je einen der von ihm kritisierten Begriffe zuordnen: Religion, Schauspielerei, Wagner-Musik. Problematisch an diesem Ansatz ist jedoch, dass die Vertreter der letzen, am stärksten im Verfall begriffenen Generationen von Seiten des Erzählers im Vergleich zur ersten und zweiten offensichtlich mehr Sympathie genießen. Andererseits scheint der Roman stark auf dem Weltbild Schopenhauers zu basieren: Der Intellekt, Hanno, emanzipiert sich vom Willen, Johann. Bei Thomas Buddenbrook wird jedoch andererseits klar, dass er trotz kurzzeitiger Begeisterung für den Philosophen im Grunde das Leben in seiner starken Form liebt, was mit Schopenhauers Weltpessimismus nicht zu vereinbaren ist. Es ist Nietzsche, dessen Philosophie hier zum Tragen kommt. Bei Hanno zeigt sich, dass entgegen der schopenhauerschen Auffassung von der Kunst als der – wenn auch temporären – Erlösung vom Leiden der Welt diese Kunst keinen Heiligen hervorbringt, sondern eine jener frühen mannschen Künstlerfiguren „mit schmerzhaft kranken Körpern und Seelen, deren Zerfall ebenso entsetzlich wie ihre Verfeinerung wertvoll ist.“ Thomas Mann bleibt bei Schopenhauer auf halbem Wege stehen. Auf der Ebene der Form geraten wiederum Nietzsche und Wagner in Konflikt, denn die laut Nietzsche auf Wirkung abzielende Musik Wagners sei dadurch jeder Unschuld beraubt, dass ihr Charakter ein konstruierter und kein natürlicher sei. Der leitmotivische – konstruierte – Aufbau der „Buddenbrooks“ steht jedoch in der Tradition Wagners. Aus diesen Gründen wird sich Thomas Manns Aussage, Schopenhauer, Wagner und Nietzsche seien eins, nicht bewahrheiten. Ein letzter Punkt wird sich der Frage widmen, ob es in den „Buddenbrooks“ eine Figur gibt, die eine harmonische Verkörperung von Kunst und Leben darstellt, eine Person, die gemäß der mannschen Definition von Ironie eine Sehnsucht nach dem anderen Bereich empfindet und diese Liebe in Bahnen zu lenken weiß, in denen der Widerspruch erträglich ist. In Ansätzen trifft dies auf den jungen Graf Mölln zu. Für die Buddenbrooks ist diese Option wie für fast alle Figuren aus Thomas Manns Frühwerk nicht vorhanden. Wo die Figuren scheitern, sche int sich der Autor jedoch zu behaupten. Für Thomas Mann entsteht mit den „Buddenbrooks“ etwas, das ihn zur Künstlerexistenz berechtigt: Erfolg. Dies mag ein Ausweg aus der Mannschen Kunst-Leben-Problematik sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verfall und Verfeinerung in Thomas Manns „Buddenbrooks“: Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses Schopenhauers, Wagners und Nietzsches
- Der Begriff der décadence: Paul Bourget und Friedrich Nietzsche
- In den Spuren Nietzsches: Der körperliche Verfall und der Schwund bürgerlicher Lebensformen
- Johann: Tüchtigkeit und Lebensnähe
- Jean: Religiös-sentimentale Verklärung
- Thomas, Christian und Tony: Schauspielerei und Hypochondrie
- Hanno: Musik und Lebensunfähigkeit
- In den Spuren Schopenhauers: Erscheinungsformen der geistigen Sensibilisierung und Verfeinerung
- Der schopenhauersche Entindividuationsprozess von Johann zu Hanno
- Abweichungen von Schopenhauer
- ,Aus drei mach eins': Die Vermischung der Philosophie Nietzsches, Schopenhauers und Wagners im Rückblick
- Der Verfall der Figuren und der Aufstieg des Autors
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Roman „Buddenbrooks“ von Thomas Mann, indem sie den Verfall und die Verfeinerung innerhalb der Familie Buddenbrook unter Berücksichtigung der Einflüsse von Schopenhauer, Wagner und Nietzsche analysiert. Es wird der Frage nachgegangen, inwieweit Thomas Mann die philosophischen Konzepte seiner „geistigen Erbväter“ in seinem Werk umsetzt und wie sich diese auf die Entwicklung der Figuren auswirken.
- Der Begriff der Décadence und seine Darstellung im Roman
- Der körperliche und geistige Verfall der Buddenbrooks über vier Generationen
- Die geistige Verfeinerung und künstlerische Sensibilisierung als Gegenpol zum Verfall
- Der Einfluss von Schopenhauer, Nietzsche und Wagner auf die Gestaltung des Romans
- Das Verhältnis von Kunst und Leben in den „Buddenbrooks“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Entstehung der „Buddenbrooks“ und hebt die Bedeutung der Einflüsse Schopenhauers, Wagners und Nietzsches auf Thomas Manns Werk hervor. Sie skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit: den scheinbaren Widerspruch zwischen dem Verfall der Familie Buddenbrook und der gleichzeitigen geistigen Verfeinerung, die Auseinandersetzung mit den philosophischen Konzepten der drei genannten Denker und die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Leben im Roman. Der Untertitel des Romans, "Verfall einer Familie", wird kritisch hinterfragt, da er die geistige Entwicklung der Figuren nicht ausreichend berücksichtigt.
Verfall und Verfeinerung in Thomas Manns „Buddenbrooks“: Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses Schopenhauers, Wagners und Nietzsches: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der Familie Buddenbrook über vier Generationen. Es untersucht den körperlichen und geistigen Verfall der Familienmitglieder, indem es Leitmotive wie schlechte Zähne und blaue Augenringe als Zeichen des Niedergangs identifiziert. Parallel dazu wird die zunehmende künstlerische Sensibilität und geistige Verfeinerung dargestellt, besonders deutlich an den künstlerischen Erlebnissen der Figuren. Es wird geprüft, wie weit Thomas Mann den Konzepten seiner philosophischen Vorbilder folgt und wie diese Konzepte miteinander verwoben sind. Die Analyse betrachtet die Zuordnung von Nietzsches Kritik an Religion, Schauspielerei und Wagner-Musik auf die einzelnen Generationen der Buddenbrooks und die scheinbare Diskrepanz zwischen der Erzählerperspektive und der Sympathie für die Figuren der späteren Generationen.
Thomas Manns "Buddenbrooks": Häufige Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert Thomas Manns Roman "Buddenbrooks" unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses von Schopenhauer, Wagner und Nietzsche. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des scheinbaren Widerspruchs zwischen dem Verfall der Familie Buddenbrook und der gleichzeitigen geistigen Verfeinerung ihrer Mitglieder.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: den Begriff der Décadence, den körperlichen und geistigen Verfall der Buddenbrooks über vier Generationen, die geistige Verfeinerung und künstlerische Sensibilisierung als Gegenpol zum Verfall, den Einfluss von Schopenhauer, Nietzsche und Wagner auf die Gestaltung des Romans und das Verhältnis von Kunst und Leben in "Buddenbrooks".
Welche Philosophen spielen eine Rolle in der Analyse?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Arthur Schopenhauer, Richard Wagner und Friedrich Nietzsche auf Thomas Manns Roman und deren Auswirkungen auf die Entwicklung der Figuren und die Thematik des Verfalls und der Verfeinerung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel ("Verfall und Verfeinerung in Thomas Manns „Buddenbrooks“"), und einen Schluss. Das Hauptkapitel analysiert die Entwicklung der Familie Buddenbrook über vier Generationen, wobei der körperliche und geistige Verfall ebenso wie die zunehmende künstlerische Sensibilität und geistige Verfeinerung beleuchtet werden. Die Arbeit untersucht die Verknüpfung der philosophischen Konzepte der drei genannten Denker und deren Auswirkungen auf die Figuren.
Welche Figuren werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung der einzelnen Generationen der Familie Buddenbrook, mit einem Fokus auf Johann, Jean, Thomas, Christian, Tony und Hanno Buddenbrook, um den körperlichen und geistigen Verfall, aber auch die künstlerische Entwicklung und geistige Verfeinerung darzustellen.
Wie wird der "Verfall" in "Buddenbrooks" interpretiert?
Der Untertitel des Romans, "Verfall einer Familie", wird kritisch hinterfragt. Die Arbeit betrachtet den Verfall nicht nur als körperlichen und gesellschaftlichen Niedergang, sondern auch im Kontext der geistigen Entwicklung und der künstlerischen Sensibilisierung der Figuren. Leitmotive wie schlechte Zähne und blaue Augenringe werden als Zeichen des Niedergangs interpretiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussbetrachtungen fassen die Ergebnisse der Analyse zusammen und diskutieren die Bedeutung des Verhältnisses von Verfall und Verfeinerung in "Buddenbrooks" im Kontext der philosophischen Einflüsse. Die Arbeit hinterfragt den einseitigen Fokus auf den "Verfall" und hebt die Bedeutung der künstlerischen und geistigen Entwicklung der Figuren hervor.
- Arbeit zitieren
- Anne Thoma (Autor:in), 2005, Verfall und Verfeinerung in Thomas Manns "Buddenbrooks": Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Einflüsse Schopenhauers, Wagners und Nietzsches, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39411