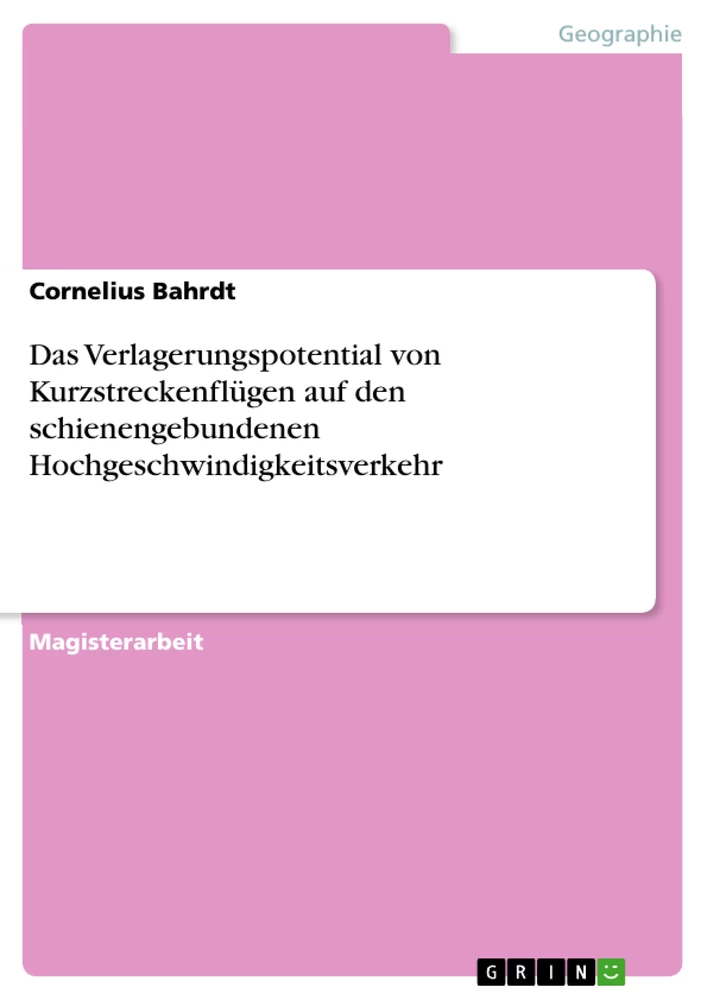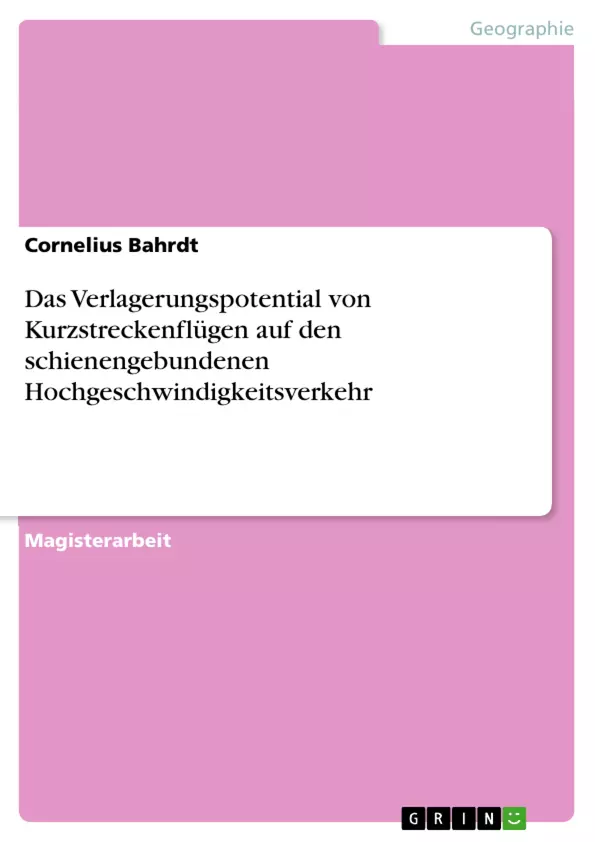In der vorliegenden Arbeit werden Möglichkeiten aufgezeigt, die zur Realisierung einer intermodalen Verkehrsverlagerung der zu erwartenden Verkehrszuwächse in Europa und speziell in Deutschland beitragen können. Hierbei richtet sich der Fokus auf die Kooperation zwischen den Verkehrsträgern Luft und Schiene im Bereich des Personenverkehrssektors. Einführend erfolgt in Kapitel 2 ein Überblick über die heutige Verkehrssituation in Europa und Deutschland sowie eine gesonderte Darstellung der Entwicklung im Schienen- und Luftverkehrssektor. Nach Darlegung der Kerndefinitionen für den Hochgeschwindigkeitsverkehr (HGV) und für Kurzstreckenflüge wird in Kapitel 3 der Arbeit das europäische Flughafensystem und Schienen-Hochgeschwindigkeitsnetz analysiert um nachfolgend bestehende Verlagerungen von Kurzstreckenflügen zu Gunsten der Schiene zu erläutern. Als Grundlage dient hier ein Überblick über das europäische Flughafensystem, bei welchem auf die fünf größten europäischen Flughäfen (Hubs) London Heathrow, Frankfurt a. M., Paris Roissy-Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol und Madrid Barajas eingegangen wird. Die Flughafenstandorte werden bezüglich ihres Verkehrsaufkommens und ihrer Intermodalität untersucht. Im zweiten Teil dieses Kapitels werden ausgewählte HGV-Strecken nach ihrer Einbindung in das europäische Netz und ihrem Verkehrsaufkommen dargestellt. Im Umfang dieser Arbeit wird ausschließlich auf den HGV mit Rad-Schienen-Technik eingegangen. Die Technologie der Magnetschwebebahnen geht über den Rahmen dieser Arbeit hinaus, da sie einerseits in Europa noch keine Anwendung gefunden hat und andererseits in der heutigen Situation nur auf ausgewählten Strecken realisiert werden könnte, somit also kein ganzheitliches Netz erstellen könnte. Eine solche für den HGV innovative Technik würde in naher Zukunft nur zu Insellösungen führen. Bezüglich der bestehenden HGV-Strecken auf Rad-Schiene-Basis und vorhandener Verlagerungen erfolgt eine Darstellung der PBKAL (Paris/Brüssel/Köln /Amsterdam/London) mit den Teilstrecken Paris–London, Paris–Brüssel–Köln und Brüssel–Amsterdam sowie der Strecken Paris–Marseille des TGV Sud-Est/TGV Méditerranée (TGV = train à grand vitesse) und Madrid–Sevilla (AVE = Alta Velocidad Española) mit deren Charakteristika, die eine Verlagerung ermöglicht haben. Es folgt nach den europäischen Praxisbeispielen des dritten Kapitels der Übergang zur Situation in Deutschland. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen: Verkehrsentwicklung
- 2.1 Definitionen
- 2.1.1 Definition: Kurzstreckenflüge
- 2.1.2 Definition: Hochgeschwindigkeitsverkehr (HGV)
- 2.2 Allgemeine Verkehrsentwicklung in Europa und Deutschland
- 2.3 Die Verkehrsentwicklung im Schienenverkehrssektor
- 2.4 Die Verkehrsentwicklung im Luftverkehrssektor
- 3 Das europäische Flughafensystem und HGV-Netz
- 3.1 Das europäische Flughafensystem
- 3.1.1 Grundlagen zum europäischen Flughafensystem
- 3.1.2 Die fünf größten europäischen Flughäfen
- 3.1.2.1 London Heathrow (LHR)
- 3.1.2.2 Frankfurt a. M. (FRA)
- 3.1.2.3 Paris Roissy-Charles de Gaulle (CDG)
- 3.1.2.4 Amsterdam Schiphol (AMS)
- 3.1.2.5 Madrid Barajas (MAD)
- 3.2 Das europäische HGV-Netz
- 3.2.1 Grundlagen zum europäischen HGV-Netz
- 3.2.2 Ausgewählte HGV-Strecken
- 3.2.2.1 PBKAL: Paris / Brüssel / Köln / Amsterdam / London
- 3.2.2.1.1 Segment Paris – London
- 3.2.2.1.2 Segment Paris – Brüssel – Köln
- 3.2.2.1.3 Segment Brüssel – Amsterdam / HSL-Zuid
- 3.2.2.2 TGV Sud-Est / TGV Méditerranée: Paris – Marseille
- 3.2.2.3 AVE : Madrid – Sevilla
- 4 Das deutsche Flughafensystem und HGV-Netz
- 4.1 Das deutsche Flughafensystem
- 4.1.1 Grundlagen zum deutschen Flughafensystem
- 4.1.2 Innerdeutsches Verkehrsaufkommen im Luftverkehr
- 4.1.3 Die fünf bedeutendsten deutschen Flughäfen neben Frankfurt
- 4.1.3.1 München (MUC)
- 4.1.3.2 Düsseldorf (DUS)
- 4.1.3.3 Berlin (THF, TXL, SXF, BBI)
- 4.1.3.4 Hamburg (HAM)
- 4.1.3.5 Köln / Bonn (CGN)
- 4.2 Das deutsche HGV-Netz
- 4.2.1 Grundlagen zum deutschen HGV-Netz
- 4.2.2 Ausgewählte (HGV-)Strecken
- 4.2.2.1 ICE: Hannover – Würzburg
- 4.2.2.2 ICE: Mannheim – Stuttgart
- 4.2.2.3 ICE: Hamburg – Berlin
- 4.2.2.4 ICE: Hannover – Berlin
- 4.2.2.5 ICE: Frankfurt – Köln
- 4.2.2.6 Metropolitan: Köln – Hamburg
- 4.2.3 Zukünftige HGV-Projekte in Deutschland
- 4.2.3.1 Stuttgart – Ulm
- 4.2.3.2 Berlin – Leipzig / Halle – Erfurt – Nürnberg
- 4.2.3.3 Nürnberg – Ingolstadt – München
- 5 Das Verlagerungspotential von Kurzstreckenflügen auf den schienengebundenen HGV
- 5.1 Verlagerungsrelevante Faktoren Luft / Schiene
- 5.1.1 Faktor Zeit
- 5.1.2 Faktor Kosten
- 5.1.3 Faktor Qualität
- 5.1.4 Faktor Relationen
- 5.1.5 Faktor Kooperation und Konkurrenz
- 5.1.5.1 Konkurrenz durch Low-Cost-Carrier
- 5.1.6 Weitere Faktoren
- 5.2 Kooperation Luft / Schiene
- 5.2.1 Vorteile einer Kooperation
- 5.2.2 Nachteile einer Kooperation
- 5.2.3 Bestehende Kooperations- / Seamless-travel-Angebote
- 5.2.3.1 AIRail
- 5.2.3.2 Rail&Fly
- 5.2.3.3 Codesharing
- 5.2.3.4 Kuriergepäck Flughafenservice
- 5.3 Thesen zum Verlagerungspotential in Deutschland
- 5.4 Verkehrsverlagerung im Rahmen der EU-Osterweiterung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht das Verlagerungspotential von Kurzstreckenflügen auf den schienengebundenen Hochgeschwindigkeitsverkehr. Die Arbeit analysiert die aktuelle Verkehrssituation im Luft- und Schienenverkehr, untersucht die Infrastruktur und das Zusammenspiel verschiedener Verkehrsträger, und bewertet die Faktoren, die eine Verlagerung beeinflussen.
- Analyse der Verkehrsentwicklung im Luft- und Schienenverkehr
- Bewertung des europäischen und deutschen Flughafensystems und HGV-Netzes
- Untersuchung verlagerungsrelevanter Faktoren (Zeit, Kosten, Qualität)
- Analyse bestehender Kooperationen zwischen Luft- und Schienenverkehr
- Abschätzung des Verlagerungspotentials im innerdeutschen Verkehr
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten einer intermodalen Verkehrsverlagerung, insbesondere die Kooperation zwischen Luft- und Schienenverkehr im Personenverkehr. Kapitel 2 bietet einen Überblick über die Verkehrssituation, Kapitel 3 analysiert das europäische Flughafensystem und HGV-Netz, Kapitel 4 die deutsche Situation und Kapitel 5 das Verlagerungspotential. Die Arbeit konzentriert sich auf schienengebundenen Hochgeschwindigkeitsverkehr und berücksichtigt nicht die Magnetschwebebahntechnologie.
2 Grundlagen: Verkehrsentwicklung: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Verkehrssituation in Europa und Deutschland, präsentiert Modal Splits und beschreibt die Entwicklung im Schienen- und Luftverkehrssektor. Es werden Definitionen von Kurzstreckenflügen und Hochgeschwindigkeitsverkehr (HGV) festgelegt, um eine gemeinsame Basis für die weiteren Analysen zu schaffen.
3 Das europäische Flughafensystem und HGV-Netz: Das Kapitel analysiert das europäische Flughafensystem, konzentriert sich auf fünf bedeutende europäische Flughäfen (London Heathrow, Frankfurt, Paris Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol und Madrid Barajas), und untersucht deren Verkehrsaufkommen und Intermodalität. Der zweite Teil des Kapitels befasst sich mit dem europäischen HGV-Netz, inklusive ausgewählter Strecken und deren Einbindung in das Gesamtnetz.
4 Das deutsche Flughafensystem und HGV-Netz: Ähnlich dem vorherigen Kapitel analysiert dieses Kapitel das deutsche Flughafensystem, konzentriert sich auf fünf bedeutende deutsche Flughäfen (außer Frankfurt) und deren Anbindung. Es folgt eine Analyse des deutschen HGV-Netzes, inklusive ausgewählter Strecken und zukünftiger Projekte.
5 Das Verlagerungspotential von Kurzstreckenflügen auf den schienengebundenen HGV: Dieses Kapitel, der Hauptteil der Arbeit, untersucht das Verlagerungspotential von Kurzstreckenflügen auf den schienengebundenen HGV. Es werden verlagerungsrelevante Faktoren wie Zeit, Kosten und Qualität analysiert. Bestehende Kooperationen zwischen Luft- und Schienenverkehr (z.B. AIRail) werden beleuchtet, und es wird eine Einschätzung des Verlagerungspotentials auf ausgewählten deutschen Strecken gegeben.
Schlüsselwörter
Kurzstreckenflüge, Hochgeschwindigkeitsverkehr (HGV), intermodale Verkehrsverlagerung, europäisches Flughafensystem, deutsches Flughafensystem, Kooperation Luft/Schiene, Low-Cost-Carrier, ICE, TGV, AIRail, Verlagerungspotential, EU-Osterweiterung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Verlagerungspotential von Kurzstreckenflügen
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht das Verlagerungspotential von Kurzstreckenflügen auf den schienengebundenen Hochgeschwindigkeitsverkehr (HGV). Sie analysiert die aktuelle Verkehrssituation im Luft- und Schienenverkehr, die Infrastruktur, das Zusammenspiel verschiedener Verkehrsträger und die Faktoren, die eine Verlagerung beeinflussen.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Analyse der Verkehrsentwicklung im Luft- und Schienenverkehr, die Bewertung des europäischen und deutschen Flughafensystems und HGV-Netzes, die Untersuchung verlagerungsrelevanter Faktoren (Zeit, Kosten, Qualität), die Analyse bestehender Kooperationen zwischen Luft- und Schienenverkehr und die Abschätzung des Verlagerungspotentials im innerdeutschen Verkehr.
Welche Definitionen werden verwendet?
Die Arbeit definiert klar "Kurzstreckenflüge" und "Hochgeschwindigkeitsverkehr (HGV)", um eine einheitliche Grundlage für die Analysen zu schaffen.
Welche Daten werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Daten zur Verkehrsentwicklung in Europa und Deutschland, das europäische und deutsche Flughafensystem (einschließlich der fünf größten europäischen und fünf wichtigsten deutschen Flughäfen neben Frankfurt), das europäische und deutsche HGV-Netz (mit ausgewählten Strecken und zukünftigen Projekten) und die Kooperationen zwischen Luft- und Schienenverkehr (z.B. AIRail, Rail&Fly, Codesharing).
Welche Faktoren beeinflussen das Verlagerungspotential?
Verlagerungsrelevante Faktoren wie Zeit, Kosten, Qualität, die Anzahl der Relationen und das Zusammenspiel von Kooperation und Konkurrenz (insbesondere durch Low-Cost-Carrier) werden untersucht.
Welche Kooperationen zwischen Luft- und Schienenverkehr werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet bestehende Kooperationen und Seamless-travel-Angebote wie AIRail, Rail&Fly, Codesharing und Kuriergepäck-Flughafenservice.
Auf welche Regionen konzentriert sich die Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf Europa und Deutschland, analysiert das europäische und deutsche Flughafensystem und HGV-Netz und schätzt das Verlagerungspotential im innerdeutschen Verkehr ab. Sie berücksichtigt die EU-Osterweiterung im Kontext der Verkehrsverlagerung.
Welche Technologie wird ausgeschlossen?
Die Arbeit konzentriert sich auf schienengebundenen Hochgeschwindigkeitsverkehr und berücksichtigt nicht die Magnetschwebebahntechnologie.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kurzstreckenflüge, Hochgeschwindigkeitsverkehr (HGV), intermodale Verkehrsverlagerung, europäisches Flughafensystem, deutsches Flughafensystem, Kooperation Luft/Schiene, Low-Cost-Carrier, ICE, TGV, AIRail, Verlagerungspotential, EU-Osterweiterung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Grundlagen: Verkehrsentwicklung, Das europäische Flughafensystem und HGV-Netz, Das deutsche Flughafensystem und HGV-Netz, Das Verlagerungspotential von Kurzstreckenflügen auf den schienengebundenen HGV und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
- Quote paper
- Cornelius Bahrdt (Author), 2005, Das Verlagerungspotential von Kurzstreckenflügen auf den schienengebundenen Hochgeschwindigkeitsverkehr, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39419