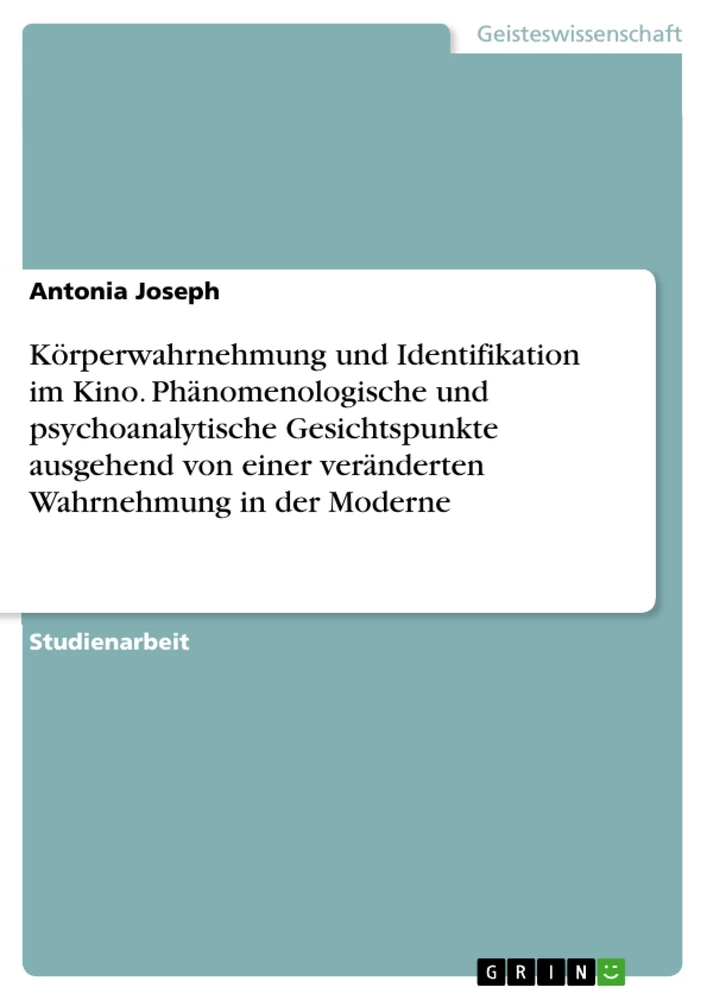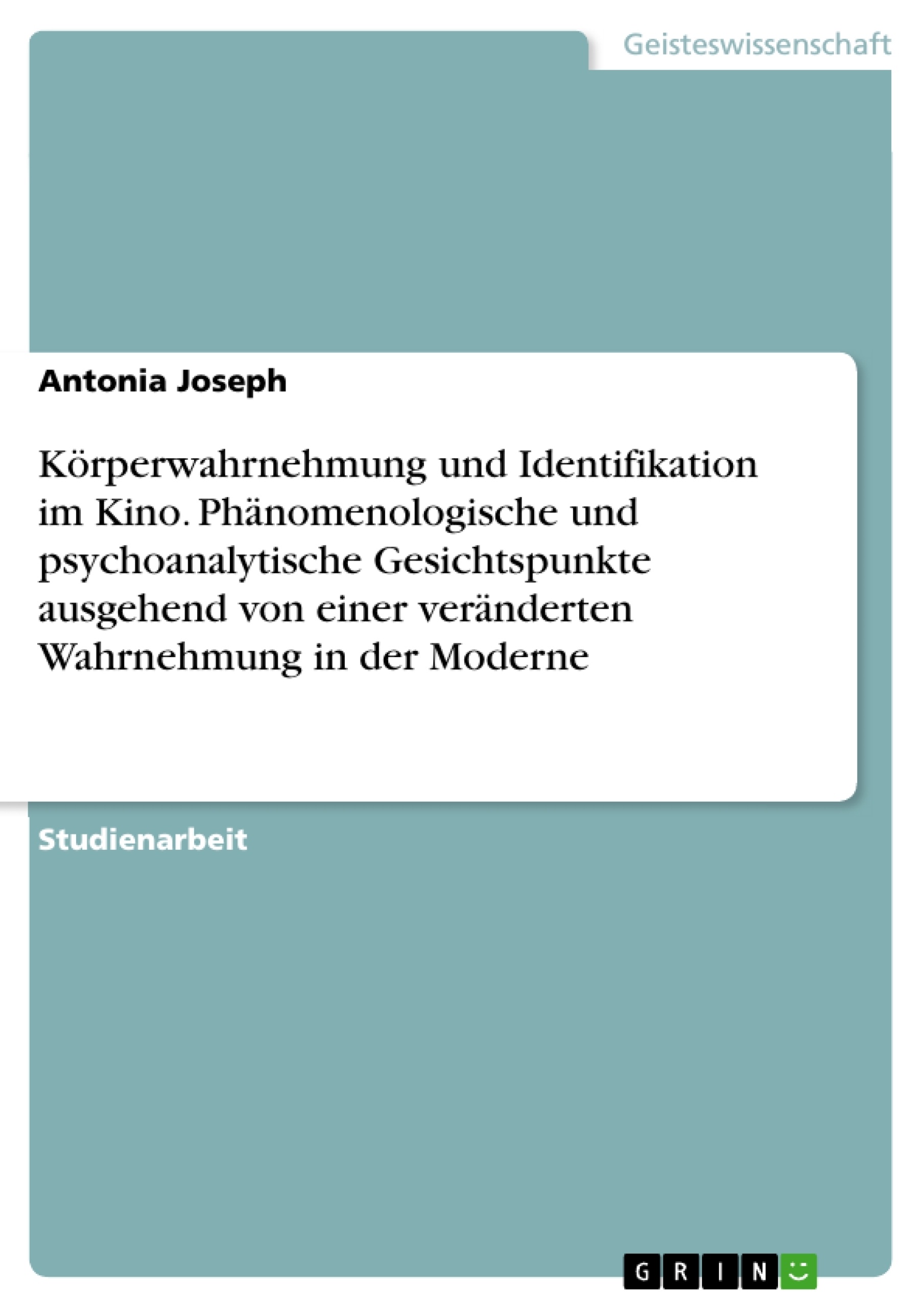Inhalt
Fragestellung
Veränderung der Art der Wahrnehmung in der Moderne
Masse - Individuum
Presse
Bildkräftige Werbung
Bedeutungsfindung
Zeichen - Deregulation
Erfahrung
Fotografie: Dokumentation - Kunst
Stimulierende Bildwelten
Kino
Realitätsillusion
Anordnung
Leinwandspiegel
Identifikation
Resumée
Anmerkungen
Literatur
Fragestellung
Das Kino als Ort der Zerstreuung, Ablenkung vom Alltag und Möglichkeit des Erlebens von irrealen Welten und Ereignissen hat einen wichtigen Platz in der modernen Unterhaltungsindustrie eingenommen. In dieser Arbeit soll untersucht werden, wie sich verschiedene Thesen und Erkenntnisse aus der Phänomenologie und aus der psychoanalytischen Forschung auf die Erfahrung des Kinoerlebnisses für den Zuschauer anlegen lassen. Hierbei soll ein besonderes Augenmerk auf die Verknüpfung verschiedener Theorien zur Identifikation gelegt werden. Um diese herauszuarbeiten und zu veranschaulichen, ist ein Abschnitt über die Veränderung der Wahrnehmung in der Moderne allgemein vorangestellt - auch, weil sich gerade im Bereich der Körperwahrnehmung gesellschaftliche Entwicklungen des 19. Jahrhunderts mit der Enstehung des Kinos als neues Medium in der Öffentlichkeit verstärkten und zumindest teilweise eine wechselseitige Beeinflussung nicht von der Hand gewiesen werden kann. Es folgt eine kurze Übersicht über verschiedene Standpunkte in der Diskussion über das Medium Fotografie, die gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von verschiedenen Filmtheoretikern wiederaufgegriffen und in ihren Ansätzen auf das Kino übertragen wurden. Daraus ergeben sich die Ansätze für die Untersuchung des Mediums Kino.
Veränderung der Art der Wahrnehmung in der Moderne
Masse - Individuum
Das Fortschreiten technischer Neuerungen im 19. Jahrhundert brachte tiefgreifende Veränderungen für die Lebensverhältnisse und Gewohnheiten der Menschen mit sich: Durch die schnellere Übermittlung von Nachrichten und Botschaften mittels Telegraph und den schnelleren Transport von Personen und Handelswaren per Eisenbahn werden im Bewußtsein der Menschen die in Zeiteinheiten meßbaren räumlichen Entfernungen reduziert. Auch in kleineren Bereichen, wie z.B. in der Großstadt, kommt durch neue Übermittlungsverfahren ein verändertes Raum-Zeit-Gefühl und damit verändertes Verhalten auf.
So stellt Georg Simmel in seinem Essay „Großstädte und Geistesleben“ das gemäßigtere Tempo des Lebens in einer Kleinstadt oder einem Dorf der gesteigerten Geschwindigkeit des Großstadtlebens gegenüber. Er folgert daraus, daß das Leben in der städtischen Hektik und unter gesteigertem Zeitdruck eher nach verstandesmäßigen, intellektuell gesteuerten Gesichtspunkten verlaufen muß, während in der Beschaulichkeit der kleineren, (noch) nicht technisierten Dorfgemeinschaft eher die Seele des einzelnen Individuums sichtbar wird, da hier die Zeit gegeben ist, auf menschlicher Ebene individuelle Beziehungen zu knüpfen: „Indem die Großstadt gerade diese psychologischen Bedingungen schafft - mit jedem Gang über die Straße, mit dem Tempo und den Mannigfaltigkeiten des wirtschaftlichen, beruflichen, gesellschaftlichen Lebens - stiftet sie schon (...) einen tiefen Gegensatz gegen die Kleinstadt und das Landleben, mit dem langsameren, gewohnteren, gleichmäßiger fließenden Rhythmus ihres sinnlich-geistigen Lebensbildes. Daraus wird vor allem der intellektualistische Charakter des großstädtsischen Seelenlebens begreiflich, gegenüber dem kleinstädtischen, das vielmehr auf Gemüt und gefühlsmäßige Beziehungen eingestellt ist.“1 Demgegenüber steht der verstärkte Wunsch nach Individualisierung, der Drang, sich in einer technisierten Welt, in der Menschen als „Masse“ auftreten, als Individuum hervorzutun oder zumindest als solches erkannt zu werden. Eng verknüpft damit ist das Aufkommen von Massenvergnügungsorten. Was auf den ersten Blick als Widerspruch erscheint, fügt sich bei genauerer Betrachtung ineinander: Diese organisierten Zerstreuungszentren, zu denen hier sowohl Erlebnisparks, Tanzsäle und neuartige Theaterspektakel als auch (im Benjaminschen Sinne) große Warenhäuser und Einkaufsstraßen gezählt werden, dienen nicht nur der Zerstreuung durch Darbietung von Waren im weitesten Sinne, sondern auch dem Sehen und Gesehenwerden: „Die Vergnügungsindustrie erleichtert ihm (dem Menschen) das, indem sie ihn auf die Höhe der Ware hebt. Er überlässt sich ihren Manipulationen, indem er seine Entfremdung von sich und den anderen genießt.“2 Dieses Moment der Entfremdung bzw. der Warencharakter des Menschen in Betrachtung durch Andere ist ein wichtiger Faktor für die Lust am Schauen im Allgemeinen, die in der modernen Gesellschaft zu einer treibenden Kraft geworden ist.
Im Folgenden werden weitere Entwicklungen beschrieben, die ebenfalls diese Veränderung ebenfalls beeinflussen
Presse
Eine große Rolle für die Veränderung der Wahrnehmung der Menschen in der Stadt spielte die neue Art der Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch Medien, insbesondere durch die Presse: Im 19. Jahrhundert entwickelte sich das, was wir heute unter „freier Presse“ verstehen, d.h. es wurde möglich, Probleme kontrovers in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Der Kampf gegen die zu Beginn des Jahrhunderts noch herrschende starke Zensur, die sich vor allem in den sogenannten „Karlsbader Beschlüssen“ von 1819 manifestierte, gewann in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts an Brisanz und wurde mit dem liberaleren „badischen Pressegesetz“ von 1868 beendet 3: Die zwei wichtigsten Konsequenzen aus diesem Gesetzeserlaß waren die Aufhebung der Vorzensur und die Einbeziehung der Presse in die Gewerbefreiheit, was ab diesem Moment ein Handeln auch nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten möglich und nötig machte.
Daraus folgten zwei für die Thematik der öffentlichen Wahrnehmung relavante Neuerungen: Die Anzahl der thematisch spezialisierten Tageszeitungen, die sich an bestimmte Bevölkerungsgruppen richteten, nahm zugunsten einer Vermehrung von Massenpresse ab. Es erschienen nun zunehmend allgemein verständliche, oft mit Fotografien angereicherte Tageszeitungen, während speziellere Themen eher in Wochenzeitungen und den aufkommenden „Illustrierten“ abgehandelt wurden.
Gleichzeitig nahm die Zahl von kommerziellen Inseraten in den täglich erscheinenden Blättern durch die Gewerbefreiheit extrem zu und erfuhr durch die Adressatsverschiebung dieser Zeitungen eine breitere Rezeption.
Gerade die Werbung und die Art, wie verschiedene Artikel beworben wurden, hatte durch ihre massenhafte Verbreitung große Auswirkungen auf die öffentliche Wahrnehmung:
Bildkräftigte Werbung
Stefan Haas diagnostiziert in seinem Artikel „Die neue Welt der Bilder - Werbung und visuelle Kultur der Moderne“4 den Übergang von einer „primär schriftlichen zu einer tendenziell stärker visuellen Kultur“5: Das Aufkommen der Fotografie und die Verbesserung deren Methoden im ausgehenden 19. Jahrhundert, sowie neue Bildreproduktionsverfahren und Drucktechniken ermöglichten eine stärkere Fixierung auf visuelle Schlagwirkung bei der Produktwerbung. Wo vorher in Inseraten oder auf öffentlichen Plakaten textlastige, auf Überzeugungsarbeit ausgelegte Reklame zu finden gewesen seien (vgl. auch den Wortstamm „reklamieren“), nahmen nun von weitem gut sichtbare, auf Bildassoziationen abzielende und mit dem Wiedererkennungseffekt spielende Anzeigen überhand. Die Schlagwirkung dieser Art von Werbung zeichne sich durch die Verringerung des Textes oft nur auf den Namen des Produktes oder sogar nur auf das Firmensymbol aus. Diese Entwicklung schlüge sich auch im alltäglichen Sprachgebrauch nieder, so daß Markennamen als Äquivalent für das Produkt an sich standen. So führte z.B. bereits 1896 Meyers Konversationslexikon den Namen „Odol“ als Synonym für Mundwasser auf, und der Begriff des „einweckens“ stammt aus einer gelungenen Werbekampagne der Firma „Weck“6.
Bedeutungsfindung
Nach Haas schafft so diese aufkommende Werbekultur eine neue Bedeutungsebene zwischen schauendem Subjekt und beworbenem, d.h. betrachtetem Objekt: Das Bild, das bei dem Betrachter über Wirkung von Farben und Anordnung, Wiedererkennung und auf Assoziationen ausgelegte Bildsymbole entsteht, sei nicht identisch mit dem Objekt selbst, aber auch nicht unbedingt gleichzusetzten mit dessen Abbildung. Es läßt sich sagen, daß so nicht mehr primär die Gegenstände an sich, sondern eher deren neu gewonnene Bedeutung konsumiert wird und daß dies einer der bedeutensten Faktoren für die in der Moderne neu entstehende Lust am Konsumieren ist 7.
Diesen Prozeß der Bedeutungsfindung und -gebung beim schauenden Subjekt über die Betrachtung von Bildern erweitert Haas zu einem permanenten Akt in der modernen Kultur: „Zugleich war damit unbewußt die Überzeugung ausgespochen, daß das menschliche Bewußtsein nicht, wie es die rationalistische und positivistische Philosophie des Bürgertums im 19. Jahrhundert angenommen hatte, rational mithin sprachlich, sondern bildlich funktioniert“8.
Hier wird der Mensch als beobachtendes Subjekt gezeigt, das durch das Beschauen der Welt um sich herum (darin eingeschlossen auch andere Menschen), die in dem Moment den Status des beobachteten Objekts erhält, Wissen produziert. Hans Ulrich Gumbrecht führt in seinem Essay „Alltagswelt und Lebenswelt aus genealogischer Perspektive“ diesen Gedanken weiter aus: Die Voraussetzung für diese Sichtweise sei eine Welt, in der jeder Gegenstand eine Bedeutung hat, oder ihm eine Bedeutung zugeschrieben werden kann. So werde jedes Ding als potentielles Zeichen gesehen 9. Allerdings verliert unter dem Gesichtspunkt des von Haas beschriebenen bildlichen Funktionierens des menschlichen Bewußtseins die Materialität des betrachteten Gegenstandes an Bedeutung, sobald das Zeichen entziffert ist, also sobald sich sein Zweck als Signifikant erfüllt hat. So könnte man hier von einer Verschiebung des Verhältnisses von Subjekt und Objekt sprechen, die sich auf zwei Ebenen auswirkt: Einerseits wird das Objekt an sich unwichtig, sobald es von dem Subjekt erkannt wird, d.h. sobald ihm eine vom Subjekt konstituierte Bedeutung zugewiesen wurde, und andererseits befindet sich das betrachtende Subjekt ständig selbst in der Rolle des betrachteten Objekts, dem von anderen Beobachtern eine jeweilige Bedeutung zugewiesen wird.
Zeichen - Deregulation
Durch diese Verschiebung ist einerseits die Welt der Objekte nicht mehr allgemeingültig verständlich, andererseits verändert sich die exzentrische Stellung des Menschen im Bezug auf die Welt hin zu einer ambivalenten Mixtur aus Schöpfer von Wirklichkeit auf der einen und dem Objekt-Status auf der anderen Seite.
Zusammenfassend läßt sich mit Gumbrecht sagen: „Mit dem Verschwinden der Bipolarität zwischen Subjekt und Objekt aber hörte die Welt der Objekte auf, als eine universell lesbare Welt erfahren zu werden, und da die Welt der Objekte nicht mehr länger als eine Welt von Zeichen „gegeben“ war, bot sich Platz für intellektuelle und künstlerische Experimente, die man metaphorisch „Zeichen-Deregulation“ nennen könnte“10.
Zur Zeit der Jahrhundertwende und danach wurde die Diskussion um die Verschiebung des Subjekt-Objekt-Verhältnisses und die daraus resultierende Konstituierung von Wirklichkeit beim Subjekt u.a. von Henri Bergson geführt. Er führt für diese Wirklichkeit die Idee einer „Zwischen-Sphäre“ ein: „Wirklichkeit ist ebensowenig eine in selbstständige Teile zerlegte Ausdehnung: wie könnte sie auch sonst, da sie so gar keine mögliche Beziehung zu unserem Bewußtsein hätte, in sich eine Reihe von Veränderungen entfalten, deren Anordnung und Beziehungen genau der Anordnung und Beziehungen unserer Vorstellungen entsprächen? Gegeben, wirklich, ist eine Art Zwischending zwischen der geteilten Ausdehnung und dem reinen Unausgedehnten;...“11.
Die Anerkennung einer rein durch das Subjekt konstituierten Wirklichkeit, die sich zwischen dem objektiv Realen, der „Wirklichkeit“ -die so nicht wahrnehmbar ist- und den persönlichen „Anordnungen und Beziehungen“ einer Person entfaltet, schlug sich später in der Entwicklung der Psychoanalyse nieder. Insbesondere der französische Analytiker Jacques Lacan entwickelte nach Freud diese These weiter (s.u. Kino).
Erfahrung
Der französische Philosoph Maurice Merleau-Ponty stellt dem eine andere Auffassung gegenüber: Bei ihm findet die Raumwahrnehmung eines Individuums immer über die Relativierung mitteles eines „Horizontes“ statt. Dieser Horizontbegriff entstammt weniger dem klassischen Sprachgebrauch im Sinne einer entfernten Grenze des allgemein Sichtbaren sondern beschreibt vielmehr das, was den jeweils fokussierten Gegenstand umgibt, ihn also in unserer Sicht eingrenzt.
Der gesehene Gegenstand „enthülle“ sich durch die Perspektive des Schauenden, er wird zu ihr ins Verhältnis gesetzt. Dieser Vorgang beruhe allerdings nicht auf der Ratio oder dem Vorwissen des Schauenden, sondern geschähe unmittelbar. Ebensogut könne diese Perspektive den Gegenstand aber auch verhüllen, indem etwas anderes in der nahen Umgebung Aufmerksamkeit auf sich zieht, und somit der Fokus des Betrachters weiterwandert.
Diese Grundsätze aus der Funktionsweise der räumlichen Wahrnehmung überträgt MerleauPonty auf das Zeitliche: Im Rahmen des wahrnehmbaren Horizontes wende sich die Aufmerksamkeit des Betrachters von dem aktuellen Augenblick ab, um sich dem nächsten zuzuwenden. So trüge die Vergangenheit die kurz vorher dagewesene Gegenwart in sich, wie die nahe Zukunft die gleich eintreffenden Gegenwart in sich.
Diese Horizont-Synthese funktioniert so allerdings nur in „naher“ zeitlicher Umgebung, je weiter sich der Augenblick von dem jetzigen entfernt, desto geringer wird die Verbundenheit mit dem aktuellen Horizont.
Die menschliche Wahrnehmung durch das Sehen, der menschliche Blick, setze so immer eine Seite des Gegenstandes, indem er ihn mit anderen Gegenständen oder mit diesem selbst in der Zeit vor oder nach dem Moment des Wahrnehmens konfrontiert. Diese Konfrontation geschieht nicht immer auf dieselbe Art und Weise von dem gleichbleibenden Standpunkt des schauenden Subjeks aus, sondern werde je nach (in Zeit und Raum) verändertem Blickwinkel neu gesetzt -wodurch auch der jeweilige Gegenstand eine neue Setzung erhält.
Der Schauende allerdings nimmt im Moment des Setzens dieses Gegenstandes diesen für „voll entfaltet in allen seinen Möglichkeiten“, da für ihn der Gegenstand in der Zeit, insbesondere in der Vergangenheit, feststeht, also eine „wahre Vergangenheit“ hat, während sich der betrachtende Blick in der Zeit fortbewegt. Dieser Status des „voll entfaltet Seins“ des Gegenstandes ist in seinem -für das Subjekt gegebenen- Feststehen in der Zeit und damit seiner Unabänderlichkeit laut Merleau-Ponty mit dem der Idee zu vergleichen. Diese Idee des Gegenstandes sei die allgemeine Grundessenz desselben, dieser in allen seinen Facetten, die möglich sein könnten, betrachtet aus allen möglichen Blickwinkeln. Von einem einzigen Standpunkt aus würde immer nur ein weiteres Abbild dieser Idee wahrgenommen. Das betrachtende Subjekt nimmt also einen Gegenstand als Idee desselben wahr, sobald es ihn als in der Zeit unvergänglich, absolut, setzt, d.h. sich nicht vergegenwärtigt, daß der betrachtete Gegenstand seine Erscheinung in der Zeit verändert.
In der Realität aber ist diese „wahre Vergangenheit“ so nicht existent, da sich diese wiederum nur aus anderen Blickwinkeln zusammensetzt - das betrachtende Subjekt nimmt dies nur auf diese Weise nicht wahr, da es die eigene Veränderung in der Zeit an sich selbst nicht wahrnimmt.
Laut Merleau-Ponty liegt also der Ursprungsort des Objekts nicht in dessen -nicht existenten- „wahrenVergangenheit“, sondern in der Erfahrung des Subjekts, die zwar von diesem für wahr angenommen wird, aber durchaus subjektiv, weil von verschiedenen individuellen Gesichtspunkten aus gebildet, ist.
So entsteht die Schwierigkeit, das Paradox anzuerkennen, das für den Schauenden „etwas für ihn an sich ist“12.
In besonderer Form stellt sich die Frage nach der Problematik der Subjekt-Objekt- Verschiebung bzw. dem Paradox, daß „etwas für uns an sich ist“ in den frühen Diskursen über den Wahrheitsgehalt der Fotografie:
[...]
1 in: Simmel: „Großstädte und Geistesleben“ in: Gesamtausgabe Suhrkamp, Bd. 7, S. 117
2 in: Benjamin: „Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts“ in: Benjamin: „Illuminationen“, S. 175
3 vgl. dazu Konrad Dussel: „Die Entstehung der Massenkultur im deutschen Kaiserreich“ in: „Universitas - Zeitschrift für interdisziplinäre Wissenschaft“ Nr. 601, S. 675f.
4 in: Borschied, Wischermann (Hrsg.): „Bilderwelt des Alltags“
5 in: Haas: „Die neue Welt der Bilder - Werbung und visuelle Kultur in der Moderne“ in: Borschied, Wischermann (Hrsg.): „Bilderwelt des Alltags“, S. 64
6 in: ebd., S. 66
7 vgl. dazu u.a. Walter Benjamins „Passagenwerk“
8 in: Haas: „Die neue Welt der Bilder - Werbung und visuelle Kultur in der Moderne“ in: Borschied, Wischermann (Hrsg.): „Bilderwelt des Alltags“, S. 64
9 in: Gumbrecht: „Alltagswelt und Lebenswelt aus genealogischer Perspektive“ in: Kniesche (Hrsg.): „Körper/ Kultur“, S. 81
10 in: ebd., S. 82
11 zitiert nach: ebd., S. 86
Häufig gestellte Fragen zum Text 'Inhalt'
Worum geht es in dem Text 'Inhalt'?
Der Text untersucht, wie sich verschiedene Thesen und Erkenntnisse aus der Phänomenologie und der psychoanalytischen Forschung auf das Kinoerlebnis des Zuschauers anwenden lassen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Verknüpfung verschiedener Theorien zur Identifikation. Um dies zu veranschaulichen, wird zunächst die Veränderung der Wahrnehmung in der Moderne betrachtet, insbesondere im Hinblick auf die Körperwahrnehmung und gesellschaftliche Entwicklungen des 19. Jahrhunderts, die mit der Entstehung des Kinos zusammenhängen. Es folgt eine Übersicht über die Diskussion um das Medium Fotografie, die von Filmtheoretikern aufgegriffen wurde, und daraus ergeben sich dann die Ansätze für die Untersuchung des Kinos.
Welche Themen werden im Zusammenhang mit der veränderten Wahrnehmung in der Moderne behandelt?
Der Text behandelt Themen wie das Verhältnis von Masse und Individuum, die Rolle der Presse bei der Meinungsbildung, die Bedeutung bildkräftiger Werbung und die Veränderung in der Bedeutungsfindung. Außerdem werden Zeichen, Deregulation, Erfahrung, Fotografie als Dokumentation und Kunst sowie stimulierende Bildwelten erörtert.
Wie beeinflusst die Masse das Individuum laut dem Text?
Die wachsende Geschwindigkeit des Lebens in Großstädten führt zu einer verstärkten Rationalisierung und Intellektualisierung, während in kleineren, nicht-technisierten Gemeinschaften die Seele des Individuums stärker zum Ausdruck kommt. Gleichzeitig besteht ein verstärkter Wunsch nach Individualisierung in einer technisierten Welt.
Welche Rolle spielte die Presse bei der Veränderung der Wahrnehmung?
Die Entwicklung der freien Presse im 19. Jahrhundert ermöglichte kontroverse Diskussionen in der Öffentlichkeit. Die Aufhebung der Vorzensur und die Einbeziehung der Presse in die Gewerbefreiheit führten zu einer Zunahme der Massenpresse und der kommerziellen Inserate, was die öffentliche Wahrnehmung stark beeinflusste.
Welche Bedeutung hatte die bildkräftige Werbung?
Die bildkräftige Werbung, die durch das Aufkommen der Fotografie und neuer Drucktechniken ermöglicht wurde, verlagerte den Fokus von textlastiger Überzeugungsarbeit auf visuelle Schlagwirkung und Bildassoziationen. Dies führte zu einer neuen Bedeutungsebene zwischen Betrachter und beworbenem Objekt, wobei die Bedeutung des Objekts selbst in den Hintergrund trat.
Was bedeutet "Zeichen-Deregulation" im Kontext des Textes?
"Zeichen-Deregulation" beschreibt das Aufhören der Welt der Objekte als universell lesbare Welt, was Raum für intellektuelle und künstlerische Experimente schuf, da die Bipolarität zwischen Subjekt und Objekt verschwand.
Wie wird das Konzept der Erfahrung in der Moderne betrachtet?
Die Raumwahrnehmung eines Individuums findet immer über die Relativierung mittels eines "Horizontes" statt. Die menschliche Wahrnehmung setzt immer eine Seite des Gegenstandes, indem sie ihn mit anderen Gegenständen oder mit diesem selbst in der Zeit vor oder nach dem Moment des Wahrnehmens konfrontiert. Der Ursprungsort des Objekts liegt nicht in dessen -nicht existenten- "wahren Vergangenheit", sondern in der Erfahrung des Subjekts.
Wie wird der Zusammenhang zwischen Fotografie und Kino thematisiert?
Der Text deutet an, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verschiedene Filmtheoretiker die Diskussion um die Wahrheitsgehalt der Fotografie wiederaufgriffen und in ihren Ansätzen auf das Kino übertragen wurden.
Was sind die Kernaussagen des Textes 'Inhalt'?
Der Text argumentiert, dass das Kinoerlebnis eng mit der veränderten Wahrnehmung in der Moderne verbunden ist, die durch Faktoren wie Technisierung, Urbanisierung, die Rolle der Medien und die Bedeutungsfindung beeinflusst wird. Die Auseinandersetzung mit Theorien der Phänomenologie und Psychoanalyse ermöglicht ein tieferes Verständnis der Identifikationsprozesse beim Zuschauer.
- Arbeit zitieren
- Antonia Joseph (Autor:in), 2005, Körperwahrnehmung und Identifikation im Kino. Phänomenologische und psychoanalytische Gesichtspunkte ausgehend von einer veränderten Wahrnehmung in der Moderne, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39439