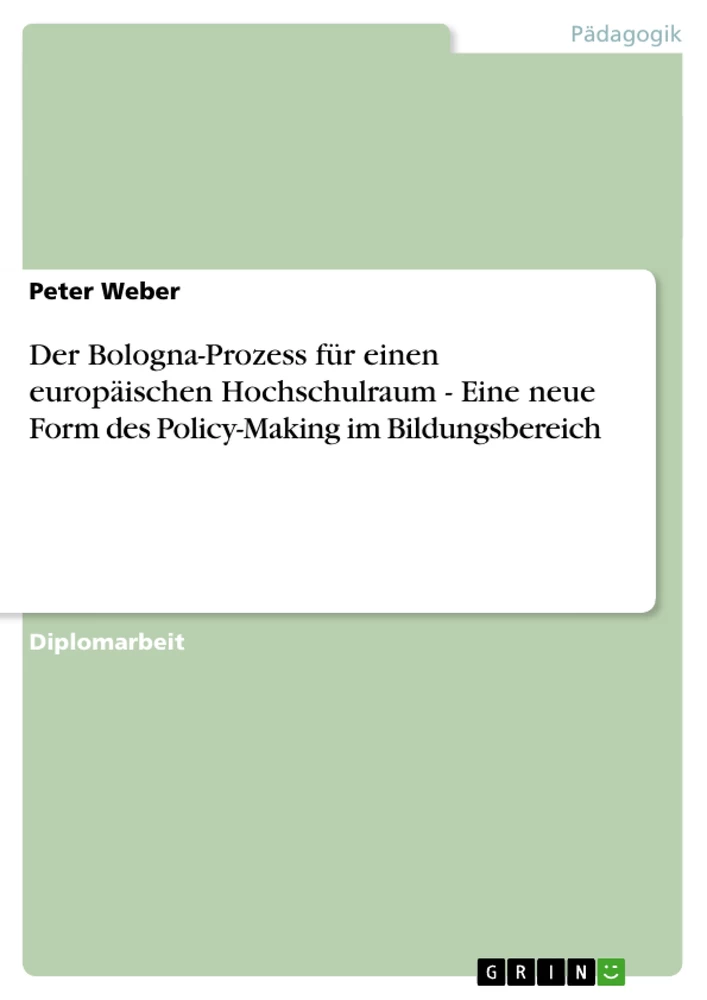Hochschulpolitik hat sich in den vergangenen Jahren zu einem politischen Feld entwickelt, das parallel zu anderen Fragen zunehmend durch die Handlungen internationaler Akteure und trans-nationaler Governanceprozesse beeinflusst wird. Entgegen der landläufigen Meinung, die Natio-nalstaaten würden ihren Einfluss auf den Hochschulsektor verteidigen und entgegen der einge-schränkten Zuständigkeit der EU, beginnt sich mit dem Bologna Prozess ein europäisches Hochschulregime herauszubilden das jedoch nicht durch die EU, sondern durch das Zusam-menspiel wichtige Akteure aus unterschiedlichen Ebenen bestimmt wird.
Die Arbeit beschäftigt sich mit dieser Entwicklung und versucht einerseits die Bedingungen her-auszuarbeiten unter denen sich nationale Politiken transnationalisieren: Wettbewerbsdruck, Vermarktli-chung, GATS, Internationale Institutionen wie bspw. die OECD und aktuelle politische Zielsetzungen. Andererseits werden die empirisch auftretenden Steuerungsversuche und Steuerungseffekte nachgezeichnet.
Die Entwicklung in der Hochschulpolitik wird unter zwei wichtigen theoretischen Aspekten betrachtet. Zum einen wird steuerungstheoretisch gefragt, wie Politik unter den gegebenen Bedingungen (Schwindende Durchgriffsmöglichkeit des Nationalstaats, Föderalismus, Verlagerung von Kompetenzen an andere Ebenen und Institutionen) möglich ist und es werden in diesem Zusammenhang neue Governance-Instrumente beschrieben die in den vergangenen Jahren im europäischen Raum eine wachsende Rolle spielen.
Es wird die Frage behandelt, ob das Ziel des kohärenteren Hochschulsystems erreicht werden kann. Von solchen könnte dann gesprochen werden, wenn es gelingt, entsprechend dieser verschiedenen vereinbarten Ziele, Fortschritte im genannten Sinne auf der Umsetzungsebene in den Nationalstaaten zu erreichen. Davon kann nur sehr bedingt gesprochen werden. Zwar wurden in den untersuchten Nationalstaaten Anstrengungen unternommen, es finden sich jedoch eher Indizien, die für ein Anwachsen der Diversität und für eine diffuse Umsetzung sprechen. Die Arbeit kann zeigen, dass sowohl auf nationaler Ebene als auch auf Länderebene in Deutschland, aber teilweise auch in der Schweiz, die Implementierung auch deshalb gelingt, weil die Kostenfrage auf der jeweils darunter liegenden Ebene gelöst werden soll. Der Konflikt in dieser Frage wird so systematisch nach verschoben. Zu vermuten ist, dass dieser Finanzierungskonflikt letztlich innerhalb der Hochschulen entschieden werden muss.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. GOVERNANCE IM TRANSNATIONALEN RAUM
- 1.1 STEUERUNGSFÄHIGKEIT - THEORETISCHE IMPLIKATIONEN FÜR POLITISCHES HANDELN
- 1.1.1 STEUERUNGSFÄHIGKEIT ALS POLITIKWISSENSCHAFTLICHES KONZEPT
- 1.1.2 SYSTEMTHEORETISCHE KRITIK AM KONZEPT DER STEUERUNGSFÄHIGKEIT
- 1.1.3 VON DER STEUERUNG ZUR „GOVERNANCE”
- 1.1.4 AKTEURSZENTRIERTER INSTITUTIONALISMUS
- 1.2 TENDENZEN DER ENTGRENZUNG - INTERNATIONALISIERUNG UND EUROPÄISIERUNG VON POLITIK
- 1.2.1 ÜBERGANG VON DER NATIONALEN ZUR INTERNATIONALEN UND POSTNATIONALEN KONSTELLATION
- 1.2.2 MERKMALE POSTNATIONALER POLITIK UND DES REGIERENS JENSEITS DES NATIONALSTAATS
- 1.2.3 MÖGLICHKEITEN DER RE-REGULIERUNG ALS ANTWORT AUF ABNEHMENDE NATIONALSTAATLICHE PROBLEMLÖSUNGSFÄHIGKEIT
- 1.3 KOORDINIERTE POLITIKEN UND NEUE GOVERNANCE-INSTRUMENTE
- 1.3.1 NEUE GOVERNANCE-FORMEN
- 1.3.2 KENNZEICHEN UND INSTRUMENTE DER NEUEN GOVERNANCE-FORMEN
- 1.1 STEUERUNGSFÄHIGKEIT - THEORETISCHE IMPLIKATIONEN FÜR POLITISCHES HANDELN
- 2. DIE HOCHSCHULSYSTEME ZWISCHEN INTERNATIONALISIERUNG UND NATIONALSTAATLICHEM EINFLUSS
- 2.1 INTERNATIONALISIERUNG UND TRANSNATIONALISIERUNG DER HOCHSCHULEN DER HOCHSCHULPOLITIK
- 2.1.1 INTERNATIONALISIERUNG, EUROPÄISIERUNG, TRANSNATIONALISIERUNG UND GLOBALISIERUNG - BEGRIFFLICHE ABGRENZUNG FÜR DIE HOCHSCHULPOLITIK
- 2.1.2 DIE UNTERSCHEIDUNG DER INTERNATIONALISIERUNG UND TRANSNATIONALISIERUNG DER HOCHSCHULSYSTEME UND DER HOCHSCHULPOLITIK
- 2.1.4 TRANSNATIONALISIERUNG DER HOCHSCHULPOLITIK
- 2.2 NATIONALSTAAT UND HOCHSCHULE – DarstellUNG VON ZUSAMMENHÄNGEN
- 2.2.1 UNTERSCHIEDLICHE CHARAKTERISTIKA DER HOCHSCHULSYSTEME AM BEISPIEL DEUTSCHLANDS
- 2.2.2 DAS SICH WANDELNDE VERHÄLTNIS VON STAAT UND HOCHSCHULE
- 2.2.3 HOCHSCHULPOLITIK UND NATIONALSTAATLICHER EINFLUSS - WAS SPRICHT GEGEN EINE DENATIONALISIERUNG IN DER HOCHSCHULPOLITIK?
- 2.3 REFORMEN, REFORMBEDARFE UND REFORMPROBLEME
- 2.3.1 REFORMEN IM HOCHSCHULSYSTEM SEIT 1950 AM BEISPIEL DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
- 2.3.2 THEMEN UND GEGENSTÄNDE DER AKTUELLEN HOCHSCHULDISKUSSION
- 2.4 ENTWICKLUNGEN ZU EINER EUROPÄISCHEN HOCHSCHULPOLITIK?
- 2.4.1 TRANSNATIONALISIERUNG DER HOCHSCHULPOLITIK IN EUROPA
- 2.4.2 SKIZZIERUNG DER POLITISCHEN ZUSAMMENHÄNGE, IN DENEN DIE INTERNATIONALISIERUNG DER HOCHSCHULPOLITIK STEHT
- 2.1 INTERNATIONALISIERUNG UND TRANSNATIONALISIERUNG DER HOCHSCHULEN DER HOCHSCHULPOLITIK
- 3. DATEN, DOKUMENTE UND ANALYSEVERFAHREN
- 3.1 METHODIK DER ARBEIT
- 3.1.1 QUALITATIVE INHALTSANALYSE
- 3.1.2 FORSCHUNGSABLAUF DER ARBEIT
- 3.2 BESTIMMUNG DER DATENGRUNDLAGE UND DER STICHPROBE
- 3.3 KATEGORIENBILDUNG UND TEXTCODIERUNG
- 3.4 FORMULIERUNG UND OPERATIONALISIERUNG VORLÄUFIGER HYPOTHESEN
- 3.4.1 BILDUNG VON HYPOTHESEN ZUR ANALYSE DES BOLOGNA-PROZESSES
- 3.4.2 OPERATIONALISIERUNG DER HYPOTHESEN
- 3.1 METHODIK DER ARBEIT
- 4. REKONSTRUKTION DES BOLOGNA-PROZESSES
- 4.1 ZUM ZEITLICHEN ABLAUF DES PROZESSES UND DIE DYNAMIK Der AktivitätEN
- 4.2 DIE EINBINDUNG VERSCHIEDENER AKTEURE UND UNTERSCHIEDLICHER EBENEN
- 4.2.1 AKTEURE UND EBENEN
- 4.2.2 ABWESENDE AKTEURE UND NEUE AKTEURE IM BOLOGNA-PROZESS
- 4.2.3 ROLLE VON EXPERTEN UND WISSENSCHAFTLICHEN AKTEUREN IM PROZESS
- 4.2.4 DIE EINBINDUNG IN EIN NETZ VON TRANSNATIONALEN AKTEUREN
- 4.3 DIE PROZESSGESTALTUNG UND DIE CHARAKTERISTIK DES PROZESSES
- 4.3.1 DIE WICHTIGSTEN INSTITUTIONALISIERUNGEN DES PROZESSES
- 4.3.2 DIE ENTWICKLUNG EINES INSTITUTIONELLEN RAHMENS FÜR KONVERGENZ
- 4.4 DIE ANWENDUNG UNTERSCHIEDLICHER GOVERNANCE-INSTRUMENTE
- 4.5 DAS VERHÄLTNIS ZWISCHEN TRANSNATIONALER, NATIONALER UND HOCHSCHULEBENE
- 4.6 DER BOLOGNA-PROZESS UND DIE AKTEURE AUF DEN UNTERSCHIEDLICHEN EBENEN DES PROZESSES
- 4.7 SPIELTHEORETISCHE MODELLIERUNG
- 4.7.1 DIE TRANSNATIONALE EBENE
- 4.7.2 DIE NATIONALE EBENE
- 4.8 ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN
- 5. DESKRIPTIVE DARSTELLUNG DER ZIELE DES PROZESSES
- 5.1 ZIELE DES PROZESSES
- 5.1.1 DIE VERBESSERUNG DER ANERKENNUNG UND EINFÜHRUNG DES „DIPLOMA-SUPPLEMENT”
- 5.1.2 DIE EINFÜHRUNG DER GESTUFTEN ABSCHLÜSSE „MASTER“ UND „BACHELOR”
- 5.1.3 DIE EINFÜHRUNG VON ECTS
- 5.1.4 DIE VERBESSERUNG DER MOBILITÄT
- 5.1.5 DIE SICHERUNG VON QUALITÄT
- 5.1.6 DIE SCHAFFUNG DES „EUROPEAN Higher Education AREA”
- 5.2 DIE ZIELE DES BOLOGNA-PROZESSES IM WEITEREN KONTEXT
- 5.2.1 ÜBERGEORDNETE ZIELE DES BOLOGNA-PROZESSES
- 5.2.2 ZIELE AUS DEM REFORMKONTEXT IN DEN NATIONALSTAATEN
- 5.3 KOHÄRENZ UND DIVERSITÄT
- 5.4 FINANZIERUNG
- 5.5 ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN
- 5.1 ZIELE DES PROZESSES
- 6. ANALYSE DER ZIELE UND IHRER IMPLEMENTIERUNG
- 6.1 DIE ZIELSETZUNG AUF TRANSNATIONALER EBENE
- 6.2 DIE UMSETZUNG IN DEUTSCHLAND
- 6.3 DIE UMSETZUNG IN DER SCHWEIZ
- 6.4 ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht den Bologna-Prozess im Kontext des transnationalen Policy-Making im Bildungsbereich. Sie analysiert die Entstehung, die Dynamik und die Ziele des Prozesses mit dem Fokus auf die Entwicklung eines europäischen Hochschulraums.
- Die Governance-Strukturen und Akteure im transnationalen Raum
- Die Rolle des Nationalstaates im Kontext der Internationalisierung der Hochschulpolitik
- Die Reformen und Reformbedarfe im deutschen Hochschulsystem
- Die Ziele und die Umsetzung des Bologna-Prozesses auf transnationaler und nationaler Ebene
- Die Analyse des Bologna-Prozesses anhand eines spieltheoretischen Modells
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Bologna-Prozesses ein und erläutert die Bedeutung des transnationalen Policy-Making im Bildungsbereich. Sie beschreibt die Entstehung und Entwicklung des Bologna-Prozesses im Kontext der europäischen Integration.
Kapitel 1 befasst sich mit dem Konzept der Governance im transnationalen Raum. Es wird die Entwicklung des Begriffs „Steuerung“ zur „Governance“ erläutert und verschiedene theoretische Perspektiven auf die Steuerung und das Regieren in komplexen transnationalen Systemen dargestellt. Die Kapitel 1.2 und 1.3 widmen sich den Tendenzen der Entgrenzung und der Herausforderungen des Nationalstaates im Kontext der Internationalisierung und Europäisierung von Politik. Darüber hinaus werden neue Governance-Instrumente und -formen im Bildungsbereich analysiert.
Kapitel 2 untersucht die Hochschulsysteme im Spannungsfeld zwischen Internationalisierung und nationalstaatlichem Einfluss. Es werden verschiedene Aspekte der Internationalisierung und Transnationalisierung der Hochschulpolitik sowie die Rolle des Nationalstaates in der Hochschulpolitik dargestellt. Kapitel 2.2 und 2.3 beleuchten die unterschiedlichen Charakteristika der Hochschulsysteme in verschiedenen Ländern und die Reformgeschichte des deutschen Hochschulsystems. Kapitel 2.4 thematisiert die Herausforderungen und Chancen einer europäischen Hochschulpolitik.
Kapitel 3 beschreibt die Methodik der Arbeit und die qualitative Inhaltsanalyse, die für die Analyse des Bologna-Prozesses eingesetzt wird. Es werden die Datenbasis, die Stichprobe sowie die Bildung von Kategorien und die Operationalisierung von Hypothesen erläutert.
Kapitel 4 rekonstruiert den Bologna-Prozess und analysiert dessen zeitlichen Verlauf, die beteiligten Akteure und die dynamischen Prozesse der Entwicklung. Es werden die wichtigsten Institutionalisierungen des Prozesses und die Anwendung von verschiedenen Governance-Instrumenten dargestellt. Darüber hinaus wird die Einbindung von Experten und wissenschaftlichen Akteuren sowie die Rolle des Nationalstaates im Kontext des Bologna-Prozesses beleuchtet.
Kapitel 5 präsentiert die Ziele des Bologna-Prozesses. Es werden die wichtigsten Ziele wie die Verbesserung der Anerkennung von Abschlüssen, die Einführung von „Master“ und „Bachelor“-Studien sowie die Förderung der Mobilität und die Sicherung der Qualität dargestellt. Darüber hinaus werden die Ziele des Bologna-Prozesses im Kontext der europäischen Integration und der Reformbestrebungen in den einzelnen Nationalstaaten erläutert.
Kapitel 6 analysiert die Ziele des Bologna-Prozesses und deren Umsetzung auf transnationaler und nationaler Ebene. Es werden die Umsetzung des Bologna-Prozesses in Deutschland und in der Schweiz untersucht und die Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der Implementierung des Bologna-Prozesses in den einzelnen Ländern dargestellt.
Schlüsselwörter
Bologna-Prozess, Transnationales Policy-Making, Europäische Hochschulpolitik, Internationalisierung, Transnationalisierung, Governance, Steuerung, Nationalstaat, Hochschulsystem, Reformen, Reformbedarfe, Qualitätssicherung, Mobilität, Anerkennung von Abschlüssen, ECTS.
Häufig gestellte Fragen zum Bologna-Prozess
Was ist das Hauptziel des Bologna-Prozesses?
Das Hauptziel ist die Schaffung eines kohärenten europäischen Hochschulraums durch die Harmonisierung von Studiengängen und Abschlüssen, um die Mobilität und Anerkennung zu verbessern.
Welche Rolle spielt der Nationalstaat im Bologna-Prozess?
Obwohl sich ein europäisches Hochschulregime herausbildet, bleibt der Nationalstaat ein zentraler Akteur bei der Umsetzung, wobei die Arbeit zeigt, dass die Implementierung oft diffus verläuft.
Was sind die wichtigsten Ziele für Studierende?
Dazu gehören die Einführung gestufter Abschlüsse (Bachelor und Master), die Nutzung des ECTS-Punktesystems und die Verbesserung der internationalen Mobilität.
Wie wird die Qualitätssicherung im Bologna-Prozess geregelt?
Qualitätssicherung ist eines der Kernziele, um vergleichbare Standards innerhalb des europäischen Hochschulraums zu gewährleisten und das Vertrauen in die Abschlüsse zu stärken.
Welche theoretischen Ansätze werden zur Analyse genutzt?
Die Arbeit nutzt steuerungstheoretische Konzepte wie Governance, den akteurszentrierten Institutionalismus und systemtheoretische Kritiken.
Wird das Ziel eines kohärenteren Hochschulsystems erreicht?
Laut der Untersuchung kann davon nur bedingt gesprochen werden; es finden sich eher Indizien für ein Anwachsen der Diversität und eine diffuse Umsetzung in den Nationalstaaten.
- Citation du texte
- Peter Weber (Auteur), 2003, Der Bologna-Prozess für einen europäischen Hochschulraum - Eine neue Form des Policy-Making im Bildungsbereich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39570