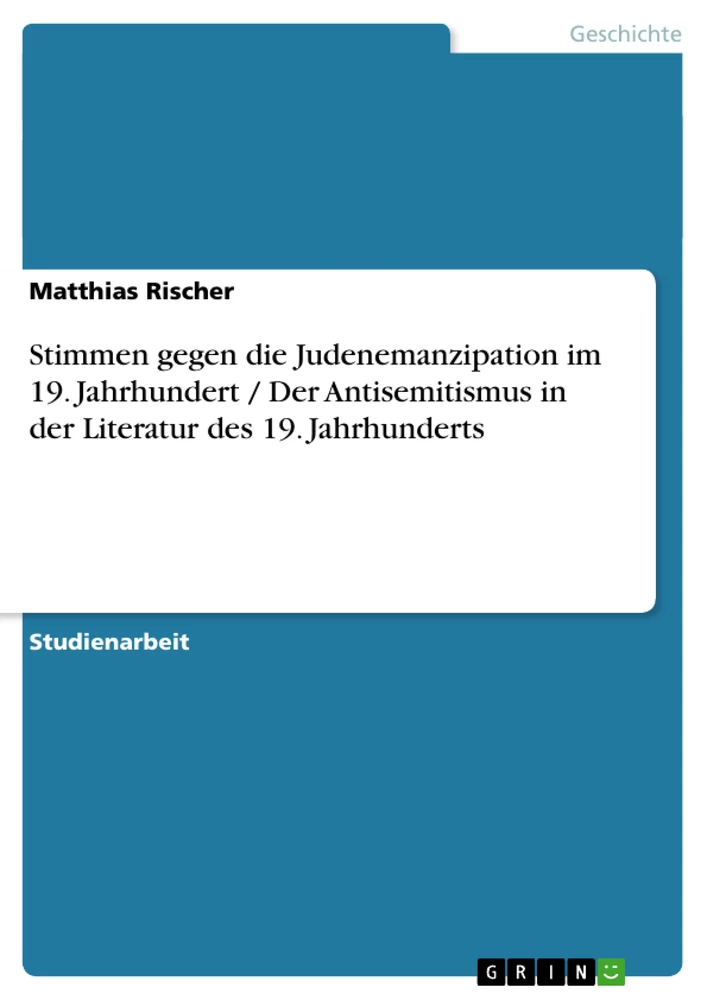I) Einleitung
Mit der Errungenschaft der Menschenrechte nach dem Zeitalter der Aufklärung und den Neuerungen durch die französische Revolution im Sinne von Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit bot sich für die Deutschen aller Staaten ein ganz neues Verständnis vom Miteinanderleben, von dem eigenen Wert, von der Unabhängigkeit, dem Freiwerden aus jahrhundertelanger Knechtschaft durch den Adel und den Fürsten der Feudalherrschaft.
Die Juden in den deutschen Staaten sahen in dieser „politisch- gesellschaftlichen Neuordnung“ die Möglichkeit, aus der jahrhundertelangen Position des „Bürgers zweiter Klasse“, welchem nicht die gleichen Rechte zustanden, herauszutreten, und mit Hilfe der aus dem Naturrechtsdenken der Aufklärung entstandenen Menschenrechte die Gleichheit vor dem Gesetzt zu erlangen. Der Anfang der Emanzipation wird von vielen Historikern in dem Beginn der französischen Revolution 1789 als Teil des allgemeinen Kampfes um die Menschenrechte gesehen, andere sprechen von einer ersten „unvollständigen Emanzipation“ während der napoleonischen Herrschaft, bei der die Gleichstellung von den französischen Besatzungsbehörden in einigen Ländern verordnet wurde und daraufhin dieses als Vorbild auch in anderen Ländern übernommen wurde. Viele, und darunter hauptsächlich die streng Nationalen, sprachen in Bezug auf die von den Franzosen auferlegten Maßnahmen von einer „ausländischen Tyrannei“. Ein weiteres Fortschreiten der Emanzipationsbewegung brachten die Revolutionsjahren 1848/49 mit sich. Zwanzig deutsche Staaten erkannten die vollständige Gleichstellung der Juden unbedingt an.
Erst durch die Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes 1869 wurde die unter anderem von Wilhelm von Humboldt, um 1800 Leiter des Schul- und Bildungswesen im preußischen Innenministerium, geforderte uneingeschränkte Gleichstellung verwirklicht, nach gut einem halben Jahrhundert heftiger Diskussionen und Auseinandersetzungen.
Die Argumente und Ansichten gegen die Emanzipationsbewegung müssen vor ihrer Gewichtung zunächst einmal auf gewisse historisch-gesellschaftliche Hintergründe untersucht werden. Zu fragen ist dabei, aus welchen gesellschaftlichen und politischen Schichten die Autoren antisemitischer Schriften stammten, aus welcher Intention sie handelten und wie sie zu den von ihnen formulierten Thesen gekommen waren. Diese Einstellung beruhte auf ganz eigenen Vorurteilen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die zeitgenössischen antisemitischen Literaten
- Emanzipation/ Integration
- Argumente gegen eine Emanzipation der Juden
- Verurteilung der Emanzipationsbefürworter
- Alternativen zur Emanzipation
- Die Auswirkung antisemitischer Schriften
- Die rassistisch antisemitische Weltanschauung
- Aussichten/ Perspektiven
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert antisemitische Schriften des 19. Jahrhunderts, die sich gegen die Emanzipation der Juden richteten. Er untersucht die Argumente und Ansichten der antisemitischen Literaten und stellt sie in den Kontext der damaligen Gesellschaft und Politik.
- Antisemitische Strömungen in der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts
- Argumente gegen die Emanzipation der Juden
- Rassistische Stereotype und Vorurteile
- Die Auswirkung antisemitischer Schriften auf die Gesellschaft
- Die Bedeutung des Naturrechtsdenkens und der Aufklärung für die Emanzipationsbewegung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet den historischen Kontext der Emanzipationsbewegung und die Herausforderungen, die Juden in den deutschen Staaten im 19. Jahrhundert konfrontiert sahen. Sie beschreibt den Aufstieg des Naturrechtsdenkens und der Aufklärung als Katalysatoren für die Forderung nach Gleichheit und Freiheit. Die Einleitung skizziert auch die Anfänge der Emanzipation, die mit der französischen Revolution 1789 einhergingen. Die Autoren zeigen die unterschiedlichen Ansichten zu den Etappen der Emanzipation und die Ablehnung der „ausländischen Tyrannei“ durch viele Deutsche. Die Kapitel geht auf die weiteren Fortschritte der Emanzipationsbewegung in den Revolutionsjahren 1848/49 ein und beschreibt die vollständige Gleichstellung der Juden in zwanzig deutschen Staaten.
Die zeitgenössisch antisemitischen Literaten
In diesem Kapitel werden die Argumentationslinien der antisemitischen Literaten des 19. Jahrhunderts analysiert. Die Autoren unterstreichen die tiefe Abneigung gegen die Emanzipation der Juden und stellen die „natürliche Verschiedenheit“ zwischen Juden und Nichtjuden heraus. Sie beziehen sich auf Schriften von Autoren wie Hartwig von Hundt- Radowsky und Daniel Frymann, um die Argumentation der Antisemiten zu verdeutlichen. Die Kapitel analysiert die Vorurteile und Stereotype, die gegen Juden gerichtet wurden, und zeigt auf, wie diese in Rechtfertigungsmuster für die Ablehnung der Emanzipation umgewandelt wurden. Die Autoren erläutern, wie das negative Judenbild in politischer, wirtschaftlicher, religiöser und gesellschaftlicher Hinsicht als Rechtfertigung für die Ausgrenzung der Juden diente.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe dieses Textes sind Antisemitismus, Emanzipation, Integration, Vorurteile, Stereotype, Naturrechtsdenken, Aufklärung, Rassismus, Judenbild, jüdische Religion, gesellschaftliche Ordnung, politische System.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelte sich die Judenemanzipation im 19. Jahrhundert?
Die Bewegung begann mit der Aufklärung und der Französischen Revolution (1789). Nach langen Debatten wurde die uneingeschränkte Gleichstellung erst 1869 durch die Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes verwirklicht.
Wer waren die Gegner der Judenemanzipation?
Die Gegner stammten aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, oft aus national-konservativen Kreisen. Bekannte antisemitische Literaten waren etwa Hartwig von Hundt-Radowsky oder Daniel Frymann.
Welche Argumente wurden gegen die Gleichstellung angeführt?
Häufige Argumente waren eine behauptete „natürliche Verschiedenheit“, religiöse Vorurteile sowie wirtschaftliche und politische Ängste, die in rassistische Stereotype mündeten.
Welchen Einfluss hatte die Aufklärung auf diesen Prozess?
Das Naturrechtsdenken der Aufklärung forderte Gleichheit vor dem Gesetz für alle Bürger, was die rechtliche Basis für die Emanzipationsforderungen der Juden bildete.
Welche Auswirkungen hatte die antisemitische Literatur jener Zeit?
Diese Schriften verfestigten Vorurteile in der Gesellschaft und schufen Rechtfertigungsmuster für Ausgrenzung, die weit über das 19. Jahrhundert hinaus wirkten.
- Quote paper
- Matthias Rischer (Author), 2001, Stimmen gegen die Judenemanzipation im 19. Jahrhundert / Der Antisemitismus in der Literatur des 19. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39741