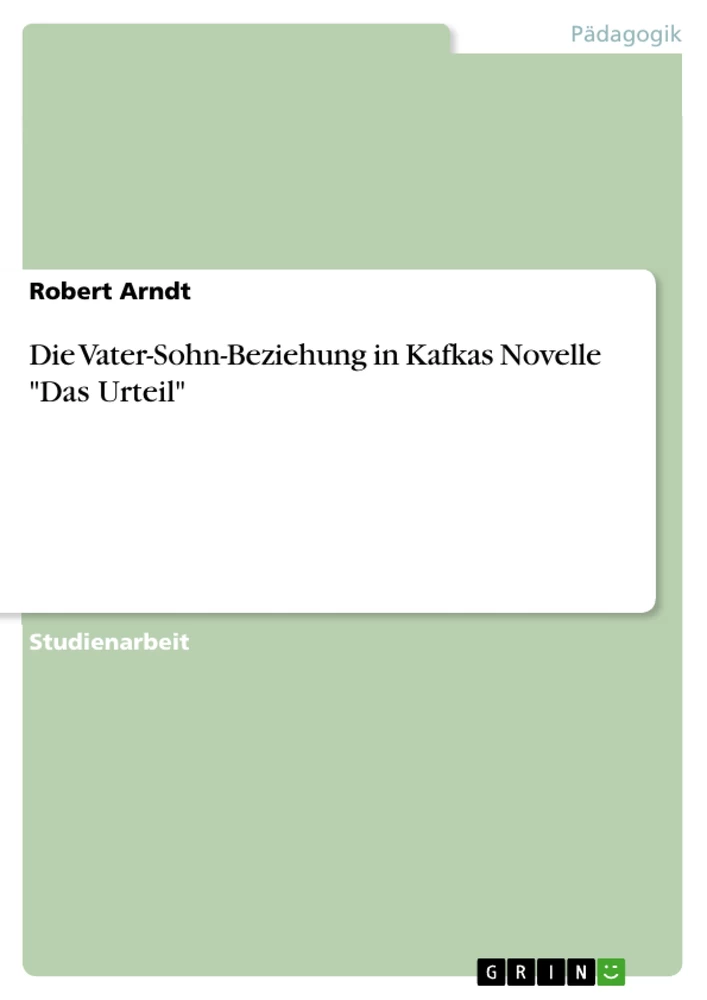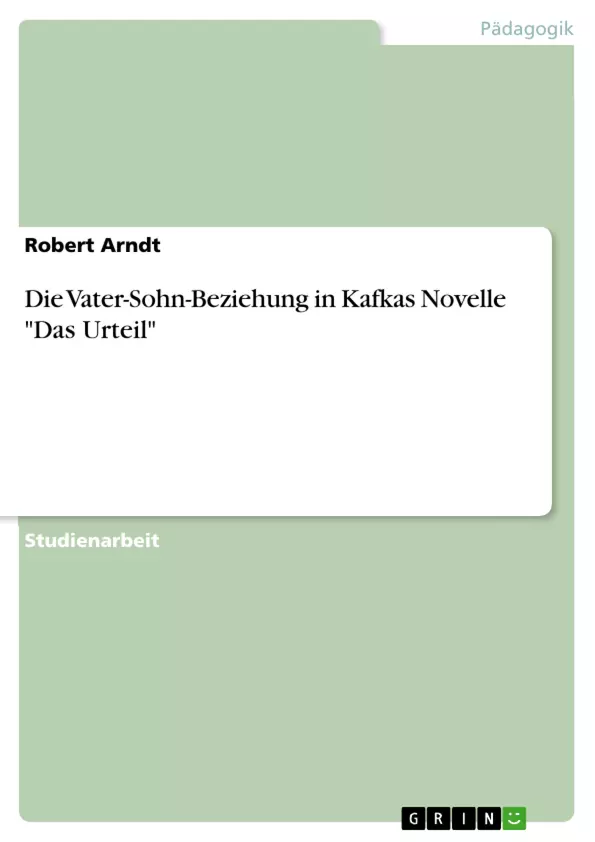Es wird dargelegt, wie die Vater-Sohn-Beziehung sich vollzieht.
Wenn es um Franz Kafka und seine Texte geht, dann spricht Peter von Matt (1999) von einer „Bibel des 20. Jahrhundert“ und betont, dass „kein anderes Werk in der westlichen Welt mit solchem Ernst, solcher Hingebung gelesen [wird].“ Vor allem erweist sich die Novelle „Das Urteil“ als ein Gegenstand zahlreicher literarischer Untersuchungen, da sie zunächst von einem Familien- und Generationenkonflikt zwischen dem Protagonisten Georg Bendemann und seinem Vater erzählt, im Grunde aber in metaphorisch überhöhter, zeichenhafter Sprache diverse andere Sujets zusammenbringt. So ist dieses Werk vor allem auch Paradigma für Kafkas prominente Auseinandersetzungen mit dem Themenkomplex, der um die Schlüsselbegriffe Richter, Recht/ Unrecht, Urteil und schließlich Schuld kreist.
Bezogen auf den Konflikt zwischen Vater und Sohn drängt sich die Frage nach der Schuld auf, da diese im allgemeinen Verständnis die Verletzung oder Nichteinhaltung eines Gesetzes ist, und auf Grundlage dessen es nur zur Vollstreckung eines Urteils kommen kann. Dazu kam die Frage die auf: Wer ist eigentlich der Unschuldige und wer trägt die Schuld? Aufgrund der Tatsache, dass der Unschuldige beziehungsweise der Schuldige nicht transparent in der Erzählung erscheint, bedarf es den Fokus auf die Zeichenhaftigkeit der Handlung, der Redeführung, dem Erscheinungsbild sowie dem Habitus der Figuren zu legen.
Im Folgenden wird die Uneindeutigkeit der Schuld in diesem Werk Kafkas zur Grundlage genommen, mit dem Ziel zu beantworten, warum es einerseits zum eilfertigen Vollzug, andererseits zum Urteilspruch kommt, den der Vater nach einer wortgewandten Auseinandersetzung über seinen Sohn fällt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- SCHULD UND UNSCHULD IN FRANZ KAFKAS NOVELLE "DAS URTEIL"
- DIE VERHANDLUNG – ZUR VATER-SOHN-BEZIEHUNG
- DIE VERURTEILUNG – ZUR VATER-SOHN-BEZIEHUNG
- DER VOLLZUG – ZUM SELBSTMORD GEORGS
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat analysiert die Vater-Sohn-Beziehung in Franz Kafkas Novelle "Das Urteil" und untersucht die komplexe Thematik von Schuld und Unschuld im Kontext der Erzählung. Es werden die sprachlichen Mittel und symbolischen Elemente der Geschichte analysiert, um die Ursachen für den dramatischen Konflikt zwischen Vater und Sohn aufzudecken.
- Die ambivalente Rolle des Vaters und seine Macht über den Sohn
- Die Bedeutung von Schuld und Unschuld in der Vater-Sohn-Beziehung
- Die symbolische Sprache Kafkas und ihre Interpretation
- Die ambivalenten Charaktere und ihre psychologischen Beweggründe
- Die soziale und gesellschaftliche Dimension der Erzählung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Vater-Sohn-Beziehung in "Das Urteil" ein und stellt die Bedeutung der Novelle für die literarische und philosophische Diskussion dar.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Frage nach Schuld und Unschuld in der Erzählung und untersucht die Rolle der Gerichtsverhandlung, die zwischen Vater und Sohn stattfindet. Es wird die Beziehung zwischen den Figuren sowie die sprachlichen und symbolischen Mittel der Geschichte analysiert, um die komplexe Thematik von Schuld und Unschuld zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Franz Kafka, "Das Urteil", Vater-Sohn-Beziehung, Schuld, Unschuld, Gericht, Verhandlung, Symbolismus, Sprache, Psychologie, Soziales, Gesellschaft.
- Quote paper
- Robert Arndt (Author), 2018, Die Vater-Sohn-Beziehung in Kafkas Novelle "Das Urteil", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/397920