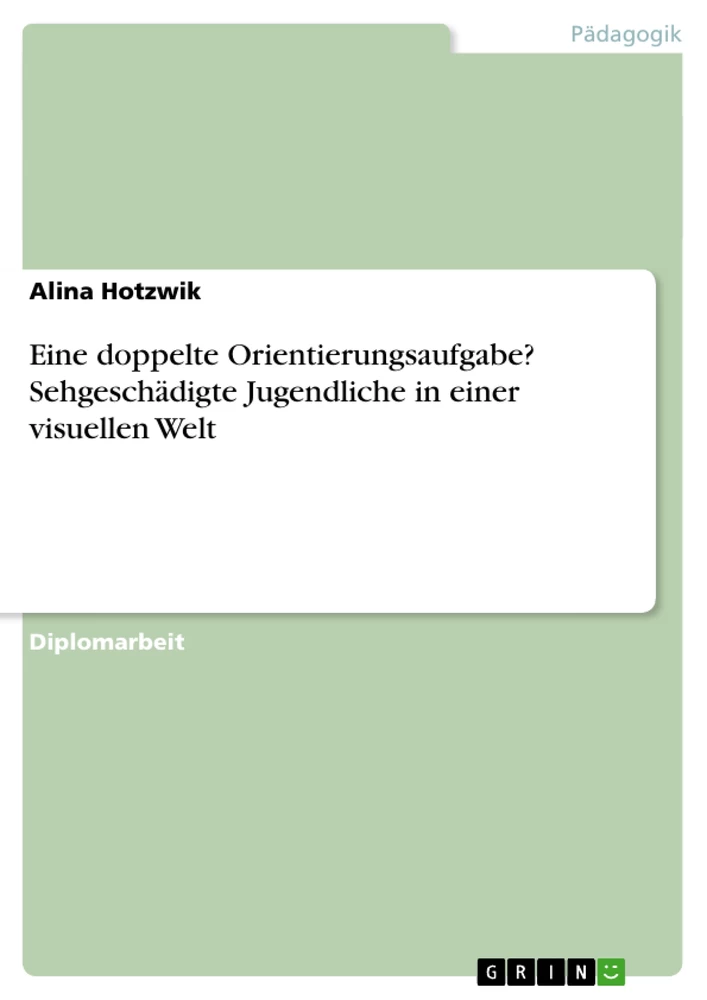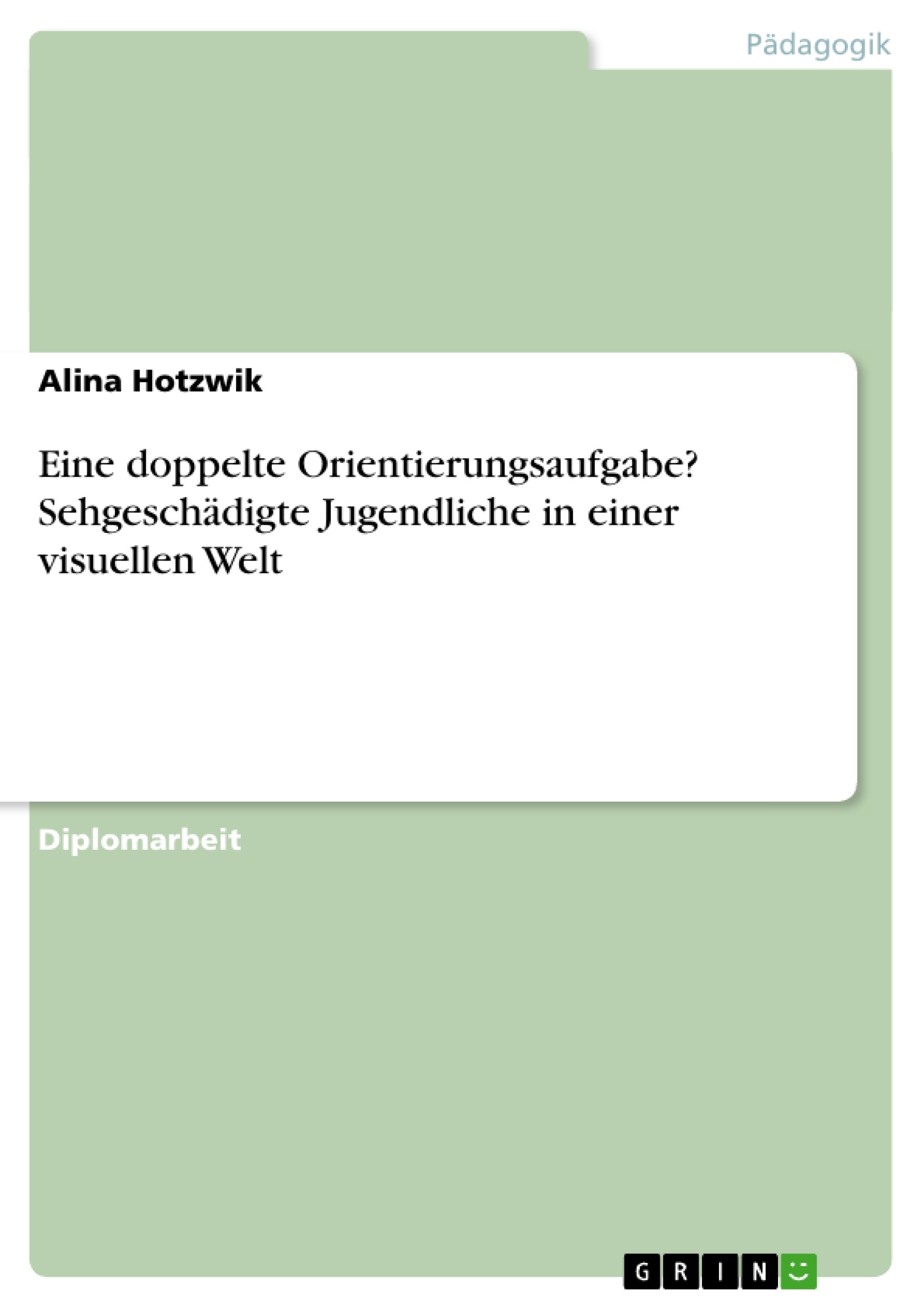[...] Das Ziel dieser Diplomarbeit ist es die Einstellungen von Jugendlichen mit einer Sehschädigung zu sich selber, ihrer Sehschädigung und den gesellschaftlichen Erwartungen zu erforschen. Diese drei Gebiete werden miteinander verknüpft und bilden den theoretischen Hintergrund für die empirische Forschung. Meine Diplomarbeit gliedert sich in folgende Abschnitte ein. Nach meiner Einleitung beschreibe ich im zweiten Kapitel Sehen, Wahrnehmung, Sehschädigung und deren unterschiedliche Auswirkungen. Zudem stelle ich zwei Konzepte vor: Das funktionalen Sehen und Low Vision. Das dritte Kapitel fokussiert den Jugendlichen. Die Lebensphase „Jugend“ wird aus psychologischer und soziologischer Sicht betrachtet. Die Jugendlichen der 90er Jahre werden im Wandel der Zeit bis heute durchleuchtet. Weil sich im Jugendalter die Identität ausbildet, ist sie ein zentraler Aspekt dieses Kapitels. Sind Menschen, die anders sehen, behindert? Der Begriff der Behinderung kommt erst an dieser Stelle, im vierten Kapitel, zum Zuge. Mir erschien es logischer, Behinderung durch gesellschaftliche Erwartungen und Einstellungen zu definieren. Ich nehme bezug auf das Menschenbild, den Wandel in Gesellschaft und dem Bewusstsein von Menschen mit einer Behinderung. Das Ende des theoretischen Teils wird durch den Gesichtspunkt möglicher (gesellschaftlicher) Benachteiligungen eingeläutet. Ab dem fünften Kapitel setzt der empirische Abschnitt ein. Ich wende das Verfahren der qualitativen Sozialforschung an. Zu Beginn stelle ich die Forschungsmethode vor und widme mich dann ihrer Umsetzung mit konkretem Bezug auf meine Untersuchung. Das sechste Kapitel stellt die Resultate der einzelnen Interviews dar. Durch ihre Aussagen erfahren wir etwas über Wertvorstellungen und Ziele im Jahre 2002. Des Weiteren werden die theoretischen Aspekte von Sehen, Sehschädigung und Gesellschaft aus der Sichtweise von Jugendlichen bekräftigt oder dementiert. Die Ergebnisse werden im siebten Kapitel der Reflexion zusammengefasst. Abschließend folgt ein kurzes Resümee über meine persönlichen Ansichten zu dem Thema.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sehschädigung, was ist das?
- Sehen und Wahrnehmen = Abbild der Wirklichkeit?
- "Ich sehe Dich"- Warum sehen wir?
- Aspekte der Wahrnehmung
- ,, Wir sehen nicht, dass wir nicht sehen“
- Zum Verständnis von Sehschädigung
- Definition
- Zwei Konzepte: Funktionales Sehen und Low Vision
- Verschiedene Formen einer Sehschädigung
- Ursachen und Altershäufigkeit von Sehschädigungen
- Beispiele für Sehbeeinträchtigungen und ihre Auswirkungen
- Born to be YOUNG
- Lebensphase „Jugend“
- Was ist ein „,Jugendlicher\"?
- Psychologische und soziologische Kriterien der „Jugendphase \"
- Untersuchungen zum Selbstverständnis
- Die Jugendlichen der 90er Jahre
- Jugend zwischen Rock, Hippies und Punk
- ,,Free your mind and rave around the clock"
- Wer bin ich?
- Identitätsbegriff
- Identitätsbalance
- Sehschädigung: Der Mittelpunkt der Identität?
- Ergebnisse zur Identitätsforschung bei Jugendlichen
- Anders sehen – behindert sein?
- Definition von Behinderung
- Erklärungsansätze und kritische Reflexion von „Behinderung“
- Progressive Betrachtungsweisen: ICIDH-2 und Konstruktivismus
- Menschenbild
- ,,Jung, gesund, attraktiv\": Das Erfolgsrezept für ein glückliches Leben
- ,,Alt, krank, behindert“: Das Erfolgskonzept für ein unglückliches Leben
- Menschen mit einer Behinderung: Gleiches Recht auf Leben und Tod
- Leben in unserer Gesellschaft
- Allgemeine gesellschaftliche Wandlungsprozesse
- Bewusstseinswandel bei Menschen mit einer Behinderung
- Benachteilungen im Alltag
- Einstellungen
- Vorurteile
- Stigmatisierung
- Labeling Approach
- Forschungsmethodik
- Qualitative Sozialforschung
- Qualitative Forschung
- Das qualitative Interview
- Leitfaden – Interviews: Fokus auf problemzentrierte Befragung
- Auswertung von Daten: Qualitative Inhaltsanalyse
- Methodische Umsetzung
- Vorstellung des Materials
- Konkrete Fragestellungen der Analyse
- Formale Analysetechniken und Gütekriterien
- Jugendliche mit einer Sehschädigung in einer visuellen Welt
- Junge Menschen: Ihre Werte und Ziele
- Jung sein versus erwachsen sein
- Persönliche Werte versus gesellschaftliche Maßstäbe
- Selbstbild versus Fremdbild
- Die Welt anders sehen
- Verschiedene Sehschädigungen
- Orientierung und Erschwernisse im Alltag
- Bedeutung von Sehen für einen Menschen mit einer Sehschädigung
- Gesellschaft von heute: Exklusion versus Integration
- Ist ein Mensch mit einer Sehschädigung behindert?
- Gesellschaftliche Erschwernisse
- Appell an alle
- Reflexion
- Zusammenfassung
- Resumee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Thematik sehgeschädigter Jugendlicher in einer visuellen Welt. Die Arbeit untersucht die spezifischen Herausforderungen und Bedürfnisse dieser Personengruppe im Kontext ihrer Identitätsentwicklung und gesellschaftlichen Integration.
- Die Bedeutung von Sehen für die Identitätsbildung und das Selbstverständnis von Jugendlichen
- Die Auswirkungen von Sehschädigungen auf den Alltag und die Lebenswelt Jugendlicher
- Gesellschaftliche Einstellungen und Vorurteile gegenüber Menschen mit Sehschädigungen
- Möglichkeiten und Herausforderungen der Integration sehgeschädigter Jugendlicher in die Gesellschaft
- Die Rolle der Bildung und der Unterstützungssysteme für die Inklusion sehgeschädigter Jugendlicher
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und skizziert den Forschungsgegenstand.
- Sehschädigung, was ist das?: Dieses Kapitel beleuchtet das Phänomen der Sehschädigung aus unterschiedlichen Perspektiven. Es definiert Sehschädigung, erläutert die Bedeutung des Sehens für den Menschen und beschreibt verschiedene Formen von Sehbeeinträchtigungen.
- Born to be YOUNG: Dieses Kapitel widmet sich der Lebensphase „Jugend“ und beleuchtet die psychologischen und soziologischen Aspekte dieser Phase. Der Fokus liegt auf der Identitätsentwicklung von Jugendlichen und den besonderen Herausforderungen, die mit einer Sehschädigung in dieser Phase einhergehen.
- Anders sehen – behindert sein?: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Begriff „Behinderung“ und setzt ihn in Bezug zu Sehschädigungen. Es werden verschiedene Erklärungsansätze diskutiert und die gesellschaftlichen Folgen von Behinderung thematisiert.
- Forschungsmethodik: Dieses Kapitel erläutert die methodische Vorgehensweise der Diplomarbeit. Es stellt die qualitative Sozialforschung und die spezifischen Methoden des Interviews und der Inhaltsanalyse vor.
- Jugendliche mit einer Sehschädigung in einer visuellen Welt: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung, die sich mit den Erfahrungen und Perspektiven sehgeschädigter Jugendlicher beschäftigt. Es beleuchtet ihre Werte und Ziele, ihre Erfahrungen mit der visuellen Welt und die Herausforderungen der Integration.
Schlüsselwörter
Sehschädigung, Jugend, Identität, Behinderung, Integration, Inklusion, visuelle Welt, Lebenswelt, Selbstverständnis, gesellschaftliche Einstellungen, qualitative Sozialforschung, Interview, Inhaltsanalyse, empirische Forschung, Erfahrungsberichte.
Häufig gestellte Fragen
Welche Herausforderungen haben sehgeschädigte Jugendliche bei der Identitätsbildung?
Die Identitätsbildung ist in der Jugendphase zentral. Sehgeschädigte Jugendliche müssen lernen, ihre Behinderung in ihr Selbstbild zu integrieren und gleichzeitig gesellschaftlichen Erwartungen an Attraktivität und Leistungsfähigkeit zu begegnen.
Was versteht man unter „Funktionalem Sehen“ und „Low Vision“?
Es handelt sich um Konzepte, die nicht nur die medizinische Sehschärfe betrachten, sondern wie ein Mensch sein vorhandenes Sehvermögen im Alltag nutzt und welche Hilfsmittel dabei unterstützen.
Wie wirkt sich Stigmatisierung auf betroffene Jugendliche aus?
Vorurteile und Stigmatisierung können dazu führen, dass Jugendliche sich über ihre Behinderung definieren oder sich ausgegrenzt fühlen, was die soziale Integration erschwert.
Was ist das Ziel der qualitativen Interviews in dieser Arbeit?
Die Interviews sollen die persönliche Sichtweise der Jugendlichen auf ihre Werte, Ziele und ihre Wahrnehmung der Gesellschaft im Jahr 2002 einfangen.
Bedeutet „anders sehen“ automatisch „behindert sein“?
Die Arbeit hinterfragt den Begriff der Behinderung kritisch und argumentiert, dass Behinderung oft erst durch gesellschaftliche Barrieren und Erwartungen entsteht.
- Arbeit zitieren
- Alina Hotzwik (Autor:in), 2002, Eine doppelte Orientierungsaufgabe? Sehgeschädigte Jugendliche in einer visuellen Welt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39847