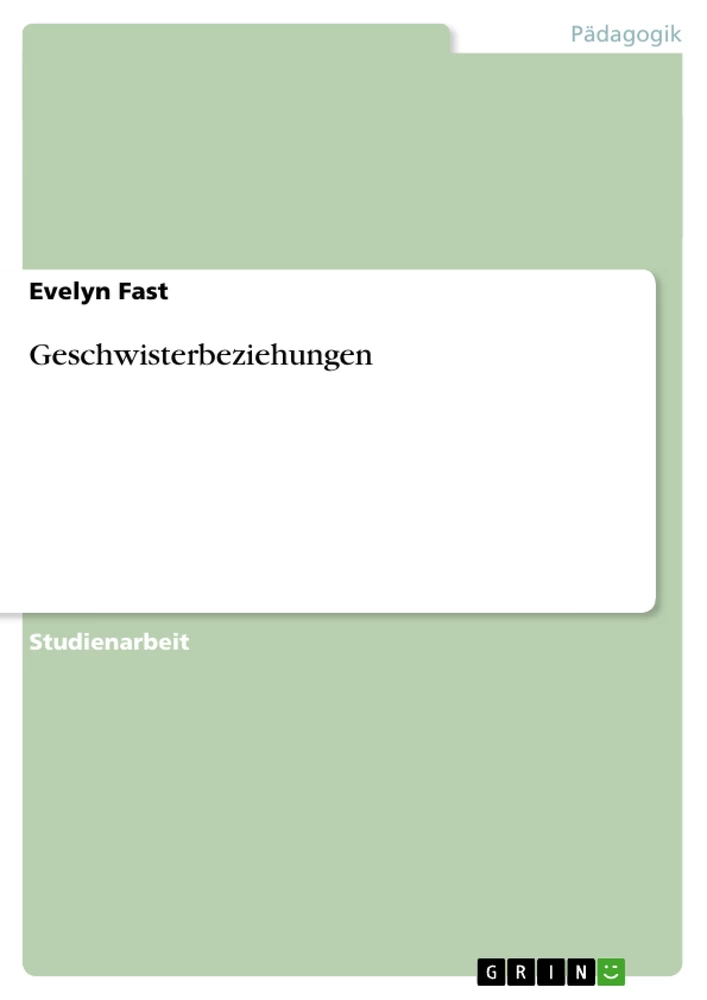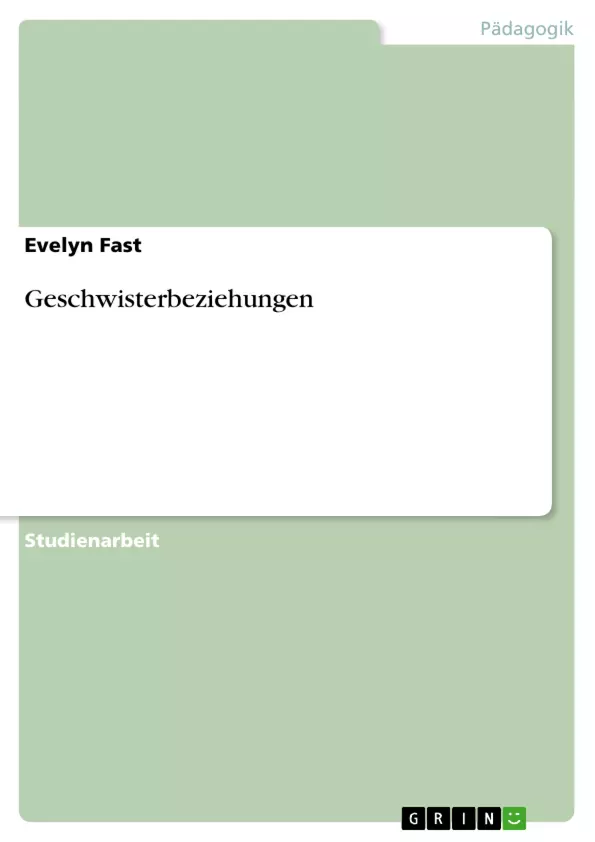In meiner Seminararbeit geht es um Geschwisterbeziehungen - wie sie entstehen und was sie ausmacht. Da es sich hierbei um ein sehr komplexes Thema handelt, gebe ich, im Rahmen meiner Seminararbeit, nur einen kleinen Einblick in die Thematik der Geschwisterbeziehungen. Im ersten Teil meiner Ausführungen gehe ich auf die Geschwisterbeziehungen und ihre Entwicklung in der frühen und mittleren Kindheit, im Jugendalter und im Erwachsenenalter ein. Anschließend folgt eine Betrachtung der Bedeutung der Geschwisterkonstellation für die Entwicklung des einzelnen Kindes, auch gebe ich ein Beispiel der idealen Geschwisterkonstellation. Da auch das Geschlecht in Geschwisterbeziehungen eine Rolle spielt, gehe ich auf dieses Thema im nächsten Kapitel ein.
Ein wichtiger Punkt im Leben von Geschwistern ist der Streit untereinander, weshalb ich diesen Aspekt noch einmal in einem gesonderten Abschnitt betrachte. Des Weiteren folgt eine Betrachtung des Sonderfalles unter Geschwistern, bei dem es sich um die Geburt von Zwillingen in der Familie handelt und im Anschluss daran gehe ich auf die Beziehung zu schwer kranken oder behinderten Geschwistern ein. Meine Ergebnisse fasse ich im abschließenden Resümee noch einmal zusammen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Geschwisterbeziehung und ihre Entwicklung
2.1 Entstehung und Aufbau der Geschwisterbeziehung in der frühen Kindheit
2.2 Geschwisterbeziehungen in der mittleren Kindheit und im Jugendalter
2.3 Die Beziehung von Geschwistern im Erwachsenenalter
3. Geschwisterkonstellation und ihre Bedeutung für die Entwicklung
3.1 Die Rangordnung
3.2 Die Bedeutung des Geschlechts
4. Streit zwischen Geschwistern
5. Zwillinge
6. Die Beziehung zu schwer kranken oder behinderten Geschwistern
7. Resümee
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
In meiner Seminararbeit geht es um Geschwisterbeziehungen - wie sie entstehen und was sie ausmacht. Da es sich hierbei um ein sehr komplexes Thema handelt, gebe ich, im Rahmen meiner Seminararbeit, nur einen kleinen Einblick in die Thematik der Geschwisterbeziehungen. Im ersten Teil meiner Ausführungen gehe ich auf die Geschwisterbeziehungen und ihre Entwicklung in der frühen und mittleren Kindheit, im Jugendalter und im Erwachsenenalter ein. Anschließend folgt eine Betrachtung der Bedeutung der Geschwisterkonstellation für die Entwicklung des einzelnen Kindes, auch gebe ich ein Beispiel der idealen Geschwisterkonstellation. Da auch das Geschlecht in Geschwisterbeziehungen eine Rolle spielt, gehe ich auf dieses Thema im nächsten Kapitel ein.
Ein wichtiger Punkt im Leben von Geschwistern ist der Streit untereinander, weshalb ich dieses Thema noch einmal in einem gesonderten Abschnitt betrachte. Des Weiteren folgt eine Betrachtung des Sonderfalles unter Geschwistern, wenn nämlich Zwillinge in die Familie geboren werden und im Anschluss daran gehe ich auf die Beziehung zu schwer kranken oder behinderten Geschwistern ein. Meine Ergebnisse fasse ich im abschließenden Resümee noch einmal zusammen.
2. Die Geschwisterbeziehung und ihre Entwicklung
Geschwisterbeziehungen gehören zu den dauerhaftesten aller Bindungen, die ein Mensch in seinem Leben eingeht. Unfreiwillig wird ein Kind in eine Familie geboren und geht somit Bindungen ein, die es sich nicht selbst ausgesucht hat. „Dieser Umstand sorgt dafür, dass in Geschwisterbeziehungen Persönlichkeiten aufeinander treffen, die sehr verschieden sein können.“[1] Im Laufe eines Lebens durchläuft die Geschwisterbeziehung verschiedene Stadien und Entwicklungen.
2.1 Entstehung und Aufbau der Geschwisterbeziehung in der frühen Kindheit
Der Beginn einer Geschwisterbeziehung stellt für die meisten Erstgeborenen eine recht schmerzhafte Erfahrung dar, denn sie werden durch das Geborenwerden eines Geschwisterkindes in gewisser Art und Weise „entthront“. Diese Entthronung durch ein jüngeres Kind, das von nun an seinen Teil der Aufmerksamkeit von Vater und Mutter fordert, kann tiefe Spuren beim Erstgeborenen hinterlassen. „Wie tief sie sind, hängt vom Altersunterschied zwischen den Geschwistern und vom Verhältnis zwischen den Eltern und den einzelnen Kindern ab.“[2] Hierbei ist es natürlich von Bedeutung, wie schnell das zweite Kind auf das erste folgt. Haben die Eltern ein gutes und enges Verhältnis zum Erstgeborenen aufbauen können, wird das Ereignis der Geburt eines zweiten Kindes sicher nicht so schmerzhaft von ihm empfunden werden als wenn dies nicht der Fall ist. Folgt auf das ältere Kind sehr schnell ein Jüngeres, kommt es oft zu einer Geschwisterkonstellation, die unter dem Begriff „Pseudo-Zwillinge“ laufen kann. „Die Bezeichnung Pseudo-Zwillinge wird für Geschwister gebraucht, deren Altersunterschied geringer ist als achtzehn Monate; doch selbst Kinder mit bis zu zwei Jahren Altersunterschied können vom Pseudo-Zwillings-Effekt geprägt sein.“[3] Für Kinder, die bereits im Säuglingsalter ein Geschwister bekommen, besteht die Gefahr, sich nie mehr richtig davon zu erholen und sich somit ihr ganzes weiteres Leben vernachlässigt zu fühlen. An dieser Stelle setzt das Konkurrenzdenken der Kinder ein, denn ab diesem Zeitpunkt steht das Kind nicht mehr im alleinigen Interesse der Eltern. Aufgrund einiger Studien wurde herausgefunden, „daß Kinder schon sehr früh unmittelbar und direkt auf den Umgang der Eltern mit ihren Geschwistern reagieren.“[4] Auch zeigten die Studien, dass der Umgang der Mutter mit dem Neugeborenen in vielen Familien Auswirkungen auf Verhalten und Entwicklung des Erstgeborenen hatte. Die häufigste Reaktion auf die Interaktion zwischen Mutter und Neugeborenem äußerte sich in Protest und Forderung auf Anspruch der gleichen aufmerksamen Behandlung der Mutter. „Probleme von Erstgeborenen äußern sich in ganz unterschiedlicher Form, als aggressives, forderndes Verhalten, Schlafprobleme, extreme Anhänglichkeit oder Weinerlichkeit.“[5] Oft kommt es vor, dass Erstgeborene das Verhalten des Babys imitieren, um hierdurch die Aufmerksamkeit der Mutter zu erlangen. Bei einem Altersunterschied von weniger als 18 Monaten, zeigen sich die Erstgeborenen weniger belastet, da sie die Geburt des Babys aufgrund mangelnder sozial-kognitiver Fähigkeiten als weniger bedrohlich empfinden. Durch diverse soziale und kognitive Fortschritte, die das zweite Kind während der ersten zwei Lebensjahre macht, kommt es zu einem Wandel in den Gefühlen des Erstgeborenen. Es beginnt das jüngere Kind als attraktiven Spielpartner zu sehen, wodurch „sich mehr Möglichkeiten spielerischer Interaktion“[6] ergeben. Die Beziehung zwischen den beiden Geschwistern wird mit der Zeit gleichberechtigter und gewinnt immer mehr an Intensität. Dies führt wiederum dazu, dass die Beziehung immer konfliktreicher wird, da sich das ältere Kind oft vom Jüngeren in seinen Aktivitäten gestört fühlt. Das Erstgeborene übernimmt nun oft die Rolle des Lehrers und gibt meist den Ton und die Regeln an, denen sich das jüngere Kind in den meisten Fällen fügen muss. Sobald das neue Baby da ist, beginnen die Eltern vom älteren Kind nun viel mehr zu verlangen als von seinem jüngeren Geschwister. Hier liegt die Verantwortung bei den Eltern, richtig mit den Gefühlen und dem Verhalten ihres „entthronten“ Kindes umzugehen und ihm zu zeigen, dass sie ihn trotz des neuen Babys noch genauso sehr lieben wie vorher.
[...]
[1] Schmid, Christine: www.familienhandbuch.de/cmain/f_Fachbeitrag/a_Kindheitsforschung/s_1483.html
[2] Sørrig, Kirsten und Oluf Martensen-Larsen: Große Schwester, kleiner Bruder. Prägung durch die Familie. Kopenhagen: Scherz-Verlag 1991, S.28
[3] ders. S.30
[4] Dunn, Judy und Robert Plomin: Warum Geschwister so verschieden sind. Stuttgart: Klett-Cotta 1996, S.90
[5] Hofer, Manfred, Elke Wild und Peter Noack: Lehrbuch Familienbeziehungen. Eltern und Kinder in der Entwicklung. Göttingen: Hogrefe-Verlag 2002, S.202
[6] Hofer. S.203
- Quote paper
- Evelyn Fast (Author), 2005, Geschwisterbeziehungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39943