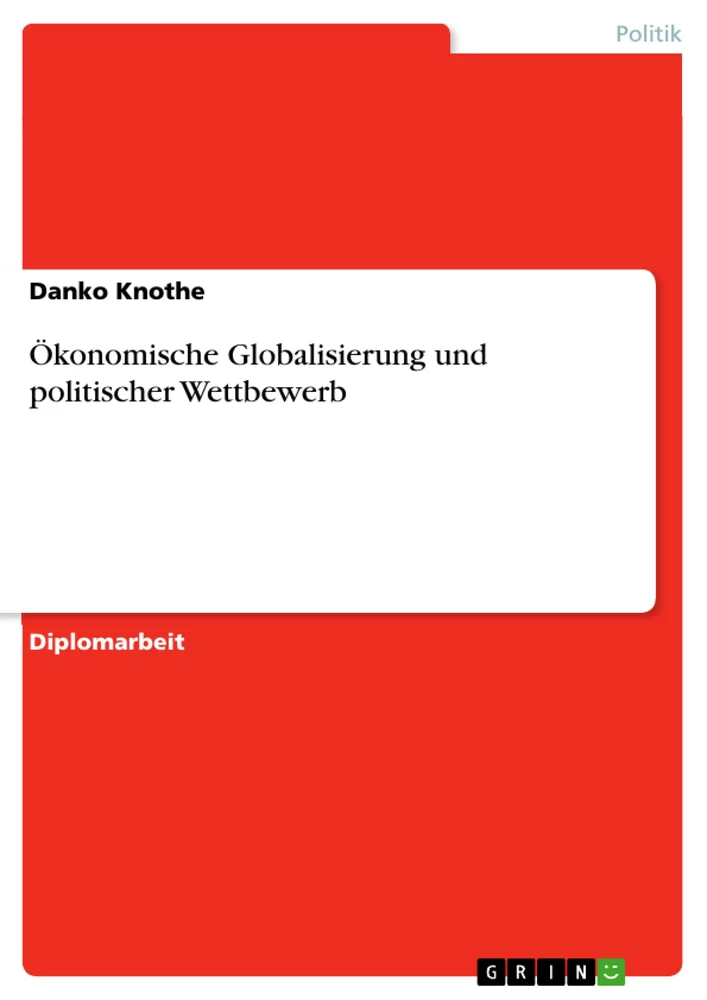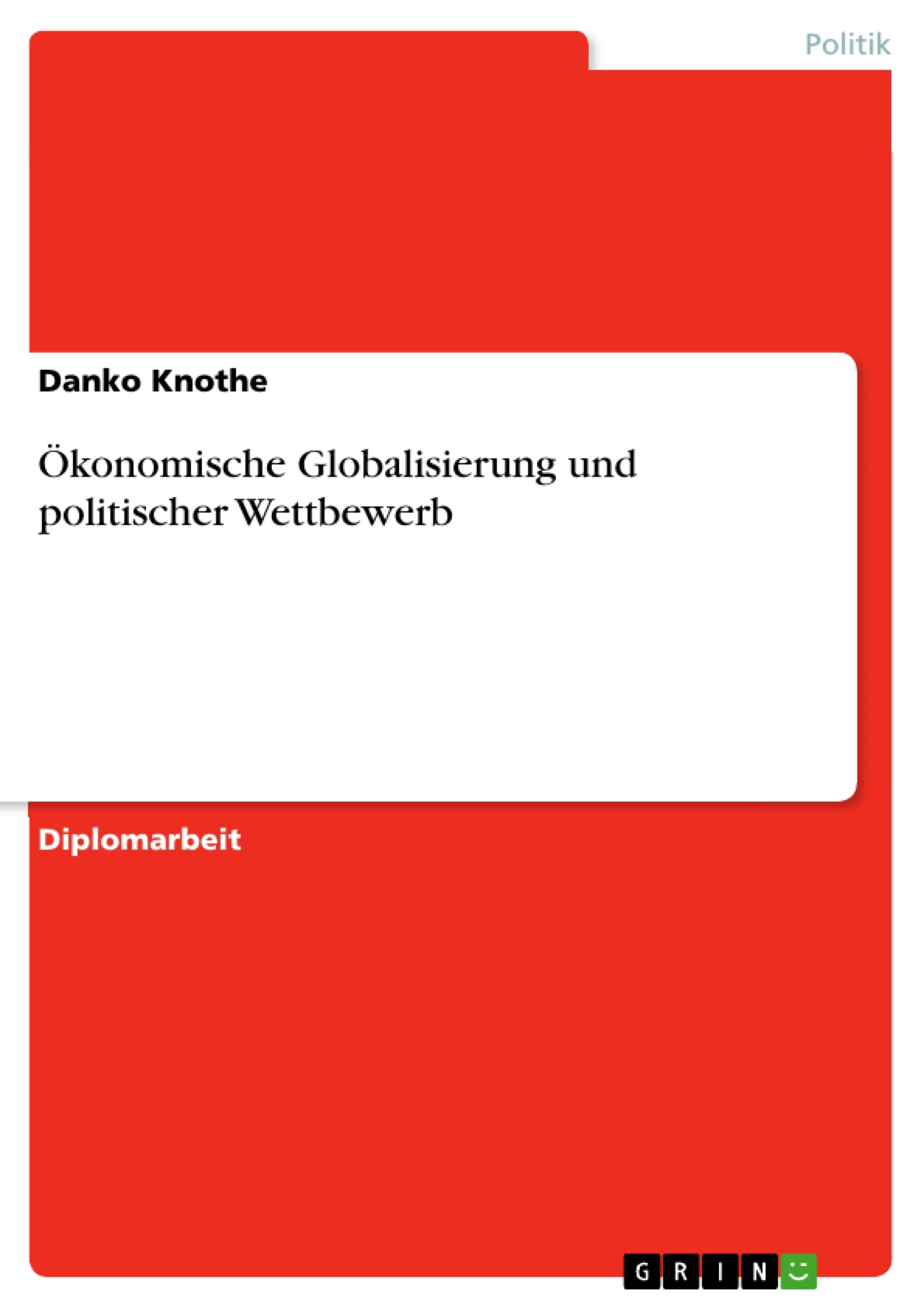Es ist ein gewaltiger Irrtum theoretischer Menschen, wenn sie glauben, ihr Platz sei an der Spitze und nicht im Nachtrab der großen Ereignisse. (...) Die wirkliche Geschichte fällt ihr Urteil nicht, indem sie den Theoretiker widerlegt, sondern indem sie ihn samt seiner Gedanken sich selbst überläßt. Oswald Spengler
Einleitung
„Die Wirtschaft ist unser Schicksal“: Am Beginn des 20. Jahrhunderts mochte dieses Diktum des Großindustriellen Walter Rathenau für viele seiner Zeitgenossen noch etwas übertrieben klingen. Zwar wurde ab Mitte des 19. Jahrhunderts - ermöglicht von massiven technologischen Umbrüchen (Eisenbahn, Telegraph) - durch intensiven Handel, massive Investitionen in aufstrebende Volkswirtschaften und einer sich verstärkenden Interdependenz der führenden Wirtschaftsräume zum ersten Mal in der Neuzeit eine wirkliche Weltwirtschaft in Umrissen kenntlich. Die Globalisierung der Arbeits- und Kapitalmärkte war zumindest in Nordamerika und Europa sowie dessen Kolonien Realität, starke Migrationsbewegungen und wiederkehrende Finanzkrisen sichtbarer Ausdruck dafür, und nicht zufällig hat Joseph Schumpeter damals im Auf und Ab der Konjukturzyklen, in rasantem technischen Fortschritt, in der „kreativen Zerstörung“ das eigentlich charakteristische Merkmal des Kapitalismus erkannt. Auf der anderen Seite aber haben damals nationalstaatliche Interessen, imperialistische Machtpolitik und Bündnislogik, die Konstanten der militärisch-politischen Welt also, durch Rüstungswettläufe, diplomatische Krisen und militärische Expeditionen die politischen Geschicke der Welt noch zu einem erheblichen Teil bestimmt. Die Politik, wie es Napoleon Bonaparte behauptet, und nicht die Wirtschaft entschied letztlich über das Schicksal der Menschen, das liberale Weltwirtschaftssystem zerbrach unter dem Eindruck des 1. Weltkriegs, der Russischen Revolution sowie der Weltwirtschaftskrise. Der Kalte Krieg schließlich hat die Welt nicht nur ideologisch, sondern auch physisch und ökonomisch gespalten. Am Beginn des 21. Jahrhundert scheint - spätestens nach der globalen Krise des internationalen Finanzsystems 1997/98, die jedem Beobachter die weltweite ökonomische Interdependenz offenbart haben sollte -, was für Rathenau und andere bereits damals eine unabwendbare Entwicklung darstellte, doch immer weniger zweifelhaft - aus mehreren Gründen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Globalisierungsdebatte - Positionen
- Die Debatte
- Positionen
- Globalisierung als neues, folgenreiches Phänomen
- Globalisierung - kein neues und kein folgenreiches Problem
- Globalisierung - eine Begriffsdefinition
- Dimensionen
- Ökonomische Globalisierung
- Produktion und Direktinvestitionen
- Handel
- Finanzmärkte
- Kulturelle Globalisierung
- Ideologische Globalisierung
- Definition des Begriffs
- Politische Folgen ökonomischer Globalisierung
- Neue Komplexität
- Governance-Probleme im Nationalstaat
- Einschränkungen makroökonomischer Steuerungsmacht
- Einschränkungen sozialpolitischer Distributionsmacht
- Regionalisierung
- Governance-Probleme im Internationalen System
- Wettbewerbsstaaten
- Notwendigkeit des Wettbewerbsstaates
- Gouvernementale Politik als Standortfaktor
- Wettbewerbsstaat und Wettbewerbsfähigkeit
- Makroökonomische Wettbewerbsfähigkeit
- Makroökonomische Wettbewerbsfähigkeit in der Triade
- Systemische Wettbewerbsfähigkeit
- Systemische Wettbewerbsfähigkeit in der Triade
- Wettbewerbsstaat und die Logik kollektiven Handelns
- Das Korporatismusmodell Japans
- Deutscher Sozialstaat
- Amerikas laissez faire
- Politischer Wettbewerb zwischen Wettbewerbstaaten
- Politischer Wettbewerb
- Wettbewerbspolitik in der Triade
- Japanischer Neomerkantilismus
- US-amerikanischer Nichtinterventionismus
- Deutschlands Unentschlossenheit, Europas Unvermögen
- Unilateralismus, Multilateralismus und die Uruguay-Runde des GATT
- USA: Aggressiver Unilateralismus
- Japans vermeintlicher Königsweg: Kontingente
- EU: Protektionismus als Strukturproblem
- WTO: Ende des Unilateralismus?
- Zur Erklärungskraft neorealistischer und institutionalistischer Theorien der Internationalen Beziehungen
- Die Debatte um die ökonomische Globalisierung und ihre Folgen
- Die verschiedenen Dimensionen der Globalisierung
- Politische Folgen der ökonomischen Globalisierung
- Der Wettbewerb zwischen den Wettbewerbsstaaten
- Der Einfluss von neorealistischen und institutionalistischen Theorien auf die Analyse des politischen Wettbewerbs
- Die Einleitung führt in die Thematik der ökonomischen Globalisierung und des politischen Wettbewerbs ein und skizziert den historischen Kontext der Entwicklungen.
- Das erste Kapitel beleuchtet die Debatte um die ökonomische Globalisierung und präsentiert verschiedene Positionen.
- Das zweite Kapitel widmet sich der Definition des Begriffs der Globalisierung und untersucht ihre verschiedenen Dimensionen, insbesondere die ökonomische, kulturelle und ideologische Globalisierung.
- Das dritte Kapitel analysiert die politischen Folgen der ökonomischen Globalisierung, insbesondere die Herausforderungen für die Governance im Nationalstaat und im internationalen System.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Konzept des Wettbewerbsstaates und untersucht die Notwendigkeit, die Regierungspolitik als Standortfaktor zu nutzen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Politik von Wettbewerbsstaaten in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen am Beispiel der Triade USA, Japan und Bundesrepublik Deutschland. Ziel ist es, den Einfluss der ökonomischen Globalisierung auf die Politik der drei Staaten und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Gestaltung der internationalen Wirtschaftsordnung zu analysieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Ökonomische Globalisierung, politische Wettbewerbsfähigkeit, Wettbewerbsstaat, Triade (USA, Japan, BRD), Neomerkantilismus, Nichtinterventionismus, Unilateralismus, Multilateralismus, GATT, WTO, Internationales System, Governance-Probleme, neorealistische Theorien, institutionalistische Theorien
Häufig gestellte Fragen
Welches Ziel verfolgt die Arbeit zum Thema Globalisierung?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der ökonomischen Globalisierung auf die Politik der „Triade“-Staaten (USA, Japan, Deutschland) und deren Wettbewerbsfähigkeit.
Was versteht man unter einem „Wettbewerbsstaat“?
Ein Wettbewerbsstaat nutzt Regierungspolitik gezielt als Standortfaktor, um die nationale Wirtschaft im globalen Wettbewerb zu stärken.
Welche Dimensionen der Globalisierung werden unterschieden?
Es wird zwischen ökonomischer (Handel, Finanzmärkte), kultureller und ideologischer Globalisierung unterschieden.
Welche Governance-Probleme entstehen durch die Globalisierung?
Der Nationalstaat verliert an makroökonomischer Steuerungsmacht und sozialpolitischer Distributionsmacht, was zu neuen Komplexitäten führt.
Was ist der Unterschied zwischen Unilateralismus und Multilateralismus?
Unilateralismus beschreibt das Alleingreifen eines Staates (z.B. USA), während Multilateralismus die Zusammenarbeit in Organisationen wie der WTO/GATT betont.
Wie unterscheiden sich die Modelle von USA, Japan und Deutschland?
Die Arbeit kontrastiert das amerikanische Laissez-faire, den japanischen Korporatismus/Neomerkantilismus und den deutschen Sozialstaat.
- Quote paper
- Danko Knothe (Author), 2000, Ökonomische Globalisierung und politischer Wettbewerb, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40