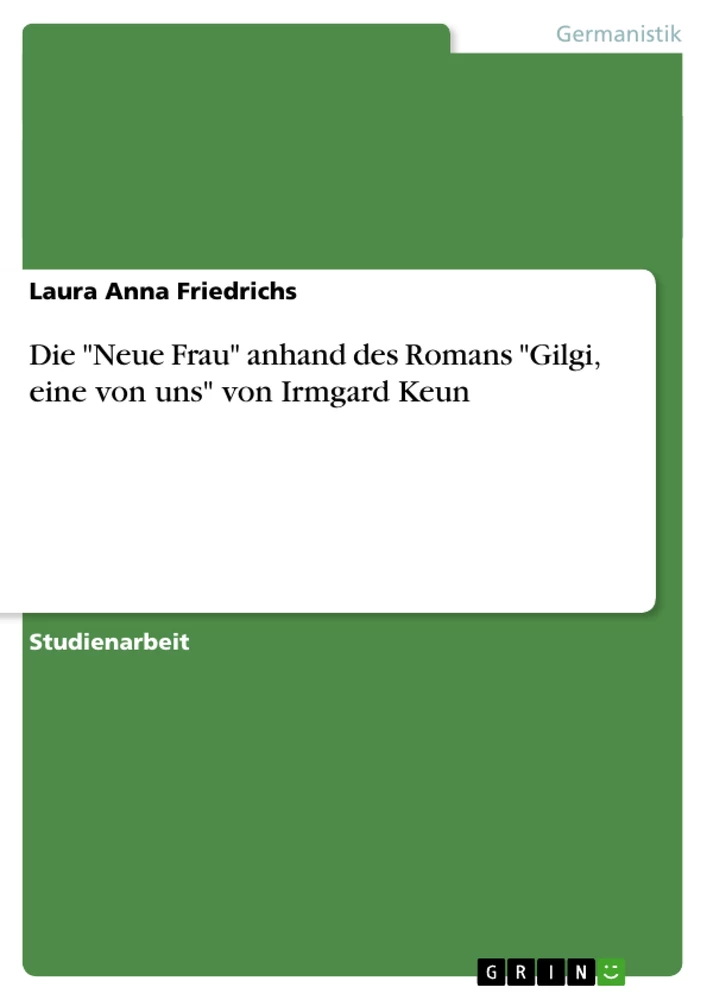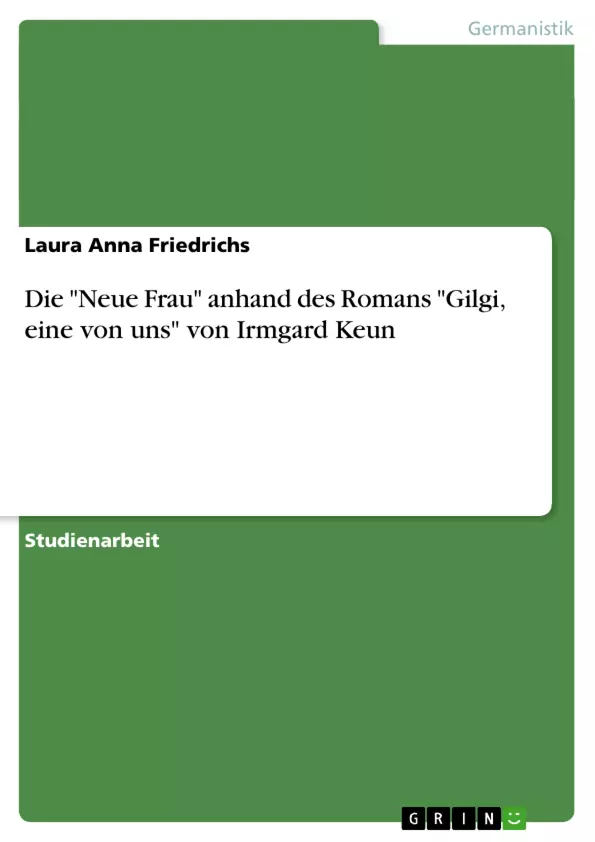„Wo wir aber auftauchten, kurzröckig, kurzhaarig und schlankbeinig, fuhren die Männer der älteren Generation zusammen und fragten: 'Was sind das für Geschöpfe?' Wir antworteten: 'Die neue Frau!'"
Diese selbstbewusste Aussage ist, wie Drescher hervorhebt, jedoch bereits als „Nachruf“ 2 zu verstehen; sie bezieht sich auf einen verhältnismäßig schmalen Zeitraum in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre, in dem ein auffälliger, auch öffentlich präsentierter Bewusstseinswandel eines Teils der jungen Frauengeneration deutlich wurde. Die Generation dieser um die Jahrhundertwende geborenen Frauen fand sich, im Gegensatz zu ihren Müttern, nicht mehr mit traditionellen Rollenzuweisungen ab, als Nur-Ehefrau und Mutter bei eingeschränkter Sexualität und unterdrücktem Begehren oder nur als ewiges Fräulein in beruflich zumeist untergeordneter Stellung und einer scheinbaren Selbstständigkeit. Die „neuen Frauen“ beanspruchten oder suchten zumindest Wege zur Eigenständigkeit ihrer Persönlichkeit (ohne Verzicht auf Mutterschaft); auf Weiblichkeit (ohne Kniefall vor bürgerlicher Doppelmoral) und auf berufliche Unabhängigkeit (ohne herablassende männliche Regie). Dieses Projekt war 1933 vorbei. Es wurde zerstört wie die Weimarer Republik selbst. Die neuen Machthaber propagierten ein neues, das alte, bürgerliche Frauenideal und setzten es durch.
Als Irmgard Keun (Jahrgang 1905) zwei Jahre vor diesem Einschnitt ihren ersten Roman „Gilgi, eine von uns“ veröffentlichte, befand sich die Republik in ihrer finalen Krise. Der Zusammenbruch der internationalen Finanzmärkte 1929 und das mit dem wirtschaftlichen Niedergang stärker werdende agitatorische Trommelfeuer von links und rechts hatten den zwischen 1924 und 1929 aufkommenden Fortschrittsoptimismus und den Glauben an individuellen Erfolg schrumpfen lassen. 3 In dieser Stabilisierungsphase (1924 – 1929) hatten sich literarisch, künstlerisch, architektonisch und politisch Formen durchgesetzt, in denen auch und besonders weibliche Autoren zur Geltung kamen. Ihre zumeist nach 1929 veröffentlichten Arbeiten sind jedenfalls noch „thematisch und stilistisch in den Trends der Stabilisierungsphase... verankert…“. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- Romangeschehen Spannungsaufbau
- Hauptmotive und Figuren
- Stilistik
- III. Schluss
- IV. Literaturverzeichnis
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Irmgard Keuns Roman „Gilgi, eine von uns“ im Kontext der „Neuen Sachlichkeit“ und der „Neuen Frau“ in der Weimarer Republik. Sie analysiert den Roman hinsichtlich seiner Handlung, seiner zentralen Motive und Figuren sowie seiner stilistischen Besonderheiten. Die Arbeit beleuchtet außerdem die gesellschaftlichen und kulturellen Strömungen, die Keuns Werk prägten.
- Die Rolle der Frau in der Gesellschaft der Weimarer Republik
- Das Bild der „Neuen Frau“ und ihre Emanzipation
- Die Darstellung von Liebe, Sexualität und Partnerschaft in der Zeit der „Neuen Sachlichkeit“
- Die Herausforderungen und Konflikte, denen Frauen in der Weimarer Republik gegenüberstanden
- Die stilistischen Merkmale der „Neuen Sachlichkeit“ in Keuns Roman.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung des Romans führt die Protagonistin Gilgi als eine selbstbewusste und unabhängige junge Frau ein, die sich von traditionellen Rollenbildern nicht beirren lässt. Sie repräsentiert den Typus der „Neuen Frau“ der Weimarer Republik, die sich nach Autonomie und Selbstverwirklichung sehnt. In den folgenden Kapiteln wird Gilgis Lebensweg verfolgt, der von zahlreichen Herausforderungen und Konflikten geprägt ist. Sie begegnet der Liebe, die sie gleichzeitig anzieht und beängstigt, und kämpft mit den Erwartungen der Gesellschaft, die ihren Anspruch auf Selbstbestimmung immer wieder infrage stellen. Der Roman erforscht die komplexen Beziehungen zwischen der Frau und dem Mann, der Liebe und der Unabhängigkeit, der Sehnsucht nach Glück und der Notwendigkeit, sich in einer oft feindlichen Welt zu behaupten. Die Analyse des Romans konzentriert sich auf diese zentralen Themen und untersucht, wie sie in der Sprache und der Struktur des Werks zum Ausdruck kommen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der „Neuen Sachlichkeit“, wie der Industrialisierung, der Urbanisierung und den sozialen Veränderungen der Weimarer Republik. Sie analysiert die Darstellung der „Neuen Frau“ in Irmgard Keuns Roman „Gilgi, eine von uns“, wobei Themen wie weibliche Identität, Berufsleben, Liebe, Sexualität, gesellschaftliche Erwartungen und die Suche nach Autonomie im Vordergrund stehen. Die Analyse berücksichtigt die stilistischen Merkmale der „Neuen Sachlichkeit“, wie Sachlichkeit, Nüchternheit, Realismus und die Betonung der Sprache des Alltags.
- Arbeit zitieren
- Laura Anna Friedrichs (Autor:in), 2004, Die "Neue Frau" anhand des Romans "Gilgi, eine von uns" von Irmgard Keun, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40001