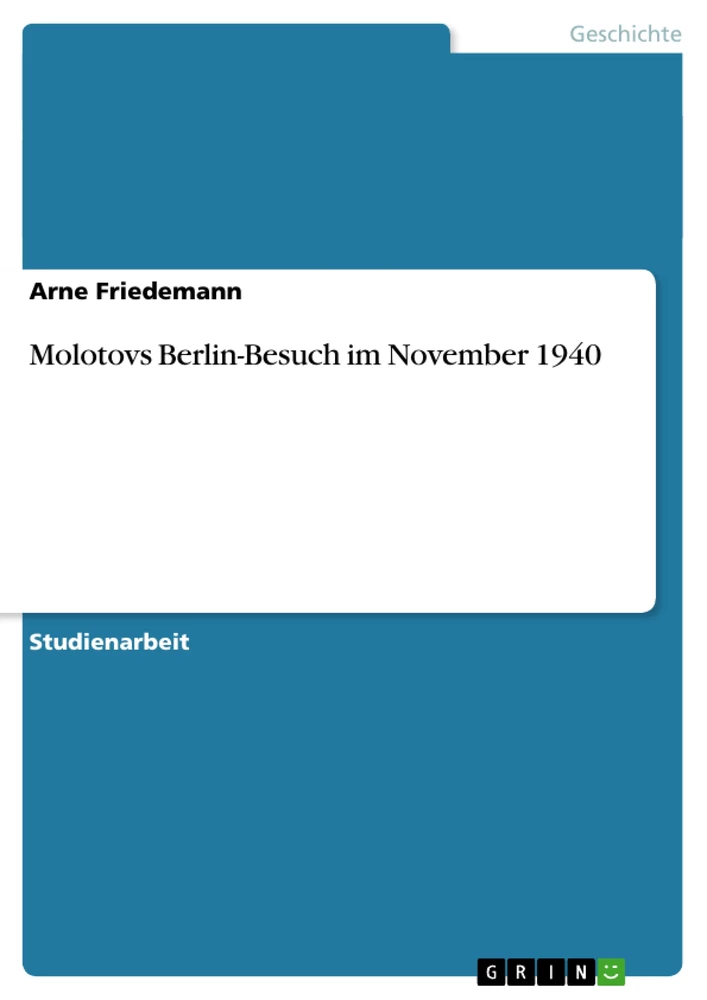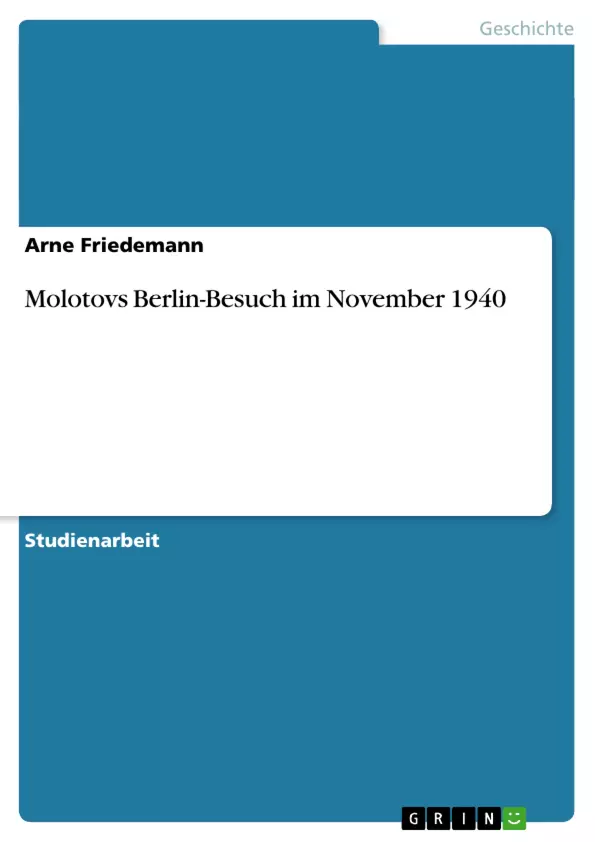Die Geschichte der deutsch-sowjetischen Beziehungen zwischen 1917 und 1941 ist eine Geschichte extremer Wechselfälle. Sie beginnt mit zwei Revolutionen: Zuerst beendete die russische Revolution von 1917 die Herrschaft des russischen Zaren. Nur ein Jahr später, im November 1918, wurde auch der deutsche Kaiser zur Abdankung gezwungen. Doch die Staaten, die aus diesen beiden Revolutionen hervorgegangen waren, unterschieden sich grundsätzlich. Denn obschon man in Deutschland den Kaiser gestürzt hatte, waren die bisher herrschenden Klassen dort an der Macht geblieben. Ganz anders in Russland: Nicht nur, dass die Oktoberrevolution die alten Eliten entmachtet und vertrieben (teilweise sogar ermordet) hatte; darüber hinaus verfolgten die nunmehr herrschenden Bolschewiki das Ziel, eine kommunistische Wirtschaftsweise einzuführen und die Revolution auch in andere Länder zu tragen. Gerade dieser messianistische Ansatz war der Grund, weshalb die in Deutschland regierenden Politiker den russischen "Umstürzlern" zunächst mit großem Misstrauen gegenüberstanden. Dass es dennoch zu einer langsamen Annäherung kam, war in erster Linie der 1919 entstanden Ordnung von Versailles zu verdanken. Denn durch Versailles wurden sowohl Deutschland als auch Russland im internationalen System isoliert – Deutschland wegen des verlorenen Angriffskrieges, Russland wegen der antikapitalistischen und nach Weltrevolution strebenden Grundhaltung seiner Regierung.
Mit dem 1922 geschlossenen Vertrag von Rapallo gaben die beiden Staaten dieser Annäherung eine äußere Form. Rapallo markierte den Beginn einer engen Zusammenarbeit auf vielen Gebieten, nicht zuletzt denen der Wirtschaft und des Militärs. Diese Zusammenarbeit schien beendet, als 1933 mit der NSDAP erklärte Feinde des Bolschewismus die Macht in Deutschland übernahmen. Doch trotz großer Propagandaschlachten wurden zumindest die ökonomischen Beziehungen auch während der dreißiger Jahre aufrechterhalten.
Den großen Umschwung brachte dann das Jahr 1939 mit dem Abschluss des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts. Durch diesen Pakt gab die
Sowjetunion Hitler freie Hand für den deutschen Angriff auf Polen; des Weiteren teilten Deutschland und die Sowjetunion in einem "Geheimen Zusatzprotokoll" Ost- und Südosteuropa unter sich auf. Auch die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen erlebten im Gefolge des Hitler-Stalin-Pakts eine nie gekannte Blüte. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Polenfeldzug und Vertiefung der bilateralen Beziehungen
- Das Kriegsjahr 1940 – Jahr der Expansion
- Hitler erringt die Vorherrschaft in Europa
- Die Expansionspolitik Stalins – Ausdruck einer Defensiv-Strategie?
- Risse im deutsch-sowjetischen Verhältnis
- Molotovs Berlin-Besuch
- Zur Person Vjaceslav Molotovs (1890-1986)
- Vorbereitende Direktiven
- Die Berliner Gespräche (12.-14. November 1940)
- Auftakt der erste Tag
- Die Gespräche scheitern
- Der sowjetische Vorschlag vom 25. November 1940
- Die Bedeutung der Berliner Verhandlungen
- Hitlers Entschluss zum Angriff auf die Sowjetunion
- Die Konsequenzen für die Berliner Gespräche
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Berlin-Besuch Vjaceslav Molotovs im November 1940 und seine Bedeutung im Kontext der deutsch-sowjetischen Beziehungen zwischen 1917 und 1941. Sie analysiert die Vorgeschichte des Besuchs, die Verhandlungspositionen beider Seiten, den Verlauf der Gespräche und deren Auswirkungen auf die weitere Entwicklung bis zum deutschen Angriff auf die Sowjetunion. Die Arbeit nutzt neu zugängliche sowjetische Quellen, um ein umfassenderes Bild zu zeichnen.
- Entwicklung der deutsch-sowjetischen Beziehungen nach dem Nichtangriffspakt
- Analyse der Gründe für die Abkühlung der Beziehungen zwischen Berlin und Moskau
- Verhandlungspositionen und Verlauf der Berliner Gespräche
- Auswirkungen des Scheiterns der Gespräche auf den weiteren Verlauf
- Bewertung der Quellenlage und unterschiedlicher Interpretationen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die wechselvolle Geschichte der deutsch-sowjetischen Beziehungen von 1917 bis 1941, beginnend mit den Revolutionen in Russland und Deutschland. Sie beschreibt die unterschiedlichen Systeme und die anfängliche Misstrauen, die sich später durch die Isolation beider Staaten nach Versailles in eine Annäherung, besonders sichtbar im Vertrag von Rapallo, wandelte. Trotz des Machtwechsels in Deutschland 1933 blieben ökonomische Beziehungen bestehen, bis der Nichtangriffspakt von 1939 einen Höhepunkt der Zusammenarbeit markierte. Die Einleitung führt in die Thematik ein und erklärt den Kontext, in dem Molotovs Berlin-Besuch stattfand, mit einem Fokus auf der zunehmenden Abkühlung der Beziehungen. Die Einleitung betont auch die veränderte Quellenlage durch die Öffnung sowjetischer Archive und diskutiert wichtige Quellen für die Arbeit.
Polenfeldzug und Vertiefung der bilateralen Beziehungen: Dieses Kapitel untersucht die Folgen des Polenfeldzugs für die deutsch-sowjetischen Beziehungen. Es analysiert, wie der gemeinsame militärische Erfolg die Zusammenarbeit und die bilateralen Beziehungen weiter intensivierte. Der Fokus liegt auf den konkreten Auswirkungen des Feldzugs auf die politische und wirtschaftliche Kooperation beider Länder. Die Analyse beleuchtet die konkreten Absprachen und ihre Umsetzung, sowie die ersten Anzeichen von Spannungen, die im weiteren Verlauf der Beziehungen entscheidend werden.
Das Kriegsjahr 1940 – Jahr der Expansion: Dieses Kapitel beschreibt Hitlers Eroberungszüge in Europa 1940 und die gleichzeitig stattfindende Expansionspolitik Stalins. Es analysiert Hitlers zunehmende Vorherrschaft und untersucht, inwiefern Stalins Expansionsbestrebungen als defensive Strategie interpretiert werden können. Der Vergleich der Expansionsstrategien beider Diktaturen bildet den zentralen Aspekt, wobei sowohl die politischen als auch militärischen Dimensionen berücksichtigt werden. Konkrete Beispiele und Fallstudien verdeutlichen die sich verstärkenden Interessenkonflikte zwischen beiden Mächten, die den Weg zum Konflikt ebneten.
Risse im deutsch-sowjetischen Verhältnis: Das Kapitel analysiert die wachsenden Spannungen im deutsch-sowjetischen Verhältnis ab Mitte 1940. Es untersucht detailliert die sich verschärfenden Interessenkonflikte im Baltikum und Südosteuropa, sowie die Auswirkungen des Dreimächtepakts auf Moskaus Einschätzung der deutschen Politik. Der Fokus liegt auf der sich verändernden politischen Dynamik und der zunehmenden Besorgnis Moskaus über Hitlers wahre Absichten. Das Kapitel bereitet den Boden für die Analyse von Molotovs Besuch in Berlin, indem es die vorherrschende Unsicherheit und das Misstrauen zwischen den beiden Staaten deutlich macht.
Molotovs Berlin-Besuch: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Besuch Molotovs in Berlin im November 1940. Es beleuchtet die Person Molotovs, die vorbereitenden Direktiven und den genauen Verlauf der Gespräche. Die Analyse konzentriert sich auf die unterschiedlichen Ziele und Verhandlungspositionen beider Seiten und untersucht, warum die Gespräche letztendlich scheiterten. Der Fokus liegt auf der detaillierten Rekonstruktion des Geschehens und der Interpretation der beteiligten Akteure und ihrer Motive.
Die Bedeutung der Berliner Verhandlungen: Dieses Kapitel behandelt die Folgen des gescheiterten Molotow-Besuchs. Es analysiert Hitlers Entscheidung zum Angriff auf die Sowjetunion und die Auswirkungen des Scheiterns der Verhandlungen auf die weitere Entwicklung der Beziehungen bis Juni 1941. Die Analyse fokussiert sich auf die kausalen Zusammenhänge zwischen dem Scheitern der Verhandlungen und dem sich nähernden Krieg, wobei verschiedene Perspektiven und Interpretationen berücksichtigt werden. Das Kapitel beleuchtet die sich steigernde Kriegsgefahr und die zunehmenden Provokationen auf beiden Seiten.
Schlüsselwörter
Deutsch-sowjetische Beziehungen, Hitler-Stalin-Pakt, Molotow-Ribbentrop-Pakt, Vjaceslav Molotov, Berlin-Besuch 1940, Expansionspolitik, Interessenkonflikt, Nichtangriffspakt, Zweiter Weltkrieg, Sowjetunion, Nationalsozialismus, Quellenlage, Archive.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Deutsch-Sowjetische Beziehungen 1940 – Der gescheiterte Molotow-Besuch
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über den Besuch Vjaceslav Molotovs in Berlin im November 1940 und dessen Bedeutung im Kontext der deutsch-sowjetischen Beziehungen zwischen 1917 und 1941. Es analysiert die Vorgeschichte des Besuchs, die Verhandlungspositionen beider Seiten, den Verlauf der Gespräche und deren Auswirkungen auf den weiteren Verlauf bis zum deutschen Angriff auf die Sowjetunion.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Entwicklung der deutsch-sowjetischen Beziehungen nach dem Nichtangriffspakt, die Gründe für die Abkühlung der Beziehungen, die Verhandlungspositionen und den Verlauf der Berliner Gespräche, die Auswirkungen des Scheiterns der Gespräche und eine Bewertung der Quellenlage und unterschiedlicher Interpretationen. Es umfasst auch eine detaillierte Analyse des Polenfeldzugs, der Expansionspolitik Hitlers und Stalins im Jahr 1940, und die wachsenden Spannungen im deutsch-sowjetischen Verhältnis vor Molotovs Besuch.
Welche Quellen wurden verwendet?
Das Dokument nutzt neu zugängliche sowjetische Quellen, um ein umfassenderes Bild der deutsch-sowjetischen Beziehungen zu zeichnen. Die Einleitung diskutiert die wichtige Rolle der geöffneten sowjetischen Archive und wichtige Quellen für die Arbeit.
Wer war Vjaceslav Molotow?
Das Dokument enthält einen Abschnitt über die Person Vjaceslav Molotows (1890-1986), der den historischen Kontext seiner Rolle in den deutsch-sowjetischen Verhandlungen verdeutlicht.
Wie verliefen die Berliner Gespräche?
Das Dokument beschreibt detailliert den Ablauf der Berliner Gespräche (12.-14. November 1940), einschließlich der vorbereitenden Direktiven und der unterschiedlichen Ziele und Verhandlungspositionen beider Seiten. Es analysiert auch, warum die Gespräche letztendlich scheiterten.
Welche Bedeutung hatten die Berliner Verhandlungen?
Das Dokument analysiert die Folgen des gescheiterten Molotow-Besuchs, insbesondere Hitlers Entscheidung zum Angriff auf die Sowjetunion und die kausalen Zusammenhänge zwischen dem Scheitern der Verhandlungen und dem beginnenden Krieg. Verschiedene Perspektiven und Interpretationen werden berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Dokument?
Schlüsselwörter sind: Deutsch-sowjetische Beziehungen, Hitler-Stalin-Pakt, Molotow-Ribbentrop-Pakt, Vjaceslav Molotov, Berlin-Besuch 1940, Expansionspolitik, Interessenkonflikt, Nichtangriffspakt, Zweiter Weltkrieg, Sowjetunion, Nationalsozialismus, Quellenlage, Archive.
Welche Kapitel enthält das Dokument?
Das Dokument ist in Kapitel unterteilt, die sich mit der Einleitung, dem Polenfeldzug, dem Kriegsjahr 1940 (mit Fokus auf Hitlers und Stalins Expansionspolitik), den Rissen im deutsch-sowjetischen Verhältnis, Molotows Berlin-Besuch und der Bedeutung der Berliner Verhandlungen befassen. Jedes Kapitel wird im Dokument zusammengefasst.
Für wen ist dieses Dokument bestimmt?
Das Dokument ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse der deutsch-sowjetischen Beziehungen im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs. Es eignet sich für Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich für diese historische Periode interessieren.
- Citation du texte
- Arne Friedemann (Auteur), 1998, Molotovs Berlin-Besuch im November 1940, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40043