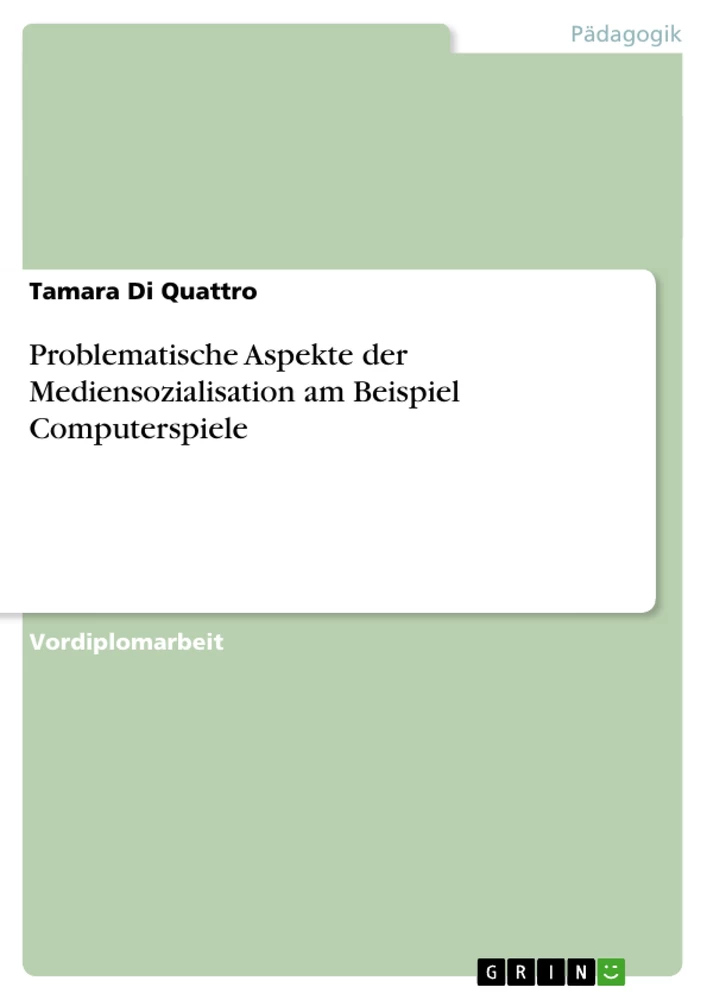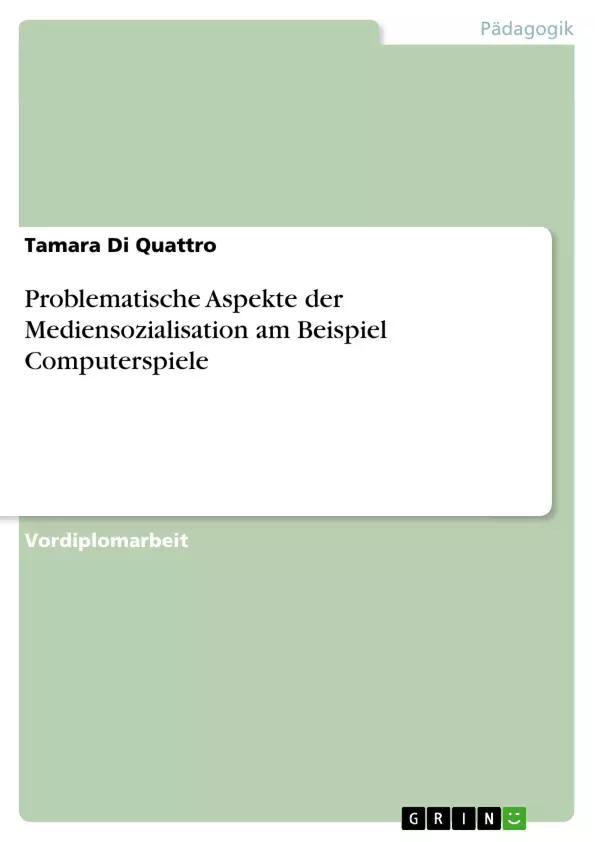Die Medien stellen mittlerweile eine bedeutende Sozialisationsinstanz dar. Oftmals ist die Rede von den Medien als „heimliche Miterzieher“. Heranwachsende werden heute überflutet von Medien und geraten schon früh in Kontakt mit ihnen. Gerade die auf der Grundlage der Computertechnik mögliche Gestaltung und Verbreitung von Medien hat zu einer enormen Änderung des Angebotes und der Nutzung geführt.
Das Medium der Computerspiele hat sich bereits seit vielen Jahren als attraktive Freizeitbeschäftigung fest in den Alltag von Kindern und Jugendlichen etabliert. Dies hat einen bewahrpädagogischen Reflex ausgelöst, wobei besonders Gewaltdarstellungen einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben. Erwachsene beschäftigt die Frage, ob das Computerspiel eine sinnvolle Art der Freizeitgestaltung darstellt und ob negative Auswirkungen die Folge sein könnten.
Darüber hinaus stellt der Umgang mit dem Medium ein weiteres Problemfeld dar. Viele Nutzer haben sich angeeignet, Programme zu „cracken“ (Kopierschutz „knacken“) und zu (raub-)kopieren, wodurch zusätzlich der Besitz und die Nutzung von sowohl Computer- und Videospielen, die nicht ihrer Altersklasse entsprechen als auch von indizierten Spielen bewerkstelligt werden. Das Instrument der Indizierung liefert keine Garantie dafür, dass Spiele mit ungeeigneten Inhalten auch tatsächlich nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.
Mit dem Medium der Computerspiele steht die Pädagogik vor neuen Forderungen. Wie kann sie diese erfüllen? Die Pädagogik muss in veränderter Form Arbeit leisten. Mit der Einführung des Mediums der Computerspiele hat sich das Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen verändert. Das Medium gehört zum Alltag des Heranwachsenden dazu und wird genutzt. Pädagogik muss nun „umdenken“. Sie sollte aus dem Medium das „herausholen“, was aus ihrer Sicht wertvoll erscheint und weiterhin speziell auf die damit verbundenen möglichen Problemfelder bezüglich der Nutzung von ungeeigneten Spielen zu einer positiven Veränderung des Bewusstseins der jüngeren Generation verhelfen, damit Heranwachsende die Chance erhalten, einen vernünftigen Umgang mit diesem Medium zu erlernen. Dafür ist es notwendig, dass die Pädagogik sich den Forderungen, die dieses Medium mit sich bringt, stellt. Auf diese Notwendigkeit soll mit dieser Arbeit aufmerksam gemacht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Aufbau
- Zur Einführung in das Thema der Computerspiele
- Zur Entstehungsgeschichte von Bildschirmspielen
- Verschiedene Formen der Hardware
- Betrachtung der Spielinhalte – Klassifizierung der Software
- Merkmale von Bildschirmspielen
- Probleme in bezug auf Computerspiele
- Bewahrpädagogische Befürchtungen - (Vor-)Urteile über Computerspiele?
- Anspannung und Streẞ
- Erlebnis- und Erfahrungsverlust
- „Computersucht“
- Isolation / Kontaktarmut
- Gewaltdarstellung in Computerspielen
- Prägen Computerspiele die Persönlichkeit?
- Vier theoretische Richtungen
- Die Konzeption der Aggression als Motivsystem
- Gewaltspiele – das bevorzugte Genre?
- Zur Faszination
- Das motivationspsychologische Grundmodell
- Der Zusammenhang zwischen Lebenskontext und Bevorzugung eines Spiels
- Faszination Gewalt
- Zum Umgang der Gesellschaft mit problematischen Spielen
- Spiele auf dem Index
- Gesetzliche Regelungen
- Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften
- Indizierte Spiele – Krieg, Gewalt und Pornographie
- Indizierung als Lösung?
- Forderungen an die Pädagogik
- Zu den problematischen Aspekten der Computerspiele
- Zur Bewahrpädagogik
- Mediensozialisatorische Anzätze
- Der Gewaltaspekt
- Zum Problem der Indizierung
- Welche Möglichkeiten bietet das Medium für die Pädagogik?
- Möglichkeiten des Umgangs im schulischen Bereich
- Pädagogische Arbeit mit dem Medium in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit
- Abschließende Bemerkung
- Bewahrpädagogische Befürchtungen in Bezug auf Computerspiele
- Die Auswirkungen von Gewaltdarstellung in Computerspielen
- Der Umgang der Gesellschaft mit problematischen Computerspielen
- Die Rolle der Pädagogik im Umgang mit Computerspielen
- Potentiale von Computerspielen für pädagogische Zwecke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die problematischen Aspekte der Mediensozialisation am Beispiel von Computerspielen. Das Hauptaugenmerk liegt auf den bewahrpädagogischen Befürchtungen, der Gewaltdarstellung in Computerspielen und dem Umgang der Gesellschaft mit problematischen Spielen. Die Arbeit analysiert, welche Herausforderungen sich aus diesen Problemen für die Pädagogik ergeben und welche Möglichkeiten das Medium Computerspiel für pädagogische Zwecke bietet.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 bietet eine Einführung in die Entstehungsgeschichte von Bildschirmspielen, die Entwicklung der Hardware und die Vielfalt der Spielinhalte.
Kapitel 3 beleuchtet die problematischen Aspekte von Computerspielen. Hierbei werden bewahrpädagogische Befürchtungen hinsichtlich Anspannung, Erlebnisverlust und „Computersucht“ diskutiert. Weiterhin wird die Gewaltdarstellung in Computerspielen und deren mögliche Auswirkungen auf die Persönlichkeit untersucht. Das Kapitel analysiert auch die Faszinationskraft von Gewaltspielen und den Umgang der Gesellschaft mit problematischen Spielen, insbesondere die Indizierung als Instrument zur Schutz der Heranwachsenden.
Kapitel 4 diskutiert die Herausforderungen, die sich aus den problematischen Aspekten von Computerspielen für die Pädagogik ergeben. Es werden Ansätze der Bewahrpädagogik, die Problematik der Gewaltdarstellung und die Kritik an der Indizierung beleuchtet. Im Gegenteil werden auch die Möglichkeiten von Computerspielen für pädagogische Zwecke im schulischen und außerschulischen Bereich aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Computerspiele, Mediensozialisation, Bewahrpädagogik, Gewaltdarstellung, Indizierung, Pädagogik, Jugendmedienschutz, Freizeitgestaltung, Computersucht, Faszination, Motivation, Lebenskontext.
- Arbeit zitieren
- Tamara Di Quattro (Autor:in), 1999, Problematische Aspekte der Mediensozialisation am Beispiel Computerspiele, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40054