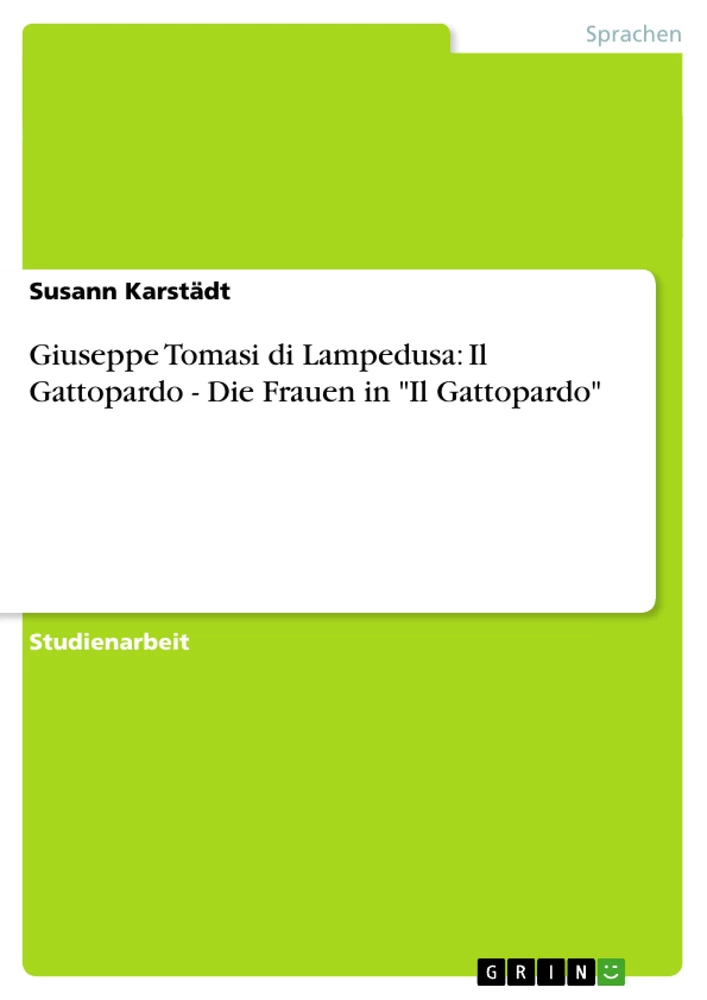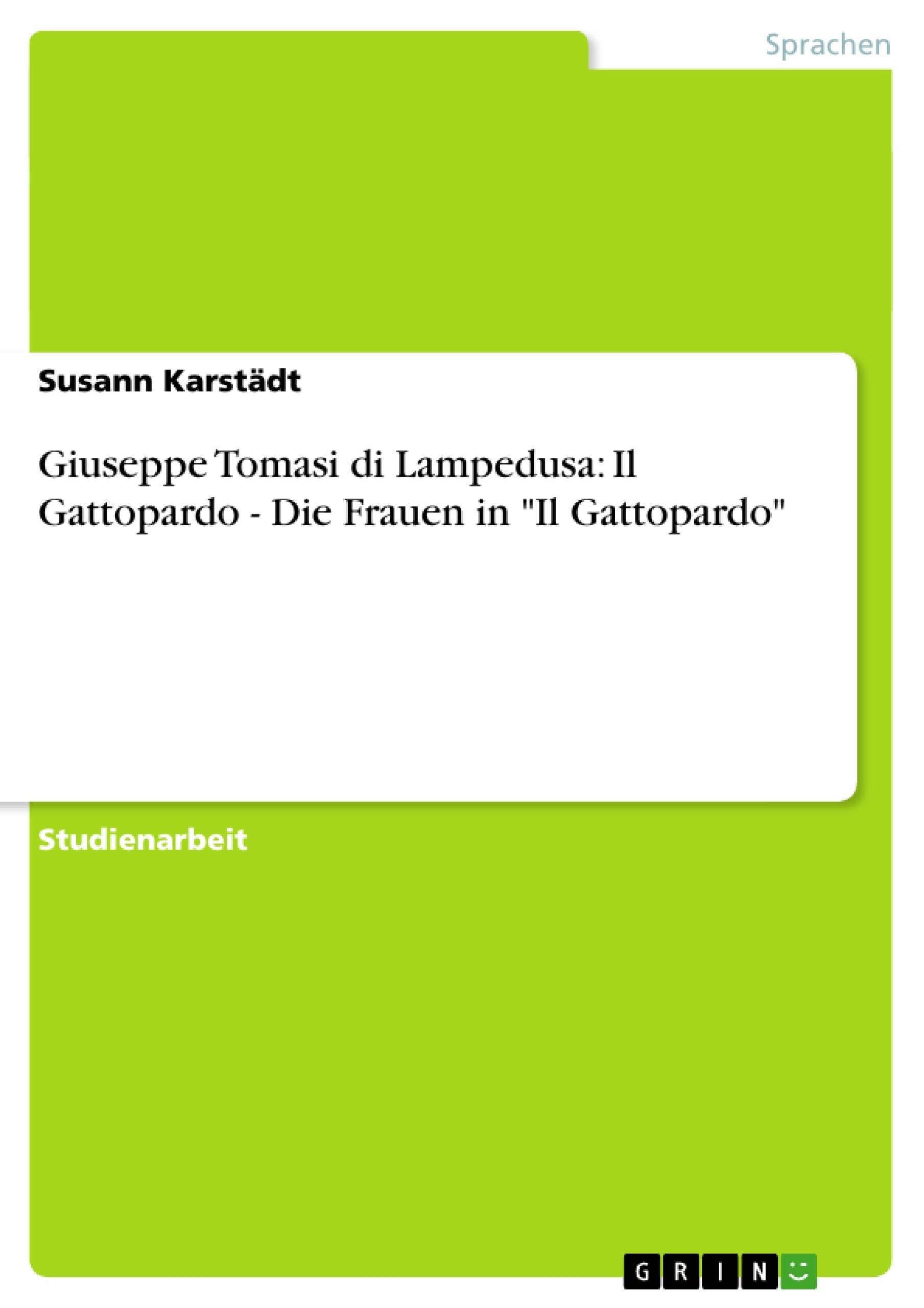In einem Roman, der zu einer Zeit spielt, in der die Gesellschaft durch die Männer geprägt wird, liegt die Vermutung nahe, dass der Autor sich bei seinen Beschreibungen auch hauptsächlich auf die Männer konzentriert. Wenn der Autor des Romans versucht, die Lebensverhältnisse im Italien des 19. Jahrhunderts wiederzuspiegeln und dann auch noch aus dem Blickwinkel der sozialen Schicht, der er selbst entstammt, zeigt das vor allem wie ausführlich er sich mit der Gesellschaft, all ihren sozialen Klassen und ihrem Miteinander auseinander gesetzt hat. Giuseppe Tomasi di Lampedusa ist es geglückt, mit seinem Roman „Il Gattopardo“ einen sozial kritischen Roman zu schreiben, der sich nicht nur mit den Männern beschäftigt, sondern sich auch mit dem Schicksal der Frauen zu der damaligen Zeit auseinander setzt. Ich werde zunächst die Frauen, wie sie in „Il Gattopardo“ beschrieben werden, im Allgemeinen charakterisieren. Anschließend werde ich versuchen, den Kontrast zwischen Angelica und Concetta und dem, was diese beiden Frauen verkörpern sollen, herauszuarbeiten. Danach werde ich auf die Mütter der beiden, Maria Stella und Donna Bastiana, genauer eingehen, um ihre Stellung in der sizilianischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts zu diskutieren. Anschließend werde ich auch die Frauenfiguren im Umfeld Pater Pirrones bearbeiten. Ziel meiner Hausarbeit ist es, die hier dargestellten Schicksale einzelner Frauen mit Blick auf ihre unterschiedliche soziale und gesellschaftliche Position zu untersuchen und ansatzweise darzustellen, in wie fern Giuseppe Tomasi di Lampedusa hier eigene Ansichten und Meinungen mit einfließen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemein
- Angelica
- Concetta
- Maria Stella
- Donna Bastiana
- Die Familie des Paters Pirrone
- Der Tod als Frau
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Darstellung von Frauen in Giuseppe Tomasi di Lampedusas Roman „Il Gattopardo“ und analysiert ihre unterschiedlichen Rollen und Schicksale in der sizilianischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Die Arbeit untersucht die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten, die Frauen in dieser Zeit und in verschiedenen sozialen Schichten erlebten.
- Die Rolle der Frauen in der sizilianischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts
- Der Kontrast zwischen Angelica und Concetta als Repräsentantinnen unterschiedlicher Frauentypen
- Die Stellung der Mütter Maria Stella und Donna Bastiana in der Gesellschaft
- Die Darstellung von Frauen im Umfeld von Pater Pirrone
- Die Einbindung von Lampedusas eigenen Ansichten und Meinungen in die Darstellung der Frauenfiguren
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Frauenrollen im Kontext des Romans „Il Gattopardo“ ein und skizziert den Fokus der Hausarbeit.
- Allgemein: Dieses Kapitel beleuchtet die allgemeine Situation der Frauen im Italien des 19. Jahrhunderts und beschreibt ihre Unterwürfigkeit gegenüber Männern, die von Lampedusa in „Il Gattopardo“ deutlich dargestellt wird. Es wird außerdem auf die Verwendung der Eva-Maria-Konstellation im Roman eingegangen, die als ein bestimmtes Konzept der weiblichen Rollenverteilung im Mittelmeerraum gilt.
- Angelica: Dieses Kapitel analysiert die Figur der Angelica, die im Roman die sinnliche und verführerische, aber auch jungfräuliche Seite einer jungen Frau verkörpert. Es wird ihre soziale Position und ihr Streben nach gesellschaftlichem Aufstieg durch Heirat in den Adel beleuchtet.
- Concetta: Das Kapitel widmet sich der Figur der Concetta, die im Gegensatz zu Angelica die Maria-Figur verkörpert und durch ihre traditionelle Erziehung und strenge Religiosität charakterisiert wird.
- Maria Stella: Dieses Kapitel untersucht die Rolle von Maria Stella, der Mutter von Concetta, in der sizilianischen Gesellschaft und beleuchtet ihre spezifische Stellung innerhalb der Familie und der Gesellschaft.
- Donna Bastiana: Das Kapitel beleuchtet Donna Bastiana, die Mutter von Angelica, und diskutiert ihre soziale Rolle in der Gesellschaft.
- Die Familie des Paters Pirrone: Dieses Kapitel befasst sich mit den Frauenfiguren im Umfeld von Pater Pirrone und untersucht ihre Positionen innerhalb der Familie und der Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Themen der Frauenrollen, sozialer und gesellschaftlicher Positionierung, sowie der Darstellung von Tradition und Wandel in Giuseppe Tomasi di Lampedusas Roman „Il Gattopardo“. Schlüsselbegriffe sind: Eva-Maria-Konstellation, gesellschaftlicher Aufstieg, Tradition, Unterdrückung, Adel, Familie, Religion, Sizilien, 19. Jahrhundert, Italien.
Häufig gestellte Fragen
Welche Frauenrollen werden in „Il Gattopardo“ thematisiert?
Der Roman beleuchtet die Stellung der Frau in der sizilianischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, geprägt von Unterwürfigkeit gegenüber Männern und sozialen Klassenunterschieden.
Was ist der Unterschied zwischen den Figuren Angelica und Concetta?
Angelica verkörpert die sinnliche, aufstrebende Frau, die durch Heirat den sozialen Aufstieg sucht, während Concetta die traditionelle, streng religiöse und zurückhaltende Adlige repräsentiert.
Was bedeutet die „Eva-Maria-Konstellation“ im Roman?
Dies ist ein Konzept der weiblichen Rollenverteilung im Mittelmeerraum, das Frauen oft entweder als verführerische Eva (Angelica) oder als tugendhafte Maria (Concetta) kategorisiert.
Wie werden die Mütter Maria Stella und Donna Bastiana dargestellt?
Die Arbeit untersucht ihre spezifische Stellung innerhalb der Familie und der Gesellschaft sowie den Einfluss ihrer sozialen Herkunft auf ihr Schicksal.
Spiegeln die Frauenfiguren die Meinung des Autors wider?
Ja, die Hausarbeit analysiert, inwiefern Giuseppe Tomasi di Lampedusa seine eigenen Ansichten über den gesellschaftlichen Wandel und die Rolle der Frau in seine Charakterisierungen einfließen ließ.
- Quote paper
- Susann Karstädt (Author), 2004, Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo - Die Frauen in "Il Gattopardo", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40074