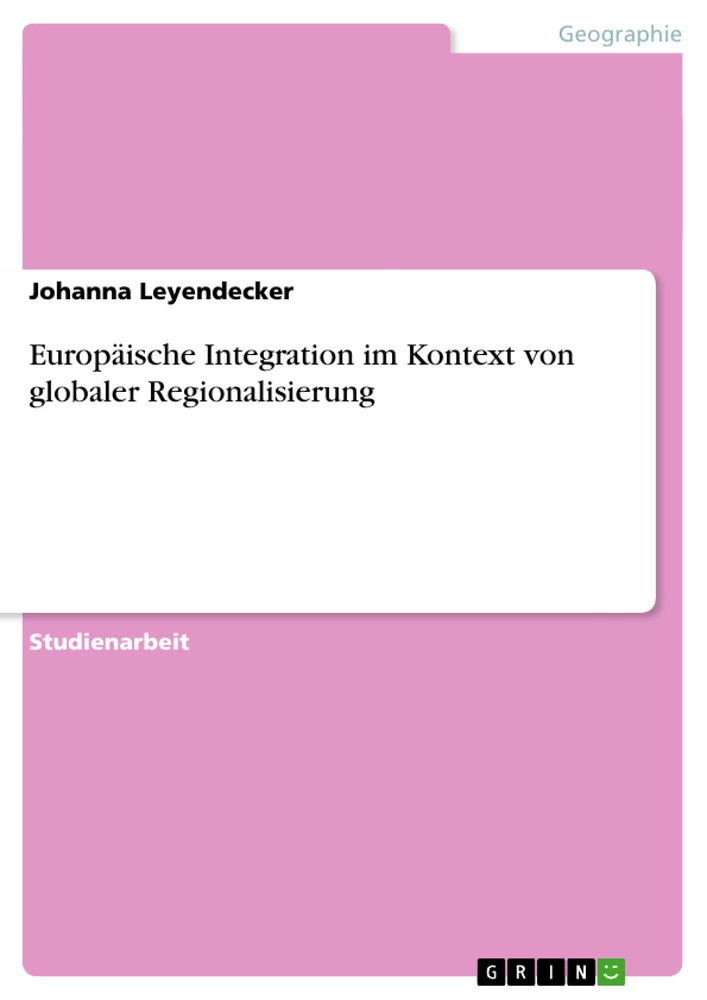1 Einleitung
Globalisierung ist heute ein allgegenwärtiger Begriff in Gesellschaft, Politik und Kultur. Es ist jener Prozess, der unser aller Leben tagtäglich in Gestalt des Joghurtbechers berührt, dessen Inhalts- und Verpackungsbestandteile weiter gereist sind, als sich die meisten Menschen jemals leisten könnten. Auch durch das Unterhaltungsprogramm im Fernsehen und Radio, welches zu einem großen Teil aus den Stilmixturen von emigrierten Künstlern in Zusammenarbeit mit international vermarktenden Produzententeams besteht, gelangt Globalisierung in unser Wohnzimmer. Etwas neuer, aber nicht minder ausführlich erörtert und dennoch ebenso unklar in ihrer Begrifflichkeit ist die ‚Regionalisierung’ im Zuge der Globalisierung. Wo bilden sich auf der Welt Regionen und wie steht dieser Prozess in Zusammenhang mit der allgegenwärtigen, viel diskutierten, und mit der gleichen Nachdrücklichkeit verteidigten wie abgelehnten Globalisierung? Ist Regionalisierung eine unweigerliche Folge der Globalisierung, oder eher ein Gegentrend zu ihr? Was ist der Unterschied zu Regionalismus? Inwieweit ist die Regionalisierung, und damit auch die Globalisierung, mit der sie in unmittelbarem Zusammenhang steht, als Chance zu begreifen? In der folgenden Arbeit werden alle diese Fragen angesprochen werden, nicht alle können jedoch beantwortet werden und nur auf wenige kann ausführlich eingegangen werden. Den Rahmen liefert das große Thema der Regionalisierung im Zuge der Globalisierung. Nach einer Definition der beiden Begriffe mit Nennung einiger Beispiele im zweiten Kapitel, wird im dritten Kapitel auf die EU als besondere und einmalige Form der Regionalisierung eingegangen. Im vierten Kapitel soll die gemeinsame Außenpolitik als Teilaspekt der Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedern näher betrachtet werden, um dadurch den Begriff der Integration, der häufig im Zusammenhang mit der Globalisierung im allgemeinen und der EU im Besonderen, fällt, zu entschlüsseln. Gerade dieser Teilaspekt ist im Rahmen der Globalisierungs- und Regionalisierungsdebatte von großem Interesse, da er beispielhaft die Chancen und Probleme der Regionalisierung gleichermaßen verdeutlicht. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition der Begriffe „Globalisierung“ und „Regionalisierung“
- Globalisierung
- Regionalisierung
- Kurzer Überblick über die Geschichte der Europäischen Integration
- Die europäische Integration der Außenpolitik
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Begriffe „Globalisierung“ und „Regionalisierung“ zu definieren und ihren Zusammenhang zu beleuchten. Sie untersucht, wie sich die Europäische Integration in diesem Kontext entwickelt hat und beleuchtet die europäische Außenpolitik als Teilaspekt der Integration.
- Definition der Begriffe „Globalisierung“ und „Regionalisierung“
- Die Geschichte der Europäischen Integration
- Die Europäische Außenpolitik als Teilaspekt der Integration
- Chancen und Probleme der Regionalisierung
- Der Zusammenhang zwischen Globalisierung, Regionalisierung und Integration
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Globalisierung und Regionalisierung ein und stellt die Forschungsfrage: Welchen Zusammenhang haben diese Prozesse miteinander und welche Rolle spielt die Europäische Integration in diesem Kontext?
Definition der Begriffe „Globalisierung“ und „Regionalisierung“
Dieses Kapitel definiert die Begriffe „Globalisierung“ und „Regionalisierung“ und beleuchtet ihre verschiedenen Aspekte. Es werden Beispiele für globale Prozesse und die Entstehung neuer Regionen vorgestellt.
Kurzer Überblick über die Geschichte der Europäischen Integration
Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die Geschichte der Europäischen Integration. Es beleuchtet die Entwicklung der EU als ein besonderes und einmaliges Beispiel für Regionalisierung.
Die europäische Integration der Außenpolitik
Dieses Kapitel betrachtet die gemeinsame Außenpolitik als Teilaspekt der Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedern. Es analysiert, wie dieser Teilaspekt die Integration, die häufig im Zusammenhang mit Globalisierung und EU fällt, entschlüsseln kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselbegriffe Globalisierung, Regionalisierung, Europäische Integration, Außenpolitik und Integration. Weitere wichtige Themen sind die Entstehung neuer Räume, die Rolle transnationaler Organisationen und die Chancen und Herausforderungen der Regionalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Globalisierung und Regionalisierung?
Globalisierung beschreibt weltweite Verflechtungen, während Regionalisierung die Bildung engerer wirtschaftlicher und politischer Blöcke in bestimmten Weltregionen bezeichnet.
Ist Regionalisierung ein Gegentrend zur Globalisierung?
Die Arbeit diskutiert, ob Regionalisierung eine unweigerliche Folge oder ein Gegentrend ist. Oft ergänzen sich beide Prozesse in einer komplexen Weltwirtschaft.
Warum gilt die EU als besondere Form der Regionalisierung?
Die EU ist aufgrund ihres hohen Integrationsgrades, gemeinsamer Institutionen und einer gemeinsamen Außenpolitik ein weltweit einmaliges Beispiel.
Welche Rolle spielt die gemeinsame Außenpolitik für die Integration?
Sie verdeutlicht die Chancen und Probleme der Zusammenarbeit, da sie zeigt, wie nationale Souveränität und regionales Handeln miteinander konkurrieren.
Was versteht man unter dem Begriff „Regionalismus“?
Regionalismus bezeichnet die bewusste politische Gestaltung und Ideologie hinter dem Prozess der Regionalisierung.
Welche Chancen bietet die Regionalisierung?
Sie bietet Schutz vor den Risiken einer ungebremsten Globalisierung und ermöglicht es Staaten, durch Bündnisse ihren politischen Einfluss zu wahren.
- Quote paper
- Johanna Leyendecker (Author), 2004, Europäische Integration im Kontext von globaler Regionalisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40122