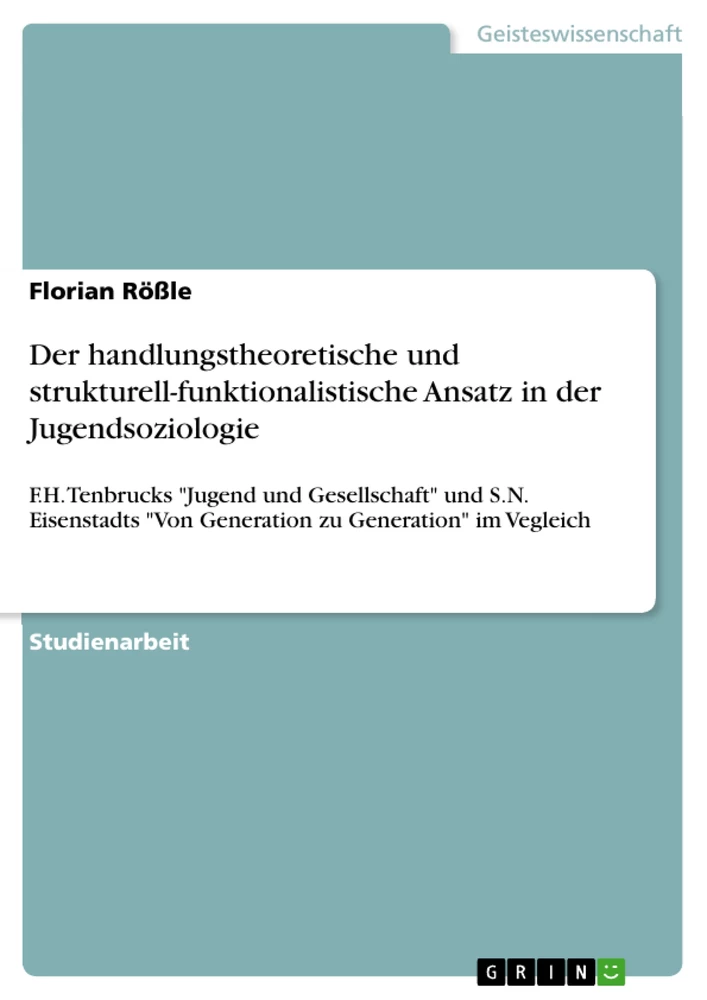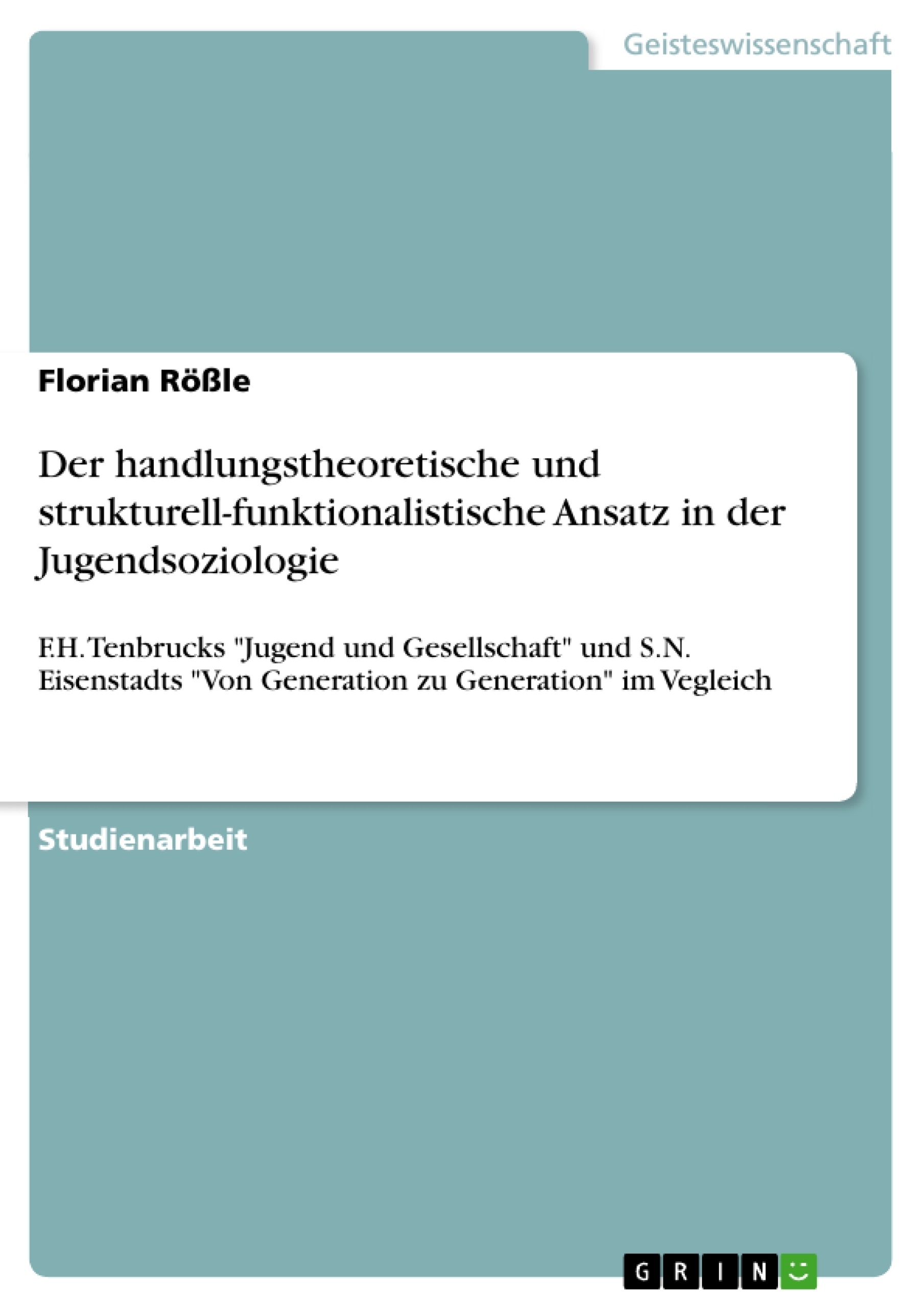1. Jugend: Was ist das?
[...]
Bevor man jedoch über Jugend sprechen kann, muss man zunächst die Bedeutung dieses Begriffes, der weder „(...)in der Alltagssprache noch in der Fachsprache der Soziologie, der Psychologie oder der Pädagogik(...)“ (Schäfers, 2001, S.17) aus einem Inhalt besteht, klären. Man kann den Begriff anhand von einigen Tatsachen für den Bereich der Soziologie definieren. Zunächst einmal ist Jugend eine Altersphase die jeder Mensch auf dem Weg vom Kind zum Erwachsenen durchlaufen muss. Diese Phase ist durch die Pubertät biologisch vorgegeben, wird aber durch die Gesellschaft „(...)sozial und kulturell ‚überformt’(...)“ (Schäfers, 2001, S.17), da in ihr der junge Mensch die Fähigkeiten zum Handeln als Erwachsener erwirbt. Des Weiteren ist Jugend eine, wie ich später noch erläutern werde, gesellschaftliche Teil- beziehungsweise Subkultur, die bestimmte Verhaltensweisen und Einstellungen besitzt (vgl. Schäfers, 2001, S.17).
Diese kurze Definition erläutert aber lediglich Grundlagen. Welche Funktion hat der Lebensabschnitt der Jugend? Wie nimmt die Gesellschaft industrialisierter Staaten, also beispielsweise unsere eigene, Einfluss auf diesen Lebensabschnitt und welche Folgen hat dies? Wie ist diese Gesellschaft überhaupt aufgebaut und was für Auswirkungen bringt dies für die Heranwachsenden mit sich? Dies sind einige der Fragen die ich in dieser Arbeit anhand der Betrachtung zweier der bedeutendsten soziologischen Theoriemodelle zum Thema Jugend klären will. Dies wird zunächst die handlungstheoretische Jugendtheorie nach Tenbruck sein. Anschließend werde ich mich mit der funktionalistischen Jugendtheorie Eisenstadts auseinandersetzen. Die Betrachtungen dieser Theorien können im Umfang einer Seminararbeit natürlich nicht den Anspruch erheben, vollständig oder erschöpfend zu sein, deshalb werde ich lediglich einige Aspekte behandeln können. Nach den Erläuterungen zu den theoretischen Modellen wird ein kurzer Vergleich, bezüglich Gemeinsamkeiten und Unterschiede der grundlegenden Annahmen, folgen. Dann möchte ich mich der Frage zuwenden, inwieweit die getroffene Einordnung in die übergeordneten Theoriemodelle zutreffend ist. Beginnen werde ich die Arbeit mit Tenbrucks Ansatz, dessen Betrachtung auch ausführlicher sein wird, da er meiner Meinung nach der Überzeugendere ist, diese Einschätzung werde ich im Schlussabschnitt näher erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Jugend: Was ist das?
- 2. Die handlungstheoretische Jugendtheorie nach Tenbruck
- 2.1 kurze Biographie
- 2.2 zentrale Aspekte seiner Theorie
- 2.2.1 Gesellschaftsanalyse nach Tenbruck
- 2.2.2 Merkmale der modernen Jugend
- 2.2.3 Ursachen und Auswirkungen der Ausprägung dieser Merkmale
- 3. Die funktionalistische Jugendtheorie Eisenstadts
- 3.1 kurze Biographie
- 3.2 zentrale Aspekte seiner Theorie
- 3.2.1 Voraussetzungen für das Fortbestehen des sozialen Systems
- 3.2.2 Funktionen von altersheterogenen Gruppen
- 3.2.3 Funktionen von altershomogenen Gruppen
- 4. Vergleich der Theorien
- 4.1 Gemeinsamkeiten
- 4.2 Unterschiede
- 5. Einordnung der beiden Theoriemodelle
- 6. Ist eine der Theorien auch heute noch überzeugend?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den handlungstheoretischen Ansatz in der Jugendsoziologie anhand von Tenbrucks „Jugend und Gesellschaft“ und vergleicht ihn mit dem strukturell-funktionalistischen Ansatz Eisenstadts. Ziel ist es, die jeweiligen Theorien zu erläutern und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten.
- Definition des Begriffs „Jugend“ und seine soziologischen Implikationen
- Handlungstheoretischer Ansatz nach Tenbruck: Gesellschaftsanalyse und Merkmale moderner Jugend
- Funktionalistischer Ansatz nach Eisenstadt: Funktionen altershomogener und -heterogener Gruppen
- Vergleich der beiden Ansätze hinsichtlich Gemeinsamkeiten und Unterschieden
- Bewertung der Aktualität der Theorien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Jugend: Was ist das?: Dieses einleitende Kapitel hinterfragt die Definition von Jugend. Es beginnt mit einem Zitat von Sokrates, das die zeitlose Problematik der Generationenunterschiede aufzeigt. Der Autor argumentiert, dass „Jugend“ weder alltagssprachlich noch fachwissenschaftlich eindeutig definiert ist. Er bietet eine soziologische Annäherung, indem er Jugend als eine biologisch (Pubertät) und sozial (gesellschaftliche Überformung) geprägte Lebensphase darstellt, die den Übergang vom Kind zum Erwachsenen markiert. Der Abschnitt endet mit der Ankündigung, die Funktion der Jugendphase und den gesellschaftlichen Einfluss auf diese im Kontext zweier soziologischer Theorien zu untersuchen.
2. Die handlungstheoretische Jugendtheorie nach Tenbruck: Dieses Kapitel widmet sich zunächst einem kurzen biografischen Abriss von Friedrich H. Tenbruck, um sein Werk besser zu kontextualisieren. Der Fokus liegt dann auf Tenbrucks Gesellschaftsanalyse, die die Frage nach der Übergabe des kulturellen Erbes an die Jugend in einfachen und komplexen Gesellschaften untersucht. Tenbruck betont den Unterschied zwischen der direkten Einbindung Jugendlicher in einfachen Gesellschaften und dem Bedarf an komplexeren Sozialisationsinstanzen in differenzierten Gesellschaften. Er beschreibt die Rolle gesellschaftlicher Organisationen wie Schule, Fürsorgeeinrichtungen und Medien in der Sozialisierung und hebt die Bedeutung der „freien Zugriffe“ auf die Jugend hervor.
3. Die funktionalistische Jugendtheorie Eisenstadts: Dieses Kapitel skizziert zunächst kurz die Biografie von S.N. Eisenstadt. Im Anschluss werden die zentralen Aspekte seiner funktionalistischen Jugendtheorie dargestellt. Eisenstadt untersucht die Voraussetzungen für das Fortbestehen des sozialen Systems und die Funktionen altersheterogener und altershomogener Gruppen. Die Zusammenfassung des Kapitels würde die spezifischen Funktionen dieser Gruppen im Kontext von Eisenstadts Theorie detailliert beschreiben und analysieren, wie sie zum Funktionieren des gesellschaftlichen Systems beitragen.
Schlüsselwörter
Jugendsoziologie, Handlungstheorie, Funktionalismus, Tenbruck, Eisenstadt, Sozialisation, Gesellschaft, Jugendkultur, Generationen, Sozialstruktur.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Jugend und Gesellschaft - Ein Vergleich der Theorien von Tenbruck und Eisenstadt
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über zwei soziologische Ansätze zur Jugend: die handlungstheoretische Theorie von Friedrich H. Tenbruck und die funktionalistische Theorie von S.N. Eisenstadt. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung, Kapitelzusammenfassungen, Schlüsselwörter und eine Einleitung, die den Begriff „Jugend“ hinterfragt.
Welche Theorien werden verglichen?
Der Text vergleicht die handlungstheoretische Jugendtheorie von Tenbruck mit der funktionalistischen Jugendtheorie von Eisenstadt. Tenbrucks Ansatz konzentriert sich auf das Handeln von Jugendlichen und deren Einbindung in die Gesellschaft, während Eisenstadts Ansatz die Funktionen von Jugendgruppen für das gesellschaftliche System betont.
Was sind die zentralen Aspekte von Tenbrucks Theorie?
Tenbrucks Theorie analysiert die Übergabe des kulturellen Erbes an die Jugend in verschiedenen Gesellschaftstypen. Er unterscheidet zwischen einfachen und komplexen Gesellschaften und betont die Rolle von Sozialisationsinstanzen wie Schule und Medien in modernen Gesellschaften. Ein wichtiger Aspekt ist die Bedeutung von "freien Zugriffen" der Jugend auf die Gesellschaft.
Was sind die zentralen Aspekte von Eisenstadts Theorie?
Eisenstadts funktionalistische Theorie untersucht die Funktionen altershomogener und -heterogener Gruppen für das Fortbestehen des sozialen Systems. Er analysiert, wie diese Gruppen zum Funktionieren der Gesellschaft beitragen.
Wie werden die Theorien verglichen?
Der Text vergleicht die beiden Theorien hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede, indem er ihre jeweiligen Ansätze und Schlussfolgerungen gegenüberstellt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Analyse der jeweiligen Gesellschaftsauffassungen und der Rolle der Jugend in diesen Gesellschaften.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Ziel des Textes ist es, die handlungstheoretische und die funktionalistische Jugendtheorie zu erläutern und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Zusätzlich wird die Frage der Aktualität beider Theorien diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter sind: Jugendsoziologie, Handlungstheorie, Funktionalismus, Tenbruck, Eisenstadt, Sozialisation, Gesellschaft, Jugendkultur, Generationen, Sozialstruktur.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist strukturiert in Kapitel, die sich mit der Definition von Jugend, Tenbrucks Theorie, Eisenstadts Theorie, einem Vergleich beider Theorien und deren Einordnung und Aktualität befassen. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst.
Wer sind Tenbruck und Eisenstadt?
Der Text enthält kurze biografische Abrisse von Friedrich H. Tenbruck und S.N. Eisenstadt, um ihre Theorien besser zu kontextualisieren.
Ist der Text aktuell?
Der Text untersucht die Aktualität der Theorien von Tenbruck und Eisenstadt und bewertet, inwiefern diese auch heute noch überzeugend sind. Dies ist ein zentraler Bestandteil der Analyse.
- Quote paper
- Florian Rößle (Author), 2004, Der handlungstheoretische und strukturell-funktionalistische Ansatz in der Jugendsoziologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40136