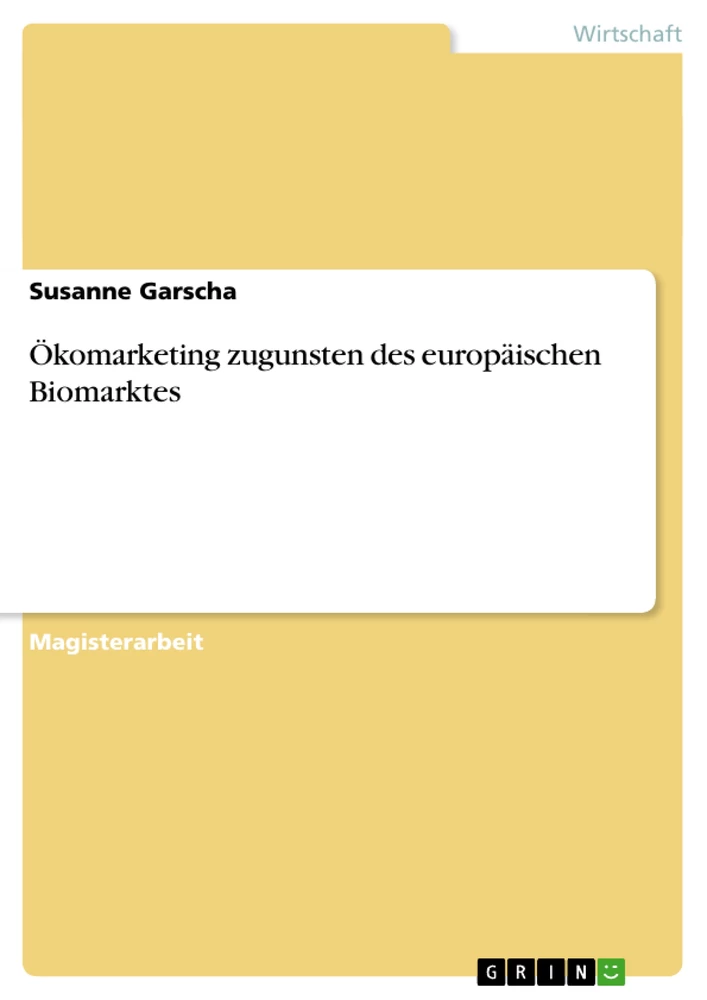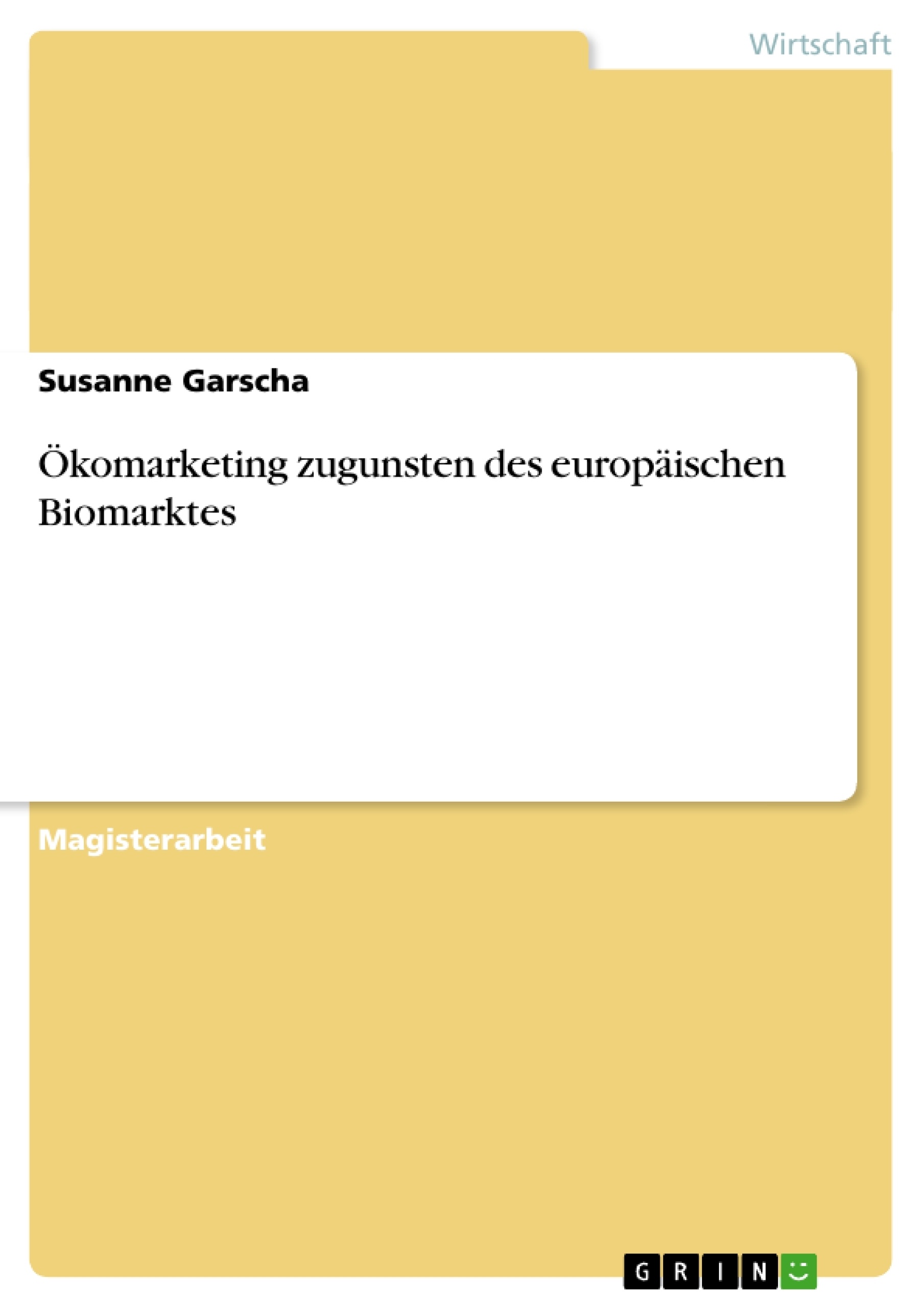„Raus aus der Nische und rein in den mainstream der Gesellschaft!“
ist eine Forderung von KREUZER für den biologischen Lebensmittelmarkt, die auch heute noch Relevanz zu haben scheint. Trotz der österreichischen Vormachtstellung am europäischen Bio-Lebensmittelmarkt scheint dieses Marktsegment noch immer einen enormen Aufholbedarf gegenüber konventionell gefertigten Lebensmitteln zu haben.
Ziel der Biolandwirtschaft ist es, natürliche Lebensmittel unter Berücksichtigung und Schonung der natürlichen Ressourcen, wie Boden und Wasser, zu erzeugen. Grundlage dafür sind europaweite Produktionsrichtlinien, die regelmäßig von unabhängigen Kontrollstellen überprüft und zertifiziert werden.
Der Einsatz von Schadstoffen, wie z.B. Pestiziden, ist in der Biolandwirtschaft nicht erlaubt. Ebenso sind Vorschriften zur Tierhaltung wesentlich strenger als im konventionellen Landbau. Als Nutzen von Bio-Lebensmitteln kann somit einerseits die gehobene Qualität gegenüber konventionell gefertigten Lebensmitteln, andererseits der geringere Schadstoff- und Pestizidanteil und der höhere Vitamingehalt angesehen werden.
Ein besonderes Problem stellt jedoch die Informationsasymmetrie zwischen Konsumenten und Herstellern dar. Konsumenten könnten die tatsächliche Umweltfreundlichkeit eines Produktes nicht überprüfen.
Eine Vielzahl von Lebensmitteln wird deshalb mit Ökolabels versehen. Diese drücken jedoch nur relative Umweltfreundlichkeit aus. Eine Auszeichnung bedeutet, dass ein bestimmtes Lebensmittel umweltfreundlicher einzustufen ist, als ein vergleichbares Lebensmittel ohne. Hier ist besonders Rücksicht zu nehmen auf die Vergabestelle des jeweiligen Labels. Jene, die vom Staat vergeben werden, sind durchaus als umweltpolitische Instrumente anzusehen, während private Herstellerlabels teils leicht zu erfüllende Auflagen und somit auch weniger Aussagekraft haben. Einen kritischen Randbereich stellen dabei sog. Green-Food-Claims dar, welche zwar Umweltfreundlichkeit suggerieren, jedoch oftmals keine tatsächliche Aussagekraft über eine ökologische Herstellung haben und lediglich das Ziel verfolgen, der Nachfrage nach umweltschonenden Lebensmitteln zu entsprechen, um so einen Wettbewerbsvorteil zu generieren.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Problemstellung
- Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- ÖKOLABELING IM LEBENSMITTELHANDEL
- Begriffsabgrenzungen
- Gesetzliche Grundlagen
- Regionalität und Nachhaltigkeit im Ökolandbau
- Klassifizierung von Ökolabels
- Staatliche Kontrollzeichen
- BIO-Austria Kontrollzeichen
- BIO-International Kontrollzeichen
- Kennzeichen österreichischer Bioverbände
- Bio Ernte Austria
- Förderungsgemeinschaft für gesundes Bauerntum
- Biologische Ackerfrüchte aus Österreich
- Der österreichische Demeterbund
- Erde & Saat
- Bio Hofmarke
- Kopra
- Dinatur
- Sonderform Codex-Betriebe
- Österreichische Biohandelsmarken
- Ja!Natürlich
- Natur*Pur
- Vergabe und Kontrolle von Ökolabels
- Institutionen
- Kontrollvorgang
- Distributionssysteme
- Kaufbarrieren & Ökomarketing
- Marktpsychologische Merkmale des Öko-Käufers
- Green Food Claims
- ANSÄTZE FÜR EINE MARKTANALYSE LANDWIRTSCHAFTLICHER BIOPRODUKTE
- Biomarkt Europa
- Anbau von Bioprodukten
- Entwicklung des Handels mit Bioprodukten
- EU-Ökolabel
- Entwicklungsperspektiven des europäischen Biomarktes
- Erfolgsfaktoren
- Biomarkt Österreich
- Entwicklungsstufen des österreichischen Ökolandbaus
- Entwicklungsperspektiven des österreichischen Biomarktes
- Präsenz von Ökolabels in den Handelsketten
- CASE STUDY
- Umfeld der Untersuchung
- Methodik
- Hypothesenformulierung
- Ergebnisse und Schlussfolgerungen
- ZUSAMMENFASSUNG & DISKUSSION
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Ökomarketing im Bereich der Biolebensmittel in Österreich. Sie untersucht die Bedeutung von Ökolabels für Konsumenten und analysiert die Herausforderungen und Chancen des Biomarktes.
- Die Bedeutung von Ökolabels als Instrument zur Kennzeichnung und Kommunikation von Bioprodukten
- Die Rolle von Ökolabels bei der Steigerung der Kaufbereitschaft für Bioprodukte
- Die Herausforderungen und Chancen des Biomarktes in Österreich
- Die Relevanz von Nachhaltigkeit und Regionalität im Kontext von Ökolandbau und Biolebensmitteln
- Die Marktpsychologie des Öko-Käufers und die Faktoren, die seine Kaufentscheidung beeinflussen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Problemstellung dar und skizziert die Zielsetzung und den Aufbau der Diplomarbeit.
- Das Kapitel "Ökolabeling im Lebensmittelhandel" erläutert die Begriffsabgrenzungen, die gesetzlichen Grundlagen, die verschiedenen Ökolabels und deren Vergabe sowie die Distributionssysteme.
- Das Kapitel "Ansätze für eine Marktanalyse landwirtschaftlicher Bioprodukte" gibt einen Überblick über den europäischen und österreichischen Biomarkt, analysiert die Entwicklung des Sektors und diskutiert die Erfolgsfaktoren.
- Die Case Study fokussiert auf die Konsumentenwahrnehmung von Ökolabels in Österreich und untersucht deren Relevanz im Kaufprozess.
Schlüsselwörter
Ökomarketing, Biomarkt, Ökolabels, Konsumentenverhalten, Nachhaltigkeit, Regionalität, Bioproduktion, Lebensmittelhandel, Österreich, EU-Ökolabel, Bio Austria, Green Food Claims, Kaufbarrieren
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von Ökomarketing im Lebensmittelbereich?
Das Ziel ist es, biologisch produzierte Lebensmittel aus der Nische in den Mainstream zu führen, indem die Vorteile (Ressourcenschonung, Qualität) kommuniziert und Kaufbarrieren abgebaut werden.
Was sind „Green Food Claims“?
Dies sind Werbeversprechen, die Umweltfreundlichkeit suggerieren, ohne dass eine tatsächliche ökologische Zertifizierung vorliegt. Sie dienen oft nur der Generierung von Wettbewerbsvorteilen durch Nachahmung.
Welche Bedeutung haben staatliche Ökolabels?
Staatliche Labels (wie das EU-Ökolabel oder das Bio-Austria Zeichen) gelten als vertrauenswürdige umweltpolitische Instrumente, da sie auf strengen gesetzlichen Produktionsrichtlinien und unabhängigen Kontrollen basieren.
Warum ist Informationsasymmetrie ein Problem beim Biokauf?
Konsumenten können die tatsächliche ökologische Herstellung eines Produktes nicht selbst überprüfen. Ökolabels dienen daher als notwendige Vertrauenssignale, um diese Informationslücke zu schließen.
Wie steht der österreichische Biomarkt im europäischen Vergleich da?
Österreich nimmt eine Vormachtstellung am europäischen Bio-Lebensmittelmarkt ein, hat aber dennoch Aufholbedarf gegenüber konventionellen Produkten, um nachhaltige Konsummuster weiter zu festigen.
- Arbeit zitieren
- Susanne Garscha (Autor:in), 2005, Ökomarketing zugunsten des europäischen Biomarktes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40207