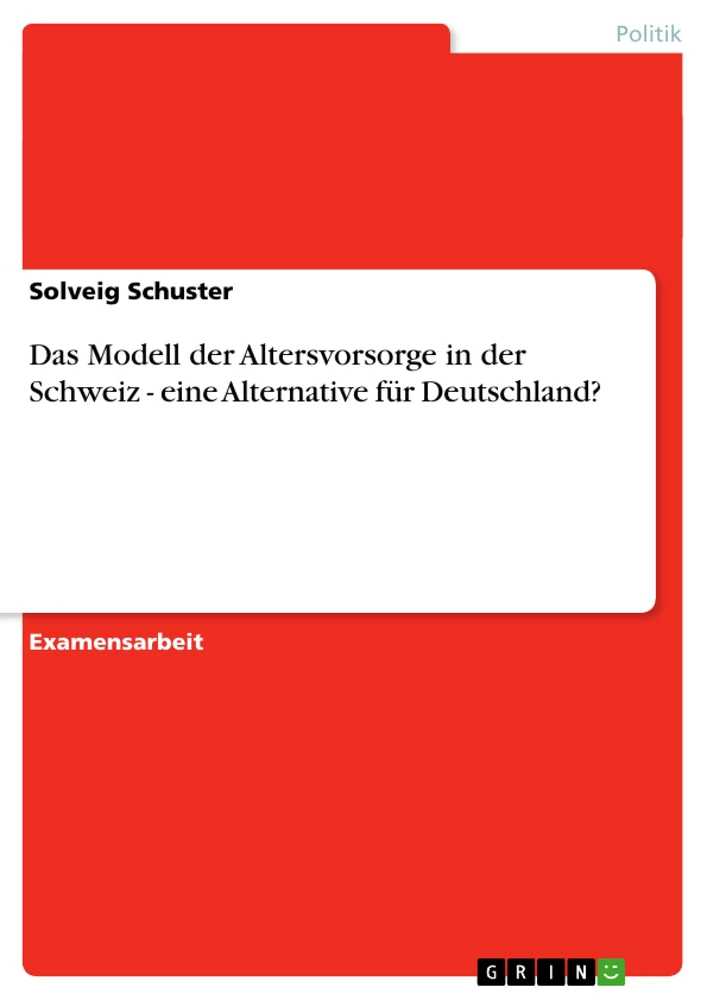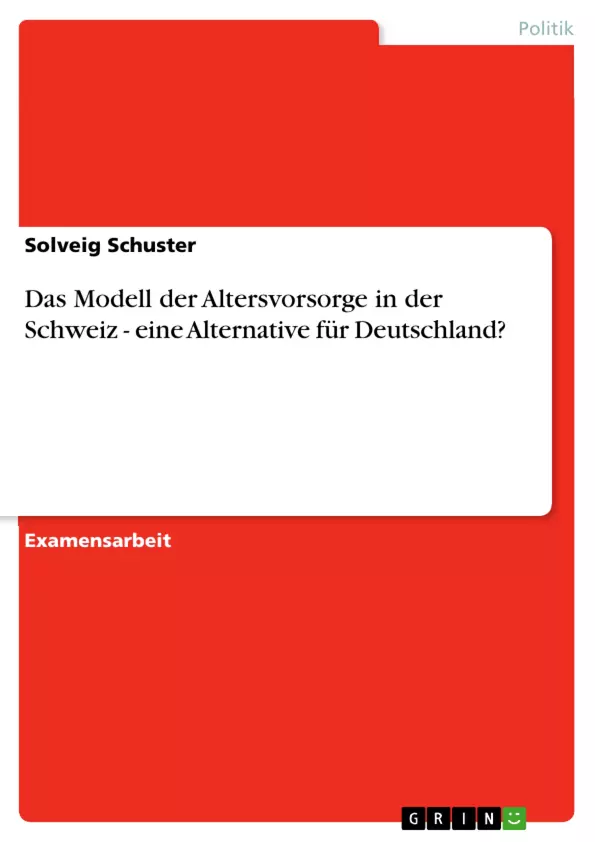Vor dem Hintergrund der demografischen und sozioökonomischen Entwicklungen zählt die Sicherung der sozialen Systeme zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Ein Geburtenrückgang und eine parallel ansteigende Lebenserwartung führen sukzessive zur Überalterung der Gesellschaft. Die Renten sind in der jetzigen Form und Höhe keineswegs mehr sicher. Während heute zwei Erwerbstätige für eine Altersrente aufkommen, muss im Jahre 2030 jeder Erwerbstätige etwa eine Rente finanzieren. Ohne Erhöhung der Beitragssätze könnte der demografischen Entwicklung nur mit erheblicher Kürzung der Rentenansprüche Rechnung getragen werden. Dies aber würde die Rentner zum einen um den Lohn ihrer erbrachten Lebensleistung bringen und sie zum anderen an den Rand der Armut drängen. Schon jetzt bewegen sich die ausgezahlten Renten vor allem von Frauen am und unter dem Existenzminimum. Seit Jahren debattieren die Politiker um die Zukunftsfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung. Reformen folgten auf Reformen. Bislang ist es jedoch keiner Reform gelungen, die Zukunftsfähigkeit des deutschen Rentenversicherungssystems dauerhaft zu sichern. Immer wieder ging und geht es vor allem um die Konsolidierung des Systems und eine Anpassung an die veränderten Bedingungen. Die Regierung hält im Wesentlichen weiter an der gesetzlichen umlagefinanzierten Rentenversicherung in ihren bestehenden Grundzügen und Strukturen und ihrer übergeordneten Bedeutung gegenüber der Privatvorsorge fest. Modelle, die eine Abkehr von der Dominanz der Umlagefinanzierung hin zu weit mehr Kapitaldeckung beinhalten, werden immer wieder in die Diskussion eingebracht. Als besonders vorbildlich und beispielgebend wird dabei gern die Schweiz zitiert. Dennoch finden die Verfechter eines solchen 3-Säulen-Modells in Deutschland offenbar kaum Gehör. Aber woran liegt das? Das Buch arbeitet heraus, wie sich die beiden Altersvorsorgesysteme unterscheiden und was für oder gegen eine mögliche Veränderung der deutschen Rentenversicherung nach dem Schweizer Vorbild spricht. Die Autorin untersucht, ob sich Elemente im Schweizer System finden lassen, die nicht nur ins deutsche übertragbar, sondern auch für die Probleme in Deutschland adäquate Lösungsansätze und zu den neuen Reformansätzen der Bundesregierung bislang unberücksichtigte Alternativen oder ergänzende Optionen sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Hintergrund und Fragestellung
- 1.2 Methodische Vorgehensweise
- 1.3 Gliederung der Arbeit
- 2 Grundlagen der sozialen Sicherung in Deutschland und der Schweiz
- 2.1 Sozialstaat und Sozialpolitik
- 2.1.1 Aufgaben und Ziele
- 2.1.2 Typologien
- 2.1.3 Grundprinzipien
- 2.1.3.1 Versicherungs- und Solidarprinzip
- 2.1.3.2 Versorgungsprinzip
- 2.1.3.3 Fürsorge- und Subsidaritätsprinzip
- 2.1.4 Finanzierungsmodelle
- 2.1.5 Beveridge- und Bismarck-Modell
- 2.2 Geschichte und Gegenwart der Sozialversicherung
- 2.2.1 Deutschland
- 2.2.2 Schweiz
- 2.3 Möglichkeiten und Grenzen des System-Umbaus
- 2.3.1 Voraussetzungen und Chancen politischer Veränderung
- 2.3.2 Reformierbarkeit traditioneller Strukturen in Deutschland
- 2.3.3 Vergleich der sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen
- 2.1 Sozialstaat und Sozialpolitik
- 3 Das Drei-Säulen-Modell der Schweiz
- 3.1 Grundlagen und Ziele
- 3.2 Säule 1: Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
- 3.2.1 Organisation und Finanzierung
- 3.2.2 Leistungen und Anspruchsvoraussetzungen
- 3.2.2.1 Alters- und Hinterlassenenrenten
- 3.2.2.2 Hilflosenentschädigung und Hilfsmittel
- 3.2.2.3 Invalidenrenten
- 3.2.2.4 Ergänzungsleistungen
- 3.2.3 Einnahmen und Ausgaben in der AHV und IV
- 3.3 Säule 2: Berufliche kapitalgedeckte Vorsorge
- 3.3.1 Organisation, Finanzierung und Leistungen
- 3.3.2 Institutionen der beruflichen Vorsorge
- 3.3.2.1 Vorsorgeeinrichtungen
- 3.3.2.2 Sicherheitsfonds und Auffangeinrichtung
- 3.3.3 Wohneigentumsförderung
- 3.4 Säule 3: Gebundene Selbstvorsorge und freies Sparen
- 3.5 Rentenvorbezug und Rentenaufschub
- 3.6 Alterssicherung der Frauen
- 3.7 Die wirtschaftliche Lage der Rentnerinnen
- 3.8 Probleme und Perspektiven in der Altersvorsorge
- 3.8.1 Finanzielle Konsolidierung in der AHV
- 3.8.2 Zugespitzte Lage in der Invalidenversicherung
- 3.8.3 Folgen der angespannten Wirtschaftslage für die BV
- 4 Die Altersvorsorge in Deutschland im Vergleich zum Schweizer Modell
- 4.1 Aufbau, Struktur und Ausgestaltung der Systeme
- 4.2 Arbeitnehmerversicherung versus Volksversicherung
- 4.3 Finanzierung
- 4.3.1 Beitragshöhe und Verteilung der Beitragslast
- 4.3.2 Rentenberechnung und Rentenniveau
- 4.3.3 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben
- 4.4 Möglichkeiten und Nutzung der Frühverrentung
- 4.5 Armutsrisiko und Verhinderung von Altersarmut
- 4.6 Die „Riester-Rente“ - Neue Strategien für mehr Eigenvorsorge
- 4.6.1 Grundzüge der Rentenreform
- 4.6.2 Förderung der privaten Vorsorge
- 4.6.3 Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge
- 4.6.4 Anlage- und Sparverhalten
- 4.7 Unterschiedliche Schwerpunktsetzung in den Säulen
- 4.7.1 Umlagefinanzierung versus Kapitaldeckung
- 4.7.2 Lebensstandardsicherung versus Grundsicherung
- 4.8 Zusammenfassung der Problemlage in Deutschland
- 5 Die Altersvorsorge in der Schweiz - eine Alternative für Deutschland
- 5.1 Lösungsansätze im Schweizer System
- 5.1.1 Erweiterung des Versichertenkreises
- 5.1.2 Aufhebung der Bemessungsgrenze
- 5.1.3 Grundsicherung und Ausbau der Eigenvorsorge
- 5.2 Handlungsoptionen für die Zukunft
- 5.1 Lösungsansätze im Schweizer System
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Schweizer Drei-Säulen-Modell der Altersvorsorge und vergleicht es mit dem deutschen System. Ziel ist es, die Stärken und Schwächen beider Modelle herauszuarbeiten und zu untersuchen, ob das Schweizer Modell eine Alternative für Deutschland darstellen könnte.
- Vergleich der deutschen und schweizerischen Systeme der Altersvorsorge
- Analyse des Drei-Säulen-Modells der Schweiz
- Bewertung der Stärken und Schwächen beider Systeme
- Diskussion der Übertragbarkeit des Schweizer Modells auf Deutschland
- Ausblick auf mögliche Reformen der deutschen Altersvorsorge
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Altersvorsorge in Deutschland und der Schweiz ein. Es formuliert die Forschungsfrage und beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Die Gliederung der Arbeit wird vorgestellt, um dem Leser einen Überblick über den Aufbau zu geben und die einzelnen Kapitel zu kontextualisieren.
2 Grundlagen der sozialen Sicherung in Deutschland und der Schweiz: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für den Vergleich der beiden Systeme. Es beleuchtet die Konzepte des Sozialstaats und der Sozialpolitik in beiden Ländern, untersucht verschiedene Typologien und Grundprinzipien der sozialen Sicherung, analysiert Finanzierungsmodelle und vergleicht die bekannten Beveridge- und Bismarck-Modelle. Die historische Entwicklung der Sozialversicherung in Deutschland und der Schweiz wird ebenfalls betrachtet, um den aktuellen Zustand besser zu verstehen. Schließlich werden Möglichkeiten und Grenzen des Systemumbaus in beiden Ländern diskutiert, unter Berücksichtigung der sozioökonomischen Rahmenbedingungen.
3 Das Drei-Säulen-Modell der Schweiz: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Schweizer Drei-Säulen-Modell. Es erläutert die Grundlagen und Ziele des Systems und analysiert jede Säule im Detail: die staatliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV), die berufliche Vorsorge (Säule 2) und die private Vorsorge (Säule 3). Die Organisation, Finanzierung und Leistungen jeder Säule werden erklärt, inklusive der Herausforderungen und Perspektiven. Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Funktionsweise des Systems und der Interdependenz der Säulen.
4 Die Altersvorsorge in Deutschland im Vergleich zum Schweizer Modell: In diesem Kapitel wird ein detaillierter Vergleich zwischen dem deutschen und dem Schweizer System der Altersvorsorge durchgeführt. Die unterschiedlichen Strukturen, Finanzierungsmechanismen (Umlagefinanzierung vs. Kapitaldeckung), die Berechnung der Renten und das Rentenniveau werden analysiert und gegenübergestellt. Die Problematik der Frühverrentung in Deutschland, das Armutsrisiko im Alter und die Rolle der „Riester-Rente“ werden im Detail untersucht. Schließlich wird der unterschiedliche Fokus auf Lebensstandardsicherung versus Grundsicherung beleuchtet.
5 Die Altersvorsorge in der Schweiz - eine Alternative für Deutschland: Dieses Kapitel diskutiert die Übertragbarkeit des Schweizer Modells auf Deutschland. Es untersucht mögliche Lösungsansätze, wie beispielsweise die Erweiterung des Versichertenkreises oder die Aufhebung der Bemessungsgrenze. Der Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob das Schweizer Modell eine praktikable Alternative für die Reform der deutschen Altersvorsorge darstellen könnte und welche Handlungsoptionen für die Zukunft bestehen.
Schlüsselwörter
Altersvorsorge, Deutschland, Schweiz, Drei-Säulen-Modell, Sozialversicherung, Umlagefinanzierung, Kapitaldeckung, Rentenniveau, Armutsrisiko, Reform, Solidarität, Eigenvorsorge, Berufliche Vorsorge, Private Vorsorge, Vergleichende Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Altersvorsorge in Deutschland und der Schweiz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Systeme der Altersvorsorge in Deutschland und der Schweiz, mit einem Schwerpunkt auf dem Drei-Säulen-Modell der Schweiz. Sie analysiert die Stärken und Schwächen beider Systeme und untersucht, ob das Schweizer Modell eine mögliche Alternative für Deutschland darstellen könnte.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: einen detaillierten Vergleich der deutschen und schweizerischen Altersvorsorgesysteme; eine eingehende Analyse des Drei-Säulen-Modells der Schweiz; eine Bewertung der Stärken und Schwächen beider Systeme; eine Diskussion über die Übertragbarkeit des Schweizer Modells auf Deutschland; und einen Ausblick auf mögliche Reformen der deutschen Altersvorsorge.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 bietet eine Einleitung mit Hintergrund, Fragestellung und methodischem Vorgehen; Kapitel 2 erläutert die Grundlagen der sozialen Sicherung in Deutschland und der Schweiz; Kapitel 3 beschreibt detailliert das Schweizer Drei-Säulen-Modell; Kapitel 4 vergleicht die Altersvorsorge in Deutschland und der Schweiz; und Kapitel 5 diskutiert die Übertragbarkeit des Schweizer Modells auf Deutschland und mögliche Zukunftsoptionen.
Welche Modelle der sozialen Sicherung werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht das deutsche System der Altersvorsorge mit dem Schweizer Drei-Säulen-Modell. Es werden die Unterschiede in Aufbau, Struktur, Finanzierung (Umlagefinanzierung vs. Kapitaldeckung), Rentenniveau und Armutsrisiko analysiert.
Was sind die Kernpunkte des Schweizer Drei-Säulen-Modells?
Das Schweizer Drei-Säulen-Modell besteht aus: Säule 1 (staatliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - AHV/IV); Säule 2 (berufliche Vorsorge - kapitalgedeckt); und Säule 3 (gebundene Selbstvorsorge und freies Sparen). Die Arbeit analysiert die Organisation, Finanzierung und Leistungen jeder Säule.
Welche Probleme der deutschen Altersvorsorge werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert Probleme wie die Frühverrentung, das Armutsrisiko im Alter, die Finanzierung der gesetzlichen Rente und die Rolle der Riester-Rente. Der Vergleich mit dem Schweizer Modell soll Lösungsansätze aufzeigen.
Welche Lösungsansätze für die deutsche Altersvorsorge werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Übertragbarkeit von Elementen des Schweizer Modells auf Deutschland, wie z.B. die Erweiterung des Versichertenkreises, die Aufhebung der Bemessungsgrenze und den Ausbau der Eigenvorsorge. Es werden verschiedene Handlungsoptionen für die Zukunft der deutschen Altersvorsorge erörtert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Altersvorsorge, Deutschland, Schweiz, Drei-Säulen-Modell, Sozialversicherung, Umlagefinanzierung, Kapitaldeckung, Rentenniveau, Armutsrisiko, Reform, Solidarität, Eigenvorsorge, Berufliche Vorsorge, Private Vorsorge, Vergleichende Analyse.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich für das Thema Altersvorsorge, Sozialpolitik und den Vergleich von Sozialsystemen interessieren, insbesondere für Wissenschaftler, Studenten, Politiker und Personen, die sich mit der zukünftigen Gestaltung der Altersvorsorge auseinandersetzen.
- Quote paper
- Solveig Schuster (Author), 2004, Das Modell der Altersvorsorge in der Schweiz - eine Alternative für Deutschland?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40217