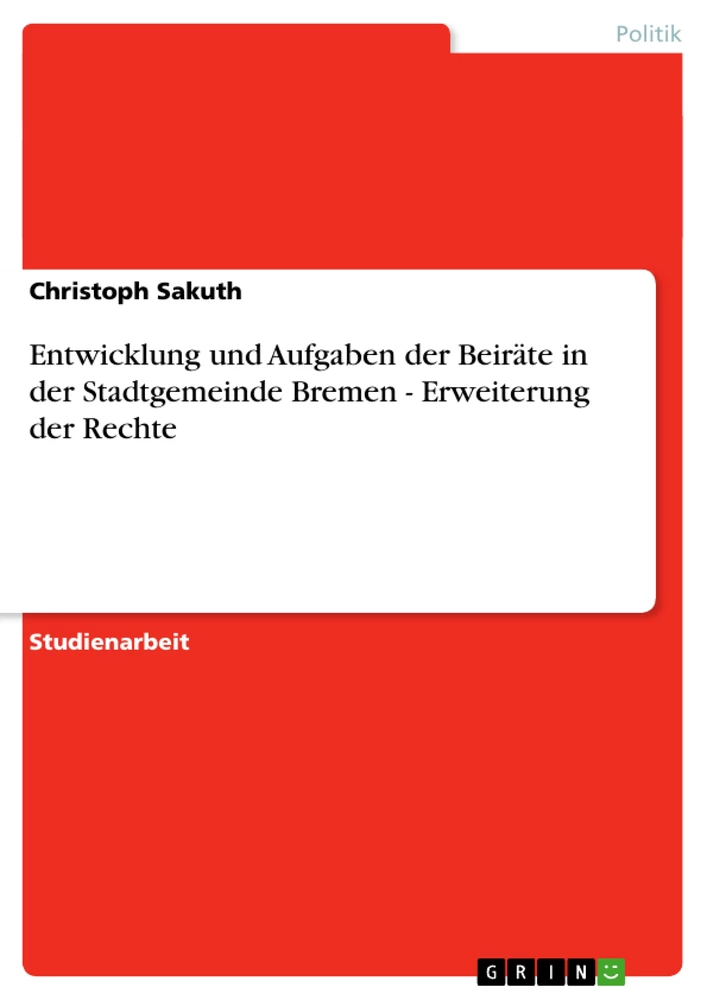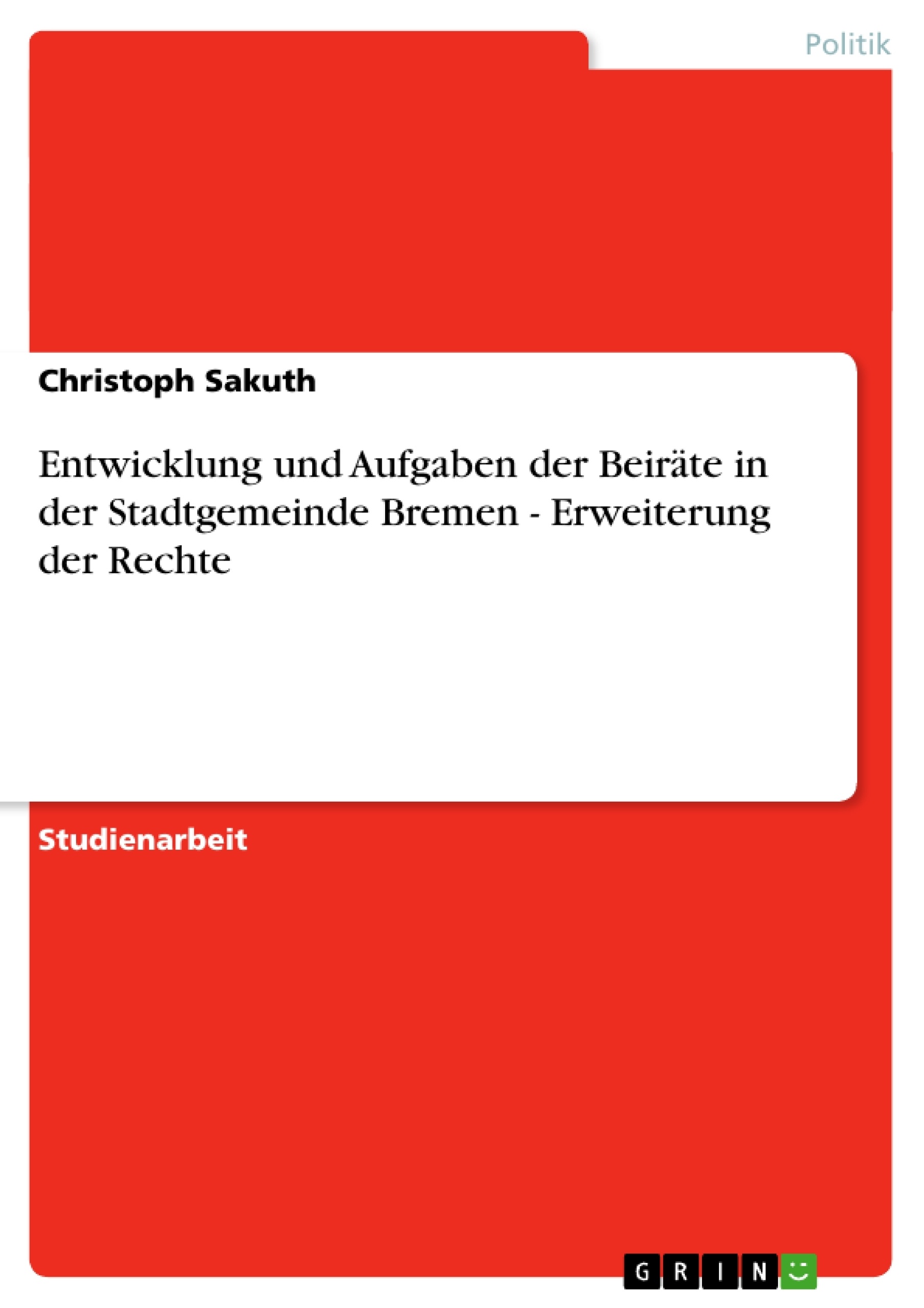Ein parlamentarisches System, das zwar breite Willensbildung im Rahmen repräsentativer Demokratie verspricht, faktisch aber alle Entscheidungen und Willensbildungen im politischen Leben einer winzigen Minderheit von Parteimitgliedern reserviert, hat ein chronisches Defizit an Beteiligung der Bürger1. Daraus ergibt sich die erste und vo rnehmste Verpflichtung für die Kommunalpolitik in der Weise, dass sie keine Politik „vom grünen Tisch aus“ sein darf. Kommunalpolitik muss davon ausgehen, dass der mündige und verantwortungsbewusste Bürger in immer stärkerem Maße an der Kommunalpolitik unmittelbar beteiligt werden muss. Das heißt, Planungen und Entscheidungen dürfen nicht in dem, dem für Bürger nicht zugänglichen Verwaltungsbereich getroffen werden. Sie muss so verstanden werden, dass der Bürger nicht nur formal, sondern vor allem politisch das Recht hat, mit zu diskutieren und mit zu entscheiden, wenn es um seine eigenen Belange, nämlich um die Gestaltung der Kommune geht. Diese Forderungen bzw. Ziele müssen gerade in einer repräsentativen Demokratie, wo die Betonung auf Demokratie und nicht auf Repräsentation zu liegen hat, im Mittelpunkt jeglicher kommunaler Entscheidungen stehen. Mitwirkung und Mitsprache der Betroffenen, denen Information und Aufklärung über den Zusammenhang des Details mit dem Ganzen vorausgehen muss, sind Grundvoraussetzungen, die im staatlichen Zusammenleben erfüllt sein müssen. Kritiker führen bei einer Erfüllung dieses Grundsatzes als Nachteil immer eine Verlangsamung des Verwaltungshandelns an. Diese Kritik kann aber dann nicht bestehen bleiben, wenn als oberste Maxime – Mitwirkung, Mitbestimmung, Mitverantwortung und Mitentscheidung von den Verantwortlichen für das jeweilige Gemeinwesen in den Mittelpunkt ihres Handelns gestellt werden. Ausgehend von diesen Grundüberlegungen wird der Versuch unternommen, nachstehend am Beispiel der Stadtgemeinde Bremen die Möglichkeiten und Verfahren für eine kommunale volks- und ortsnahe Verwaltung aufzuzeigen. 1 Vgl.: Heinz Grossmann, Bürgerinitiativen – Schritte zur Veränderung?, Fischer Nr. 1233, Seite 166, Frankfurt 1972
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtlicher Rückblick
- Rechtslage bis 1945
- Beirätestrukturen in den Jahren 1945 bis 1971
- Die Einführung der Beiräte im gesamten Stadtgebiet
- Die Gesetzesnovellierung von 1971
- Novellierung von 1989 - Einführung der Direktwahl
- Aufgaben und Rechte des Beirats
- Aufgaben des Beirates
- Recht auf Akteneinsicht
- Beschlussrecht des Beirates
- Wahl der Beiräte
- Direktwahl der Beiräte
- Bewertung der Beiratsarbeit
- Beiräte im Spannungsfeld zwischen Senat und Bürgerschaft
- Verfassungsrechtliche Schranken der Beiratsarbeit
- Rolle der Ortsämter als Verwaltungseinheit für den Beirat
- Schlussbetrachtung
- Rechtsquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Beiräte in der Stadtgemeinde Bremen und beleuchtet deren Aufgaben, Rechte und Bedeutung im Spannungsfeld zwischen Senat und Bürgerschaft. Das Hauptziel ist es, die Rolle der Beiräte im bremischen Verwaltungssystem zu analysieren und deren Beitrag zur kommunalen Selbstverwaltung zu bewerten.
- Entwicklung der Beiräte in der Stadtgemeinde Bremen
- Aufgaben und Rechte der Beiräte
- Beiräte im Spannungsfeld zwischen Senat und Bürgerschaft
- Verfassungsrechtliche Schranken der Beiratsarbeit
- Rolle der Ortsämter als Verwaltungseinheit für den Beirat
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt die Notwendigkeit einer stärkeren Bürgerbeteiligung in der Kommunalpolitik und stellt die Grundüberlegungen für die Arbeit dar. Das Kapitel "Geschichtlicher Rückblick" verfolgt die Entwicklung der Bremischen Ortsamtsverwaltung vom 19. Jahrhundert bis zur Einführung der Beiräte im gesamten Stadtgebiet. Es beleuchtet die Rechtslage bis 1945, die Beirätestrukturen in den Jahren 1945 bis 1971 und die Einführung der Beiräte im gesamten Stadtgebiet. Das Kapitel "Aufgaben und Rechte des Beirats" beleuchtet die Aufgaben und Rechte der Beiräte, darunter das Recht auf Akteneinsicht und das Beschlussrecht. Das Kapitel "Wahl der Beiräte" fokussiert auf die Direktwahl der Beiräte.
Schlüsselwörter
Bremen, Beiräte, Ortsamtsverwaltung, Kommunalpolitik, Bürgerbeteiligung, Selbstverwaltung, Senat, Bürgerschaft, Verwaltungssystem, Rechtslage, Aufgaben, Rechte, Direktwahl, Spannungsfeld, Verfassungsrecht, Verwaltungseinheit.
Häufig gestellte Fragen
Welche Aufgabe haben die Beiräte in der Stadtgemeinde Bremen?
Beiräte sind Stadtteilparlamente, die die Interessen der Bürger gegenüber dem Senat und der Bürgerschaft vertreten und bei stadtteilbezogenen Angelegenheiten mitentscheiden oder angehört werden müssen.
Seit wann werden die Beiräte in Bremen direkt gewählt?
Die Direktwahl der Beiräte wurde mit der Gesetzesnovellierung im Jahr 1989 eingeführt, um die demokratische Legitimation auf Stadtteilebene zu stärken.
Was versteht man unter dem Beschlussrecht des Beirates?
Das Beschlussrecht erlaubt es dem Beirat, in bestimmten, den Stadtteil betreffenden Fragen verbindliche Entscheidungen zu treffen, etwa bei der Verwendung von Stadtteilbudgets.
Welche Rolle spielen die Ortsämter für die Beiratsarbeit?
Die Ortsämter fungieren als Verwaltungseinheiten, die die Arbeit der Beiräte unterstützen, die Sitzungen vorbereiten und als Bindeglied zur zentralen Verwaltung dienen.
Was sind die verfassungsrechtlichen Schranken der Beiratsarbeit?
Da Bremen ein Stadtstaat ist, dürfen die Kompetenzen der Beiräte die Entscheidungsbefugnis der Bürgerschaft als Landesparlament nicht verletzen; sie agieren im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.
- Quote paper
- Christoph Sakuth (Author), 2005, Entwicklung und Aufgaben der Beiräte in der Stadtgemeinde Bremen - Erweiterung der Rechte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40260