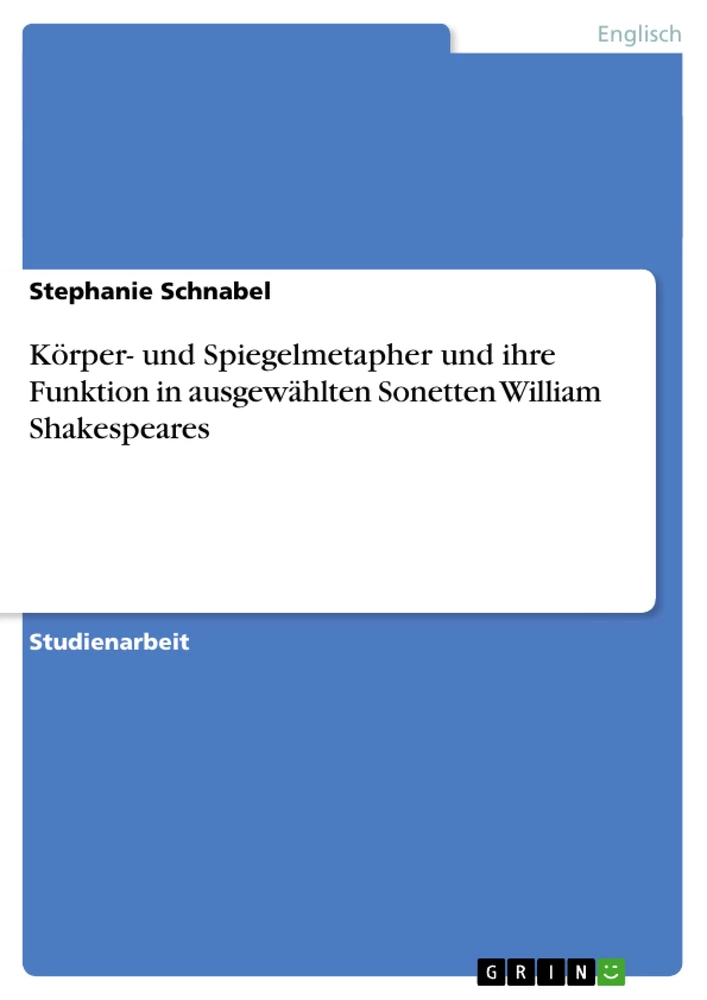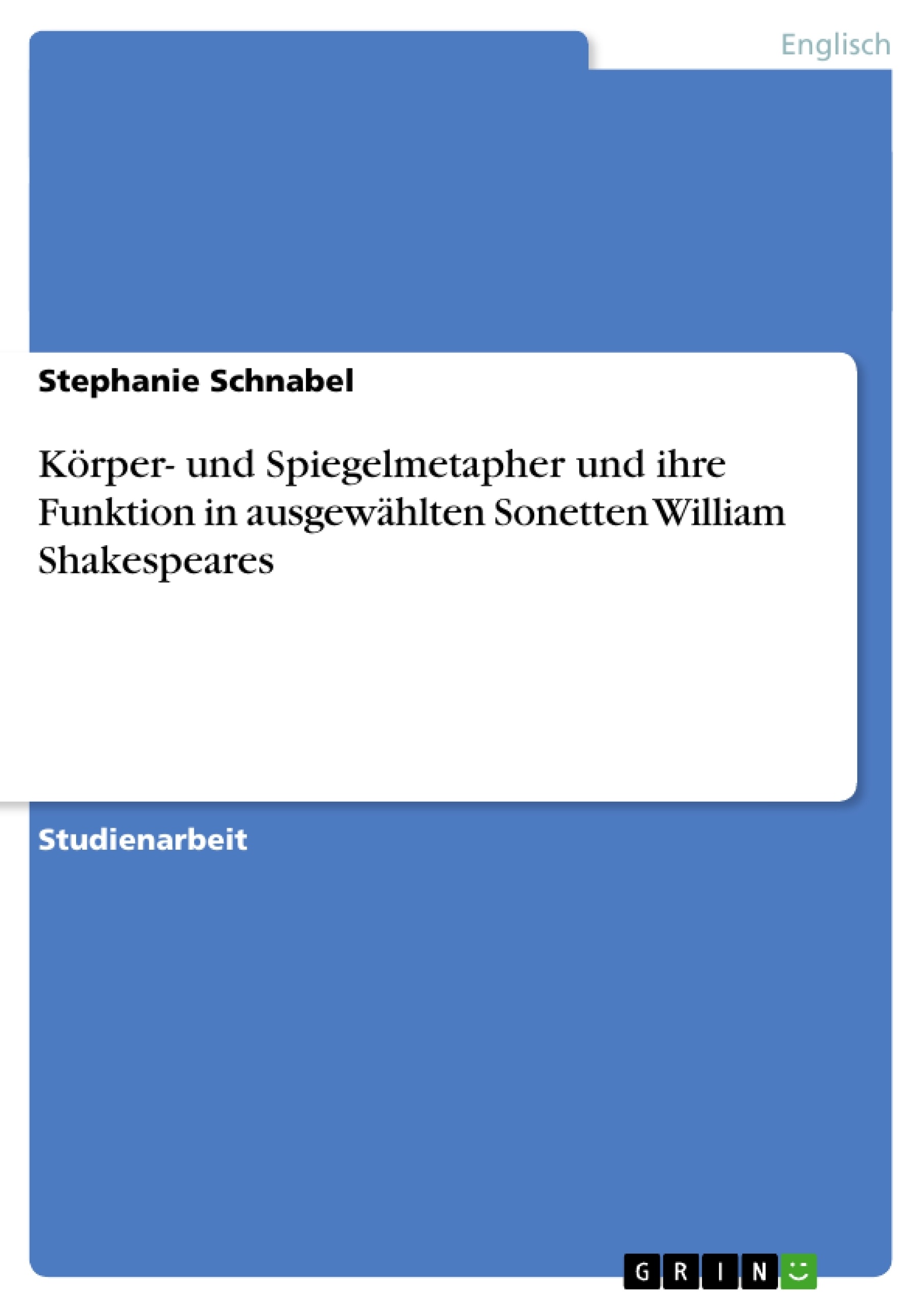Diese Arbeit behandelt die Funktion der Körper- und Spiegelmetaphorik in den Sonetten William Shakespeares anhand ausgewählter Beispiele.
Im ersten Teil geht es um den allgemeinen Hintergrund der Sonette als Gedichtform. Es wird kurz auf die Übertragung des Sonetts in den englischsprachigen Kulturraum eingegangen, um danach den Höhepunkt seiner Entwicklung in England am Ende des 16. Jahrhunderts vorzustellen. Shakespeares Sonettzyklus fällt ein wenig aus diesem zeitlichen Rahmen heraus, da seine Gedichte erst 1609 veröffentlicht werden. Auch er arbeitet jedoch mit Bildern und Metaphern, die in der Tradition Petrarcas stehen. Wie aber sehen diese aus? Worin unterscheidet sich Shakespeares Werk möglicherweise von dem seiner Zeitgenossen?
Da mir bei der Durchsicht der Literatur zum Thema Metapher aufgefallen ist, wie schwer sich einzelne Metapherntypen trennen lassen, werde ich in meiner Untersuchung ausgewählter Sonette Shakespeares auf zwei Metapherntypen eingehen.
Als Grundlage hierfür dienten mir die folgenden Monographien: "Speculum, Mirror und Looking-Glass - Kontinuität und Originalität der Spiegelmetapher in den Buchtiteln des Mittelalters und der englischen Literatur des 13. bis 17. Jahrhunderts" von Herbert Grabes und Ernst Robert Curtius' Werk "Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter".
Es geht in diesem zweiten Teil als erstes um die literarische Entwicklung und Verwendung der zwei Metapherntypen vor der elisabethanischen Zeit. Danach werden der Gebrauch und die Weiterentwicklung bei den Schriftstellerkollegen Shakespeares beschrieben, um anschließend den Blick auf drei ausgewählte Sonette des Dichters und Dramatikers zu richten, die auf unterschiedliche Art und Weise mit diesen Metaphern spielen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE ENTWICKLUNG DES SONETTS BIS IN DIE ELISABETHANISCHE ZEIT
- Petrarca und seine, Übersetzer' Wyatt und Surrey
- Der Höhepunkt der Sonettdichtung in England
- DAS SONETT BEI WILLIAM SHAKESPEARE
- Die Verbindung von Biographie und Werk
- Die Figuren im kompletten Sonettzyklus
- KÖRPER- UND SPIEGELMETAPHER IN DER LITERATUR
- Ursprünge der Metaphern in der Literatur
- Die Metaphern bei den Zeitgenossen William Shakespeares
- BETRACHTUNG EINZELNER SONETTE
- Sonett 20
- Sonett 24
- Sonett 130
- ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Funktion von Körper- und Spiegelmetaphern in ausgewählten Sonetten William Shakespeares. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Sonettform, insbesondere in England, und wie Shakespeare diese Tradition nutzt und weiterentwickelt. Dabei werden die spezifischen Merkmale und Bedeutungen der Körper- und Spiegelmetaphern untersucht und in den Kontext der zeitgenössischen Literatur gestellt.
- Die Entwicklung der Sonettform von Petrarca bis Shakespeare
- Die Verwendung von Körper- und Spiegelmetaphern in der elisabethanischen Literatur
- Die Funktion von Metaphern in ausgewählten Sonetten Shakespeares
- Die Verbindung von literarischer Tradition und individuellen Interpretationen
- Der Einfluss von Petrarkistischen Ideen auf Shakespeares Sonette
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und erläutert die Forschungsfrage, die sich mit der Funktion von Körper- und Spiegelmetaphern in den Sonetten Shakespeares beschäftigt. Das zweite Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Sonetts bis in die elisabethanische Zeit, insbesondere die Rolle Petrarcas und seiner „Übersetzer" Wyatt und Surrey.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit Shakespeares Sonettzyklus und stellt die Verbindung zwischen Biographie und Werk sowie die Figuren im gesamten Sonettzyklus vor.
Das vierte Kapitel betrachtet die Ursprünge und die literarische Entwicklung der Körper- und Spiegelmetaphern, sowohl in der allgemeinen Literaturgeschichte als auch im Kontext der Zeitgenossen William Shakespeares.
Im fünften Kapitel werden drei ausgewählte Sonette Shakespeares untersucht, wobei die Funktion der Körper- und Spiegelmetaphern in diesen Gedichten im Vordergrund steht.
Schlüsselwörter
Sonett, William Shakespeare, Körpermetapher, Spiegelmetapher, Petrarkismus, elisabethanische Literatur, englische Literatur, Dichter, Dramatiker, Metapher, literarische Tradition, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Welche Funktion haben Spiegelmetaphern in Shakespeares Sonetten?
Sie dienen der Reflexion von Identität, Schönheit und Vergänglichkeit, wobei Shakespeare auf Traditionen des Mittelalters und Petrarcas zurückgreift.
Welche Sonette werden in der Arbeit detailliert untersucht?
Die Arbeit analysiert insbesondere die Sonette 20, 24 und 130 hinsichtlich ihrer Metaphorik.
Was ist das Besondere an Shakespeares Sonettzyklus?
Er wurde erst 1609 veröffentlicht und weicht teilweise von der strengen petrarkistischen Tradition ab, indem er individuelle Interpretationen und neue Figuren einführt.
In welchem literarischen Kontext stehen die Körpermetaphern?
Sie stehen in der Tradition elisabethanischer Lyrik und wurden von Vorgängern wie Wyatt und Surrey aus dem italienischen Kulturraum (Petrarca) nach England übertragen.
Welche Rolle spielt die Spiegelmetapher in der elisabethanischen Zeit?
Sie wurde von Zeitgenossen Shakespeares als gängiges literarisches Bild genutzt, das Shakespeare jedoch originell weiterentwickelte.
- Arbeit zitieren
- Stephanie Schnabel (Autor:in), 2005, Körper- und Spiegelmetapher und ihre Funktion in ausgewählten Sonetten William Shakespeares, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40331