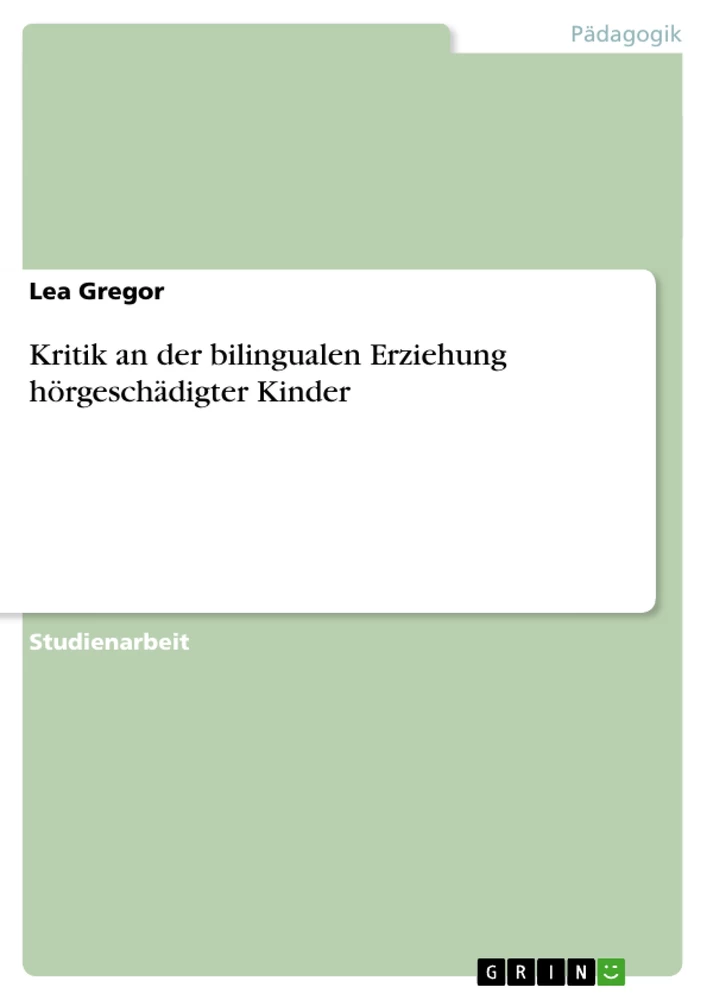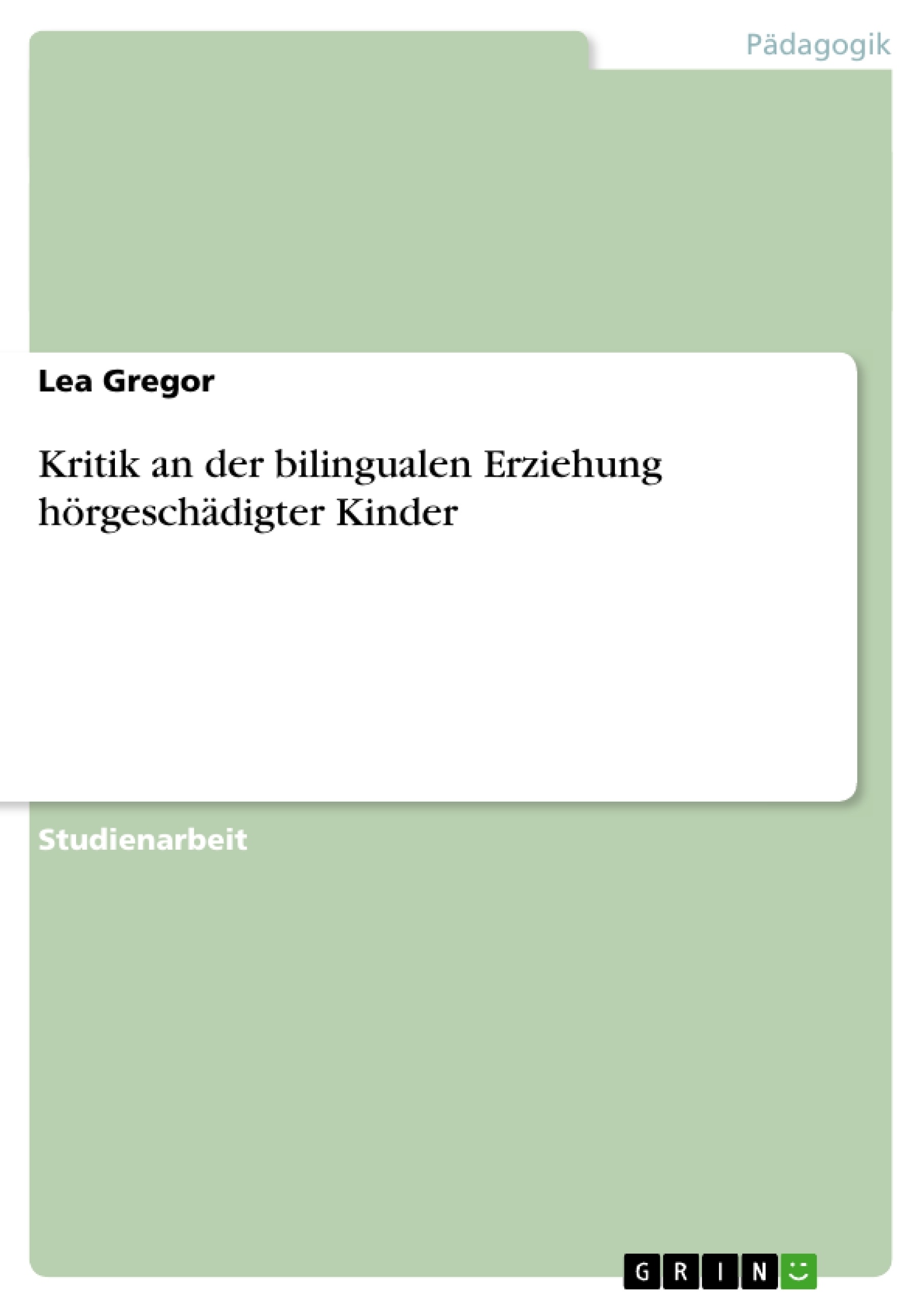Die Diskussion um die gebärdensprachlich orientierte Erziehung gehörloser Schüler, also die Diskussion darüber, ob gehörlose Kinder die Gebärdensprache erlernen und im Unterricht anwenden sollen oder nicht, geht zurück auf die Anfänge institutionalisierter Erziehung Hörgeschädigter Ende des 18. Jahrhunderts. Schon damals war die Hörgeschädigtenpädagogik beherrscht durch einen Methodenstreit zwischen Anhängern lautsprachlich und Anhängern gebärdensprachlich orientierter Erziehung gehörloser Kinder.
Das auf die Gebärdensprache ausgerichtete Konzept, auch die Französische Methode genannt, wurde 1770 von Abbé de l`Epée (1712-1789) eingeführt . Er gründete in Paris ein privates Taubstummeninstitut, an dem er seine Schüler mittels eines gebärdensprachlichen Zeichensystems unterrichtete. Unterstützt wurde diese gebärdensprachliche Kommunikation durch das Handalphabet und die Schrift. Die Lautsprache hatte im Institut von Abbé de l`Eppée so gut wie keine Bedeutung, auch als es nach seinem Tod durch Abbé Sicard (1742-1822) weitergeführt wurde. Der Französischen Methode gegenüber stand ein deutsches Konzept, das durch Samuel Heinicke mit Gründung des „Kürfürstlich-Sächsischen Instituts für Stumme und andere mit Sprachgebrechen behaftete Personen“ 1778 in Leipzig eingeführt wurde. Heinicke vertrat die Meinung, die Lautsprachvermittlung habe an erster Stelle zu stehen. Entsprechend betonte er die Notwendigkeit der alltagsorientierten Artikulation und bahnte das Lesen mit der Ganzheitsmethode (eine Methode, bei der das Kind mittels ganzer Wörter und nicht einzelner Buchstaben das Lesen lernt) an. Dem Absehen der Laute vom Mund und dem Schriftbild maß er eine minimale Bedeutung zu, die Gebärde lehnte er ganz ab.
So unterschiedlich und gegensätzlich die beiden Schulen in Paris und Leipzig mit den dort praktizierten Methoden auch waren, so hatten sie doch eines gemeinsam: Sie waren erfolgreich und diese Erfolge ebneten einer
institutionalisierten Bildung und Erziehung Gehörloser den Weg. Man orientierte sich methodisch an einem der beiden Konzepte, wobei zunächst eine vermehrte Ausrichtung an der Französischen Methode festzustellen war. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte sich dann in den deutschsprachigen Ländern die lautsprachig orientierte Erziehung Hörgeschädigter durch.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Exkurs in die Geschichte
- 2. Vorstellung der bilingualen Modelle aus Schweden und Hamburg
- 2.1 Schweden
- 2.2 Hamburg
- 3. Kritik
- 3.1 Kritik Dillers
- 3.2 Kritik Coninx'
- 3.3 Kritik der Bundesgemeinschaft der Eltern und Freunde hörgeschädigter Kinder e.V.
- 4. Eigene Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kritik an bilingualen Erziehungsansätzen für gehörlose Schüler. Ziel ist es, verschiedene Positionen und Argumente im Diskurs um die Gebärdensprache und Lautsprache in der Erziehung Gehörloser zu beleuchten und zu analysieren.
- Historische Entwicklung der pädagogischen Ansätze zur Erziehung gehörloser Kinder
- Vorstellung und Vergleich verschiedener bilingualer Modelle (Schweden, Hamburg)
- Analyse der Kritik an diesen Modellen aus unterschiedlichen Perspektiven (Diller, Coninx, Bundesgemeinschaft der Eltern und Freunde hörgeschädigter Kinder e.V.)
- Bewertung der Argumente für und gegen die Verwendung von Gebärdensprache im Unterricht
- Zusammenfassende Betrachtung der Kontroverse um die beste Methode der Sprachförderung bei Gehörlosen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Exkurs in die Geschichte: Die Einleitung beleuchtet den historischen Methodenstreit in der Hörgeschädigtenpädagogik zwischen lautsprachlich und gebärdensprachlich orientierten Ansätzen. Sie beschreibt die Entwicklung von der "Französischen Methode" (Abbé de l'Epée) zur lautsprachlichen Dominanz im 19. Jahrhundert, geprägt durch den Einfluss von Samuel Heinicke und Johannes Vatters. Der Mailänder Kongress von 1880 und seine Beschlüsse zur Überlegenheit der Lautsprache werden detailliert dargestellt. Die kontroverse und oft unsachliche Natur der Debatte wird hervorgehoben, die bis heute anhält, oft ohne wissenschaftliche Fundierung. Die einseitige Fokussierung auf Lautsprache in Gehörlosenschulen und die Vernachlässigung anderer Aspekte der Bildung werden kritisch beleuchtet. Parallel dazu wird die Entwicklung der Gebärdenbewegung und der Kampf der Gehörlosen um ihre Rechte skizziert.
2. Vorstellung der bilingualen Modelle aus Schweden und Hamburg: Dieses Kapitel präsentiert die bilingualen Ansätze in Schweden und Hamburg als Grundlage für die nachfolgende Kritik. Es dient der Kontextualisierung der späteren Argumentationen, da die meisten kritisierten Ansätze auf diesen Modellen basieren. Die detaillierte Beschreibung der einzelnen Modelle bietet einen Vergleichsrahmen und eine Grundlage für das Verständnis der darauf folgenden Kritikpunkte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Bilingualer Ansatz in der Gehörlosenpädagogik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Kritik an bilingualen Erziehungsansätzen für gehörlose Schüler. Sie beleuchtet und analysiert verschiedene Positionen und Argumente im Diskurs um die Gebärdensprache und Lautsprache in der Erziehung Gehörloser.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung pädagogischer Ansätze zur Erziehung gehörloser Kinder, vergleicht verschiedene bilinguale Modelle (Schweden, Hamburg), analysiert Kritik an diesen Modellen (Diller, Coninx, Bundesgemeinschaft der Eltern und Freunde hörgeschädigter Kinder e.V.), bewertet Argumente für und gegen die Verwendung von Gebärdensprache im Unterricht und betrachtet zusammenfassend die Kontroverse um die beste Methode der Sprachförderung bei Gehörlosen.
Welche Modelle werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt bilinguale Modelle aus Schweden und Hamburg vor. Diese dienen als Grundlage für die Analyse der darauf folgenden Kritik.
Welche Kritikpunkte werden diskutiert?
Die Arbeit analysiert die Kritik an den bilingualen Modellen aus verschiedenen Perspektiven, darunter die Kritik von Diller, Coninx und der Bundesgemeinschaft der Eltern und Freunde hörgeschädigter Kinder e.V.
Wie wird die historische Entwicklung dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet den historischen Methodenstreit in der Hörgeschädigtenpädagogik, von der "Französischen Methode" (Abbé de l'Epée) über die lautsprachliche Dominanz des 19. Jahrhunderts (Heinicke, Vatters) bis zum Mailänder Kongress von 1880. Sie beschreibt die oft unsachliche Natur der Debatte und die einseitige Fokussierung auf Lautsprache.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: 1. Einleitung und Exkurs in die Geschichte; 2. Vorstellung der bilingualen Modelle aus Schweden und Hamburg; 3. Kritik; 4. Eigene Stellungnahme.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, verschiedene Positionen und Argumente im Diskurs um die Gebärdensprache und Lautsprache in der Erziehung Gehörloser zu beleuchten und zu analysieren.
- Arbeit zitieren
- Lea Gregor (Autor:in), 2001, Kritik an der bilingualen Erziehung hörgeschädigter Kinder, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40449