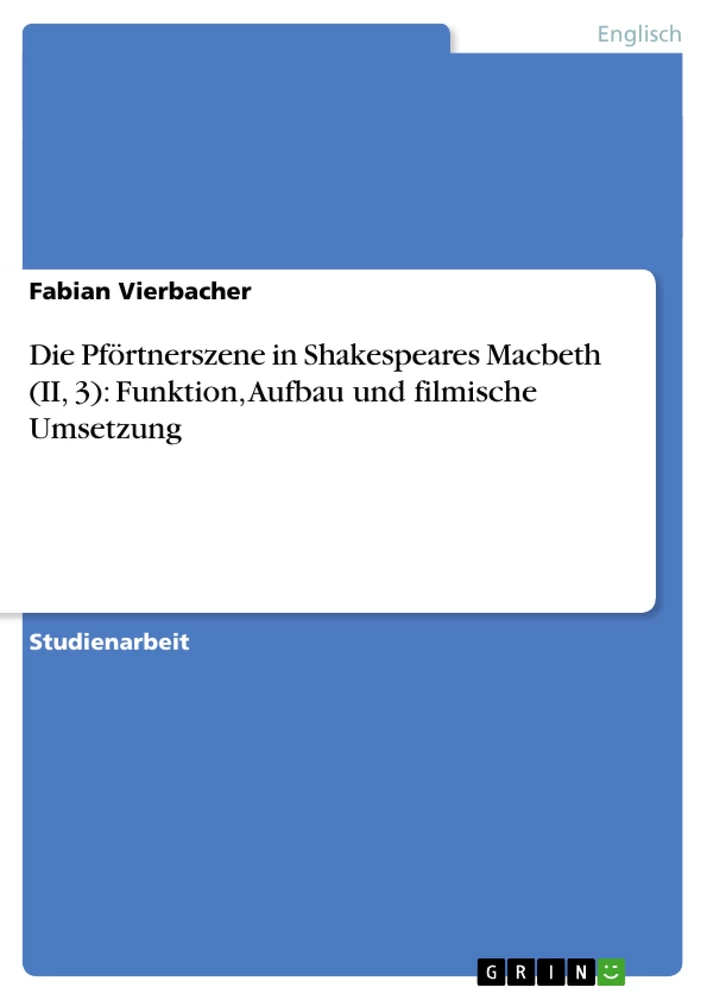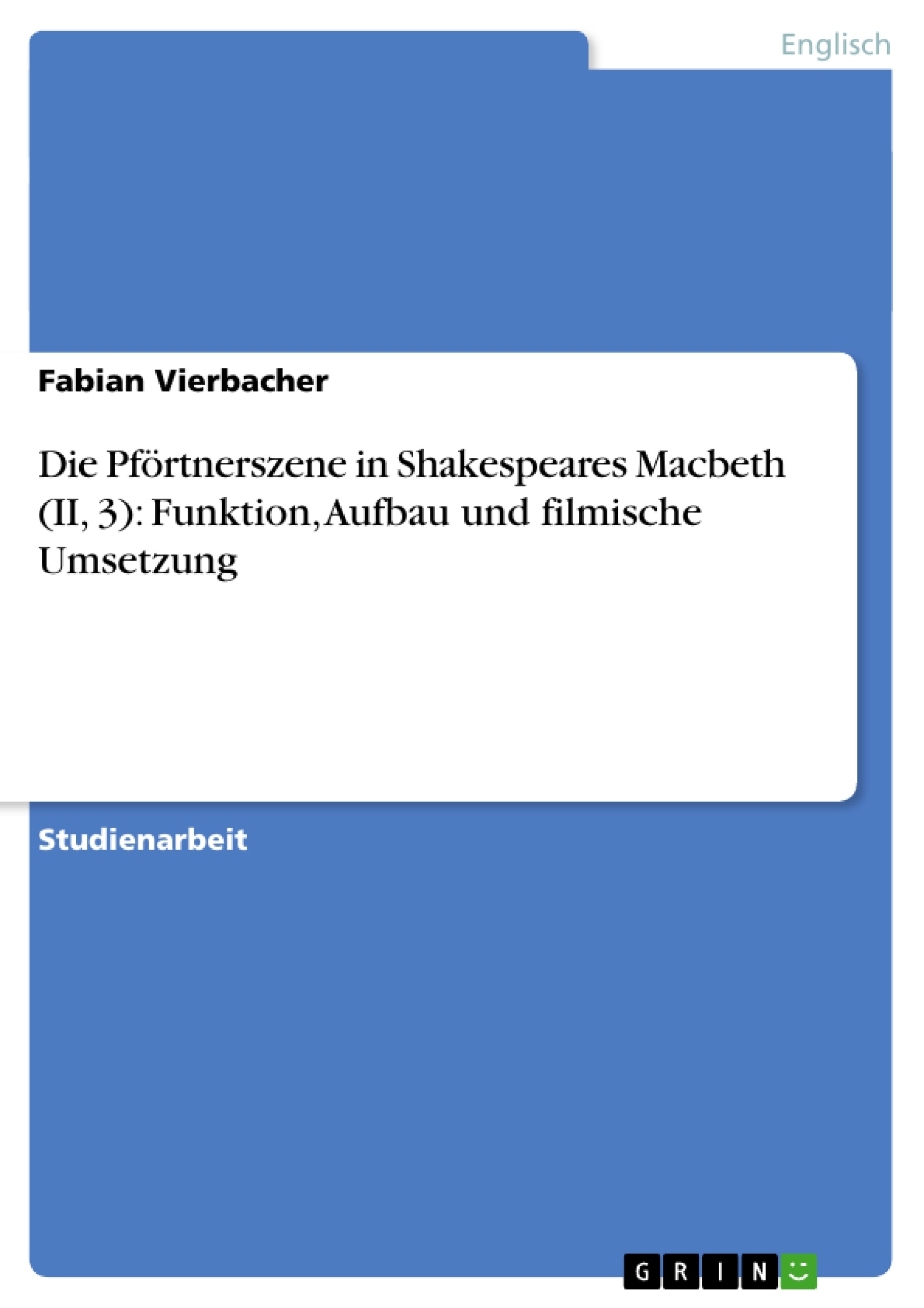„Not one syllable has the ever-present being of Shakespeare1“ – so kritisch äußerte sich einst der renommierte Literaturwissenschaftler Coleridge über den Auftritt des Pförtners in Shakespeares Macbeth. Selbst in neueren Werken wird diese kleine Szene (II, 3) oft als simpler Klamauk abgetan. Doch wird eine solch eindimensionale Beurteilung der Komplexität der Szene wirklich gerecht? Bei genauerer Auseinandersetzung mit dem Auftritt wird schnell klar, dass er nicht isoliert außerhalb der eigentlichen Handlung steht, sondern vielmehr eine wichtige Rolle in der Gesamtheit des Dramas einnimmt.
Im Folgenden soll genau diese Szene eingängiger betrachtet werden, wobei ich mich hierbei auf den eigentlichen Auftritt des Pförtners beschränke (Vers 1-34), da sich die restliche Szene inhaltlich in eine völlig andere Richtung entwickelt. Im Zentrum meiner Betrachtungen soll die Frage stehen, welche Funktion die Pförtnerszene auf den Rezipienten hat: Dient sie in erster Linie als humoristische Verschnaufpause oder geht es um die Charakterisierung des Protagonisten? Um sich der Thematik angemessen nähern zu können ist es zunächst einmal wichtig, den historischen Hintergrund dieser Passage zu betrachten und die Rolle solcher komischen Figuren im elisabethanischen Drama zu berücksichtigen. Im dritten Teil dieser Arbeit steht die Art und Weise, wie Shakespeare mit dem Auftreten des Pförtners Komik erzeugt im Mittelpunkt. Nachfolgend werden dann Funktions- und Wirkungsweise der Pförtnerszene eingehender betrachtet. Neben den dramatischen Funktionen ist vor allem die Bedeutung der Szene für die Figur des Macbeth, die Wirkung auf den Rezipienten, sowie das Aufgreifen zentraler Aspekte aus dem Gesamtdrama von Bedeutung. Der 5. Punkt beschäftigt sich dann mit der Umsetzung der Pförtnerfigur im Film anhand von vier Beispielen. Abschließend werde ich die wichtigsten Punkte zusammenfassen und ein Resümee ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Die Pförtnerszene - „un-Shakespearean“?
- 2. Historischer Kontext
- 3. Die Komik der Szene
- 3.1. Der Auftritt des Pförtners bis zum Eintreten Macduffs (II, 3.1-17)
- 3.2. Entwicklung der Szene nach dem Auftreten Macduffs (II, 3.18-34)
- 4. Funktionen der Pförtnerszene
- 4.1. Grundcharakteristika und dramatische Funktionen
- 4.2. Bedeutung für die Figur des Macbeth
- 4.3. Die Szene und ihre Wirkung auf den Rezipienten
- 4.4. Aufgreifen zentraler Aspekte aus dem Gesamtdrama
- 5. Filmische Umsetzungen
- 6. Schluss: Die Pförtnerszene - Herausforderung für Film und Theater
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Pförtnerszene (II, 3) in Shakespeares Macbeth. Ziel ist es, die Funktion und den Aufbau dieser oft als "un-Shakespearean" bezeichneten Szene zu analysieren und deren filmische Adaptionen zu betrachten. Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext komischer Figuren im elisabethanischen Theater und untersucht, wie Shakespeare Komik in dieser Szene erzeugt.
- Die Funktion der Pförtnerszene im Gesamtkontext des Dramas
- Der historische Kontext und die Rolle komischer Figuren im elisabethanischen Theater
- Die Erzeugung von Komik durch Shakespeare in der Pförtnerszene
- Die Bedeutung der Szene für die Charakterisierung Macbeths
- Die filmische Umsetzung der Pförtnerszene
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Pförtnerszene - „un-Shakespearean“?: Die Einleitung stellt die These auf, dass die oft als simpler Klamauk abgetane Pförtnerszene (II,3) in Shakespeares Macbeth eine wichtige Rolle im Gesamtwerk spielt. Sie führt die Forschungsfrage ein: Dient die Szene als humoristische Verschnaufpause oder zur Charakterisierung des Protagonisten? Der Fokus liegt auf den Versen 1-34. Die Einleitung weist auf die gegensätzlichen Interpretationen der Szene in der Literatur hin, von Coleridge's Kritik bis hin zur modernen Rezeption, und kündigt die Struktur der Arbeit an.
2. Historischer Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext komischer Auftritte im elisabethanischen Theater. Es verortet die Figur des Pförtners in der Tradition mittelalterlicher Miracle Plays, wo "böse" Charaktere lächerlich dargestellt wurden, um den ernsten Hintergrund zu kontrastieren. Die Verbindung des Macbethschen Pförtners zum "porter of hell-gate" wird hergestellt, ebenso der Bezug zu "The Harrowing of Hell". Die Rolle des Pförtners als populäre Figur im Theater und die Möglichkeit, dass Robert Armin die Rolle spielte und das Publikum direkt ansprach, wird diskutiert.
3. Die Komik der Szene: Dieses Kapitel analysiert, wie Shakespeare Komik in der Pförtnerszene erzeugt. Es wird die Szene in zwei Teile gegliedert (II, 3.1-17 und II, 3.18-34), um die Entwicklung der Komik zu verfolgen. Die Analyse untersucht den Sprachgebrauch des Pförtners, seine betrunkene Natur und die Interaktion mit Macduff. Der Kontrast zwischen dem Grauen der vorherigen Mordszene und der Komik der Pförtnerszene wird ebenfalls untersucht.
4. Funktionen der Pförtnerszene: Dieser Abschnitt erörtert die dramatischen Funktionen der Pförtnerszene und ihre Bedeutung für die Figur des Macbeth sowie ihre Wirkung auf den Rezipienten. Die Analyse beleuchtet, wie die Szene zentrale Aspekte des Gesamtdramas aufgreift und die Spannung zwischen Komik und Grauen verwaltet. Die unterschiedlichen Interpretationen der Funktion der Szene in der Literatur werden berücksichtigt und diskutiert.
Schlüsselwörter
Shakespeare, Macbeth, Pförtnerszene, Komik, elisabethanisches Theater, historischer Kontext, dramatische Funktion, Charakterisierung, filmische Umsetzung, Robert Armin, Miracle Plays, The Harrowing of Hell.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Pförtnerszene in Shakespeares Macbeth
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Pförtnerszene (II, 3) in Shakespeares Macbeth. Der Fokus liegt auf der Funktion und dem Aufbau dieser oft als "un-Shakespearean" bezeichneten Szene, sowie auf deren filmischen Adaptionen.
Welche Ziele verfolgt die Analyse der Pförtnerszene?
Die Arbeit untersucht den historischen Kontext komischer Figuren im elisabethanischen Theater und analysiert, wie Shakespeare Komik in dieser Szene erzeugt. Sie beleuchtet die Funktion der Szene im Gesamtkontext des Dramas, ihre Bedeutung für die Charakterisierung Macbeths und ihre Wirkung auf den Rezipienten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Funktion der Pförtnerszene im Gesamtkontext des Dramas, den historischen Kontext und die Rolle komischer Figuren im elisabethanischen Theater, die Erzeugung von Komik durch Shakespeare in der Pförtnerszene, die Bedeutung der Szene für die Charakterisierung Macbeths und die filmische Umsetzung der Pförtnerszene.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (die Pförtnerszene - "un-Shakespearean"?), Historischer Kontext, Die Komik der Szene (unterteilt in zwei Unterkapitel), Funktionen der Pförtnerszene (mit Unterkapiteln zu den Grundcharakteristika, der Bedeutung für Macbeth und der Wirkung auf den Rezipienten), Filmische Umsetzungen und Schluss (Die Pförtnerszene - Herausforderung für Film und Theater).
Welche Aspekte der Komik werden in der Pförtnerszene analysiert?
Die Analyse untersucht den Sprachgebrauch des Pförtners, seine betrunkene Natur und seine Interaktion mit Macduff. Der Kontrast zwischen dem Grauen der vorherigen Mordszene und der Komik der Pförtnerszene wird ebenfalls untersucht. Die Szene wird in zwei Teile gegliedert (II, 3.1-17 und II, 3.18-34), um die Entwicklung der Komik zu verfolgen.
Welche Bedeutung hat der historische Kontext für die Interpretation der Pförtnerszene?
Das Kapitel zum historischen Kontext verortet die Figur des Pförtners in der Tradition mittelalterlicher Miracle Plays, wo "böse" Charaktere lächerlich dargestellt wurden, um den ernsten Hintergrund zu kontrastieren. Es wird die Verbindung zum "porter of hell-gate" und "The Harrowing of Hell" hergestellt, und die Rolle des Pförtners als populäre Figur im Theater und die mögliche Besetzung durch Robert Armin wird diskutiert.
Welche Funktionen werden der Pförtnerszene zugeschrieben?
Die Arbeit erörtert die dramatischen Funktionen der Pförtnerszene und ihre Bedeutung für die Figur des Macbeth sowie ihre Wirkung auf den Rezipienten. Die Analyse beleuchtet, wie die Szene zentrale Aspekte des Gesamtdramas aufgreift und die Spannung zwischen Komik und Grauen verwaltet. Unterschiedliche Interpretationen der Funktion der Szene aus der Literatur werden berücksichtigt und diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Shakespeare, Macbeth, Pförtnerszene, Komik, elisabethanisches Theater, historischer Kontext, dramatische Funktion, Charakterisierung, filmische Umsetzung, Robert Armin, Miracle Plays, The Harrowing of Hell.
Wie wird die These der Arbeit formuliert?
Die Einleitung stellt die These auf, dass die oft als simpler Klamauk abgetane Pförtnerszene (II,3) in Shakespeares Macbeth eine wichtige Rolle im Gesamtwerk spielt. Die Forschungsfrage lautet: Dient die Szene als humoristische Verschnaufpause oder zur Charakterisierung des Protagonisten?
Welche filmischen Adaptionen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet filmische Umsetzungen der Pförtnerszene, jedoch wird im vorliegenden Auszug keine detaillierte Beschreibung der analysierten Filme gegeben.
- Quote paper
- Fabian Vierbacher (Author), 2005, Die Pförtnerszene in Shakespeares Macbeth (II, 3): Funktion, Aufbau und filmische Umsetzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40453