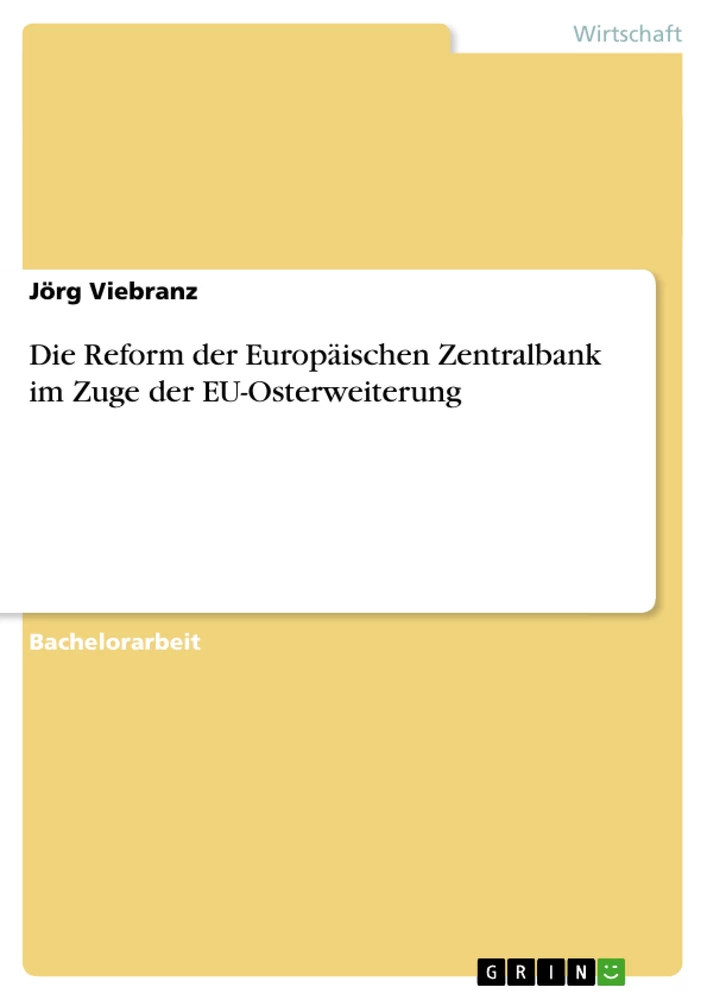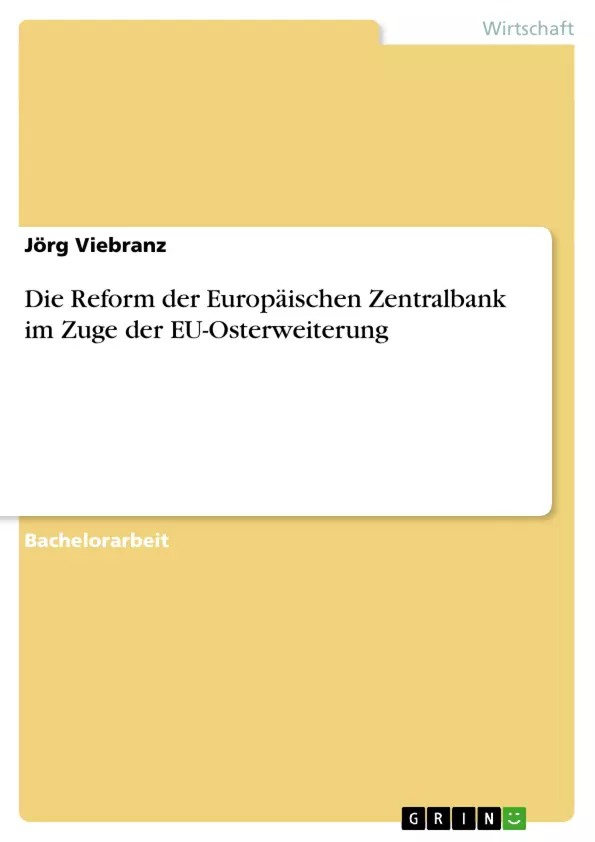2004 traten zehn osteuropäische Länder der Europäischen Union (EU) bei. Aus einer Staatengemeinschaft mit ehemals 15 Mitgliedern wurde eine mit 25. Sobald diese Länder die im Vertrag von Maastricht festgelegten Kriterien erfüllen, könnten sie der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EMU) beitreten. Damit ist die Übernahme der gemeinsamen Währung, dem Euro (€) verbunden. Die Europäische Zentralbank (EZB) entscheidet mithilfe des Zinssatzes unmittelbar über den Euro und seine Verbreitung. Das Entscheidungsgremium der EZB, der Governing Council, besteht aus dem sechsköpfigen Executive Board (EXB) und den Präsidenten der nationalen Zentralbanken. Er bestand zum Zeitpunkt der EU-Osterweiterung aus 18 Mitgliedern (EXB + 12 NZB-Präsidenten). Im internationalen Vergleich ist diese Anzahl für ein Monetary Policy Committee relativ groß. Sollten aber alle EU-Länder EMU beitreten, wird der Governing Council sogar über 30 Mitglieder umfassen, was seine Arbeit erheblich beeinträchtigen würde.
Darüber hinaus ergibt sich das Problem eines Missverhältnisses zwischen politischer und ökonomischer Macht. Da jedes Mitglied des Governing Councils über eine Stimme verfügt und die meisten neuen Mitglieder wirtschaftlich „kleine“ Länder sind, könnte sich bei Abstimmungen im Governing Council die (als unangenehm empfundene) Situation ergeben, dass eine Koalition „kleiner“ Länder die Mehrheit stellt und damit die Geldpolitik bestimmen kann, aber weniger als 20% des BIP der Eurozone repräsentiert. Eine Reform, die die Größe des Governing Councils erheblich beschneidet und effiziente Entscheidungen auch nach der Erweiterung sicherstellt, scheint unerlässlich.
An dieser Stelle beginnt das Problem der Arbeit. Wie soll die Struktur geändert werden und welche Kriterien sind dabei zu berücksichtigen? In der Arbeit wird zunächst die Notwendigkeit einer Reform näher begründet und dann verschiedene Reformmodelle dargestellt und untersucht. Die Arbeit schließt mit einem eigenen Reformvorschlag, der auf den positiven Aspekten der analysierten Modelle beruht.
Obwohl die Arbeit speziell von der Reform der EZB im Zuge der EU-Osterweiterung handelt, sind die Untersuchung und deren Ergebnisse auch heute noch aktuell. Das Problem der EZB lässt sich nämlich auf die meisten anderen Institutionen übertragen, wie z.B. die Reform der Kommission oder den EU-Vertrag. Hier könnten die gewonnenen Erkenntnisse nachwievor nutzbringend eingesetzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erster Teil: Warum eine Reform der EZB notwendig ist
- Geschichtliche Entwicklung zur EU und zur Economic and Monetary Union, sowie ihre Institutionen
- Zur Notwendigkeit einer Reform des Governing Councils im Zuge der EU-Osterweiterung
- Argumente gegen eine Reform
- Das Gegenargument von W. Paczynski und D. Gros
- Das Gegenargument: Condorcet Jury Theorem
- Argumente für eine Reform
- Der Status Quo Bias
- Empirische und Psychologische Argumente
- Status quo Bias
- Der Regional Bias
- Überrepräsentation und Entscheidungskosten
- Modell von Berger
- Entscheidungskosten
- Konklusion des Ersten Teils
- Zweiter Teil: Verschiedene Reformvorschläge
- Delegation/Zentralisierung
- Darstellung Delegation
- Darstellung Zentralisierung
- Kritik Delegation/Zentralisierung
- Vorschlag von Gros et al.
- Vorschlag des Europäischen Parlaments (EP)
- Repräsentation
- Darstellung Repräsentation
- Kritik Repräsentation
- Stimmgewichtung
- Darstellung Stimmengewichtung
- Kritik Stimmengewichtung
- Rotation und EZB Vorschlag
- Darstellung Rotation
- Der Vorschlag der EZB
- Kritik Rotation und EZB Vorschlag
- Dritter Teil: Evaluation der Argumente und eigener Vorschlag
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Notwendigkeit einer Reform der Europäischen Zentralbank (EZB) im Kontext der EU-Osterweiterung. Sie analysiert die Herausforderungen, die sich aus der Erweiterung des Governing Councils (GC) der EZB ergeben, und untersucht verschiedene Reformmodelle, die vorgeschlagen wurden, um die Effizienz und die Entscheidungsfindung des GC zu gewährleisten.
- Die Bedeutung der EZB und des GC für die Stabilität des Euro und der europäischen Wirtschaft
- Die Herausforderungen, die sich aus der EU-Osterweiterung für die Struktur und Funktionsweise des GC ergeben
- Die Analyse verschiedener Reformmodelle, wie z.B. Delegation/Zentralisierung, Repräsentation und Rotation
- Die Bewertung der Vor- und Nachteile der verschiedenen Reformmodelle und die Suche nach einer optimalen Lösung
- Die Bedeutung von effizienten und wirksamen Entscheidungen im GC, um die Stabilität des Euro und der europäischen Wirtschaft zu gewährleisten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausgangssituation dar, indem sie die Erweiterung der EU am 1. Mai 2004 und die bevorstehende Erweiterung der Eurozone durch die Beitrittsländer skizziert. Sie betont die Notwendigkeit einer Reform des Governing Councils der EZB angesichts der potenziellen Vergrößerung des Gremiums und der daraus resultierenden Herausforderungen für die Entscheidungsfindung. Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit der Notwendigkeit einer Reform des Governing Councils der EZB. Er beleuchtet die geschichtliche Entwicklung der EU und der Economic and Monetary Union (EMU) sowie die Institutionen, die in diesen Prozessen eine wichtige Rolle spielen. Besonderes Augenmerk liegt auf den Argumenten für und gegen eine Reform des Governing Councils, wobei insbesondere der Status Quo Bias und der Regional Bias als relevante Faktoren betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Reform der Europäischen Zentralbank (EZB), die EU-Osterweiterung, den Governing Council (GC), die Economic and Monetary Union (EMU), das European Monetary System (EMS), Delegation/Zentralisierung, Repräsentation, Rotation, Status Quo Bias, Regional Bias, Entscheidungskosten und Effizienz der Entscheidungsfindung.
Häufig gestellte Fragen
Warum war eine Reform der EZB im Zuge der Osterweiterung notwendig?
Durch den Beitritt vieler neuer Länder drohte der Governing Council zu groß und ineffizient für schnelle geldpolitische Entscheidungen zu werden.
Was ist das Problem des Missverhältnisses zwischen politischer und ökonomischer Macht?
Da jedes Mitglied eine Stimme hat, könnten kleine Länder, die nur einen geringen Teil des BIP repräsentieren, theoretisch die Mehrheit bei Abstimmungen stellen.
Was versteht man unter dem "Regional Bias"?
Der Regional Bias beschreibt das Risiko, dass Vertreter nationaler Zentralbanken eher die wirtschaftlichen Interessen ihrer eigenen Region als die der gesamten Eurozone im Blick haben.
Welche Reformmodelle werden in der Arbeit untersucht?
Untersucht werden Modelle wie Delegation/Zentralisierung, Repräsentation sowie das Rotationsprinzip für Stimmrechte.
Was ist der Governing Council der EZB?
Es ist das oberste Entscheidungsgremium der EZB, bestehend aus dem Direktorium und den Präsidenten der nationalen Zentralbanken der Euro-Länder.
Sind die Ergebnisse der Arbeit heute noch relevant?
Ja, da sich die Problematik der institutionellen Effizienz bei Erweiterungen auch auf andere EU-Organe wie die Kommission übertragen lässt.
- Quote paper
- Jörg Viebranz (Author), 2004, Die Reform der Europäischen Zentralbank im Zuge der EU-Osterweiterung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40458