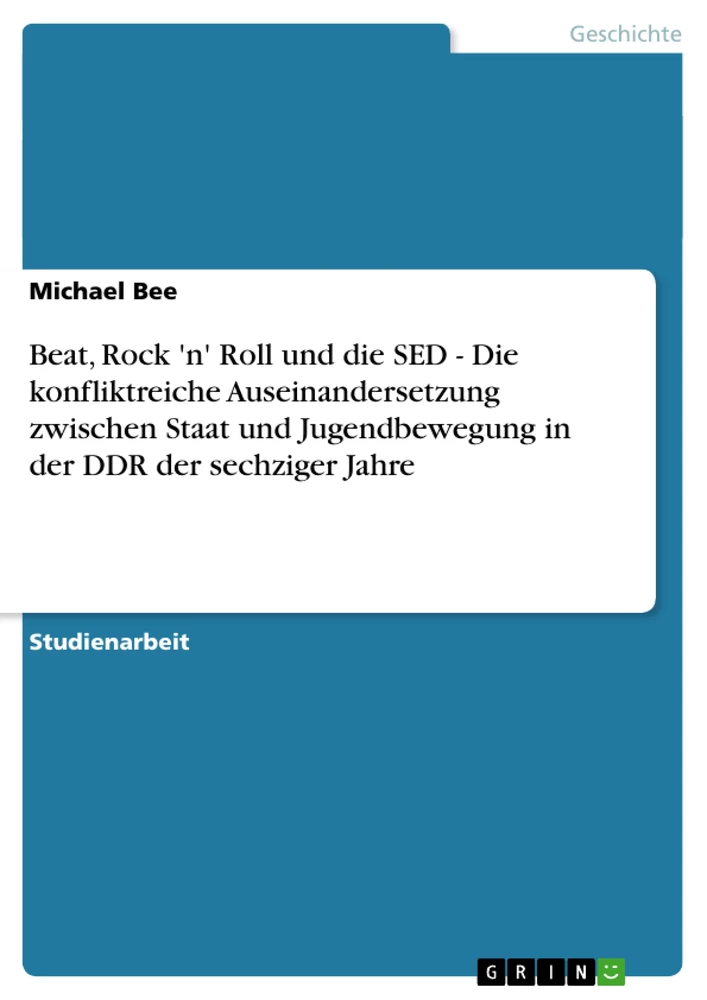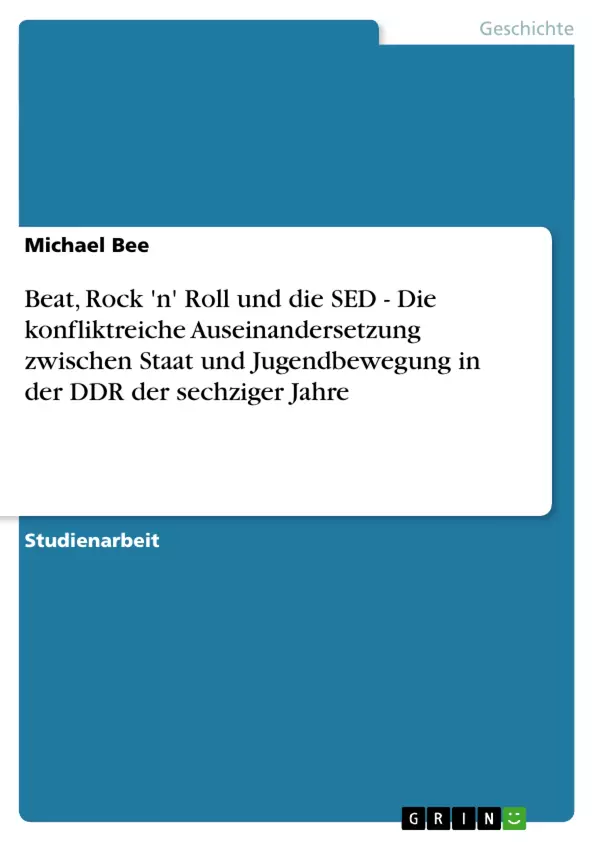Jugendbewegungen und subkulturelle Strömungen Heranwachsender erhalten ihre historische Relevanz als Indikatoren gesamtgesellschaftlicher Widersprüche und Oppositionen. Auch und gerade in der DDR der 60er lassen sich die Auswüchse jugendlichen Aufbegehrens als „Motoren sozialen Wandels“ werten. Dies scheint in der „durchherrschten Gesellschaft“ problematischer denn je, war doch „die Jugend eine zentrale Größe gesellschaftlicher Planung“. Nach dem zweiten Weltkrieg erfährt der soziologische Begriff „Generationenkonflikt“ durch das Aufkommen der Populärkultur und des Massenkonsums eine Zunahme an Komplexität – zunächst primär in westlichen Gesellschaften, letztendlich aber auch in den Staaten des Ostblocks und insbesondere in der DDR. Wie ging die SED mit dieser Problematik um? Welche Strategien entwickelte sie, um die Vorherrschaft westlicher Musik, Mode und Lebensentwürfe einzudämmen? Auf welchen Widerstand stieß die Parteiführung dabei unter den Jugendlichen? Kann der Siegeszug des Rock’n Roll in der DDR als allgemeine Liberalisierungs- und Modernisierung (um)- gedeutet werden? Welche Bedeutung spielt die konfliktreiche Auseinandersetzung zwischen Staat und Jugend in den 60er Jahren für die friedliche Revolution im Herbst 1989?
In dieser Hausarbeit möchte ich aus einer kultur- und mentalitätsgeschichtlichen Perspektive die Grenzen und Möglichkeiten ausgewählter Jugendbewegungen beleuchten. Besonderes Augenmerk werde ich dabei auf öffentliche Äußerungen, Leitlinien und Prinzipien der SED-Führung in Bezug auf jugendpolitische Entscheidungen legen – sei es anhand juristischer Anordnungen, Zeitungszitate oder ähnlichem Quellenmaterial.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Vorgeschichte: Herkunft und Entstehung alternativer Jugendbewegungen in den 50er Jahren
- Die sozialistische Pädagogik: Spagat zwischen Toleranz und Repression
- ,,Kultureller Kahlschlag“: Das vorläufige Ende einer liberalen Jugend- und Kulturpolitik
- Normalisierung und Anpassung unter den Vorzeichen des ,,Prager Frühlings"
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Konfliktlinie zwischen Jugendkultur und Staatspolitik in der DDR der sechziger Jahre. Im Fokus steht die Auseinandersetzung der SED mit den jugendlichen Strömungen, die durch westliche Musikstile, Modetrends und Lebensentwürfe beeinflusst wurden. Die Arbeit beleuchtet die Strategien der SED zur Eindämmung dieser Einflüsse und analysiert den Widerstand, der sich unter Jugendlichen entwickelte.
- Die Entstehung und Entwicklung alternativer Jugendbewegungen in der DDR der 50er und 60er Jahre.
- Die Rolle der sozialistischen Pädagogik und die jugendpolitischen Strategien der SED.
- Die kulturpolitische Wende der SED Mitte der 60er Jahre und die Maßnahmen zur Eindämmung der Jugendbewegung.
- Die Relevanz des „Prager Frühlings“ 1968 für die jugendpolitische Entwicklung in der DDR.
- Die Auswirkungen der Jugendbewegung auf den gesellschaftlichen Wandel in der DDR.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz von Jugendbewegungen als Indikatoren gesellschaftlicher Widersprüche und Oppositionen heraus, insbesondere im Kontext der DDR der 60er Jahre. Sie beleuchtet die Problematik des westlichen Einflusses auf die Jugendkultur in der DDR und die Reaktion der SED darauf.
- Vorgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung alternativer Jugendbewegungen in der DDR Ende der 50er Jahre, die durch den Einfluss angloamerikanischer Musikstile, Modetrends und Lebensentwürfe geprägt waren. Es zeigt die Faszination, die diese Strömungen auf Jugendliche ausübten und die Reaktion der SED darauf.
- Die sozialistische Pädagogik: Dieses Kapitel beschreibt die Rolle der sozialistischen Pädagogik und die jugendpolitischen Strategien der SED. Es beleuchtet die „Freie Deutsche Jugend“ (FDJ) und das ihr zugrunde liegende sozialistische Menschenbild.
- ,,Kultureller Kahlschlag“: Dieses Kapitel analysiert die kulturpolitische Wende der SED Mitte der 60er Jahre, die die kurze Phase der kulturellen Liberalisierung beendete. Es untersucht die Gefahren und Risiken, die die SED in der aufkeimenden Jugendbewegung sah, die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung und die Reaktion der Jugendlichen darauf.
- Normalisierung und Anpassung unter den Vorzeichen des ,,Prager Frühlings": Dieses Kapitel beleuchtet den „Prager Frühling“ 1968 als außenpolitischen Faktor, der die mentalitätsgeschichtliche Bedeutung der Jugendbewegung beeinflusste.
Schlüsselwörter
Jugendbewegung, DDR, SED, Kulturpolitik, Rock'n' Roll, sozialistische Pädagogik, „Prager Frühling“, Generationenkonflikt, „Kulturimperialismus“, „Kahlschlag“, Opposition, Mentalitätsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Wie reagierte die SED auf westliche Jugendkulturen?
Die Reaktion der SED schwankte zwischen zeitweiser Toleranz und massiver Repression, insbesondere während des sogenannten „kulturellen Kahlschlags“ Mitte der 60er Jahre.
Welche Rolle spielten Rock 'n' Roll und Beatmusik in der DDR?
Diese Musikstile dienten als Ausdruck jugendlichen Aufbegehrens und als Motor für sozialen Wandel, da sie westliche Lebensentwürfe in den Osten transportierten.
Was war der "kulturelle Kahlschlag"?
Es handelt sich um eine kulturpolitische Wende der SED, die liberale Tendenzen beendete und versuchte, den Einfluss westlicher Mode und Musik drastisch einzudämmen.
Welchen Einfluss hatte der "Prager Frühling" auf die DDR-Jugendpolitik?
Der Prager Frühling 1968 wirkte als außenpolitischer Faktor, der die Angst der SED vor Liberalisierung verstärkte und zu einer Phase der Normalisierung und Anpassung führte.
Was war das Ziel der sozialistischen Pädagogik in Bezug auf die Jugend?
Ziel war die Formung der Jugend nach einem sozialistischen Menschenbild, primär organisiert durch die „Freie Deutsche Jugend“ (FDJ).
- Quote paper
- Michael Bee (Author), 2004, Beat, Rock 'n' Roll und die SED - Die konfliktreiche Auseinandersetzung zwischen Staat und Jugendbewegung in der DDR der sechziger Jahre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40525