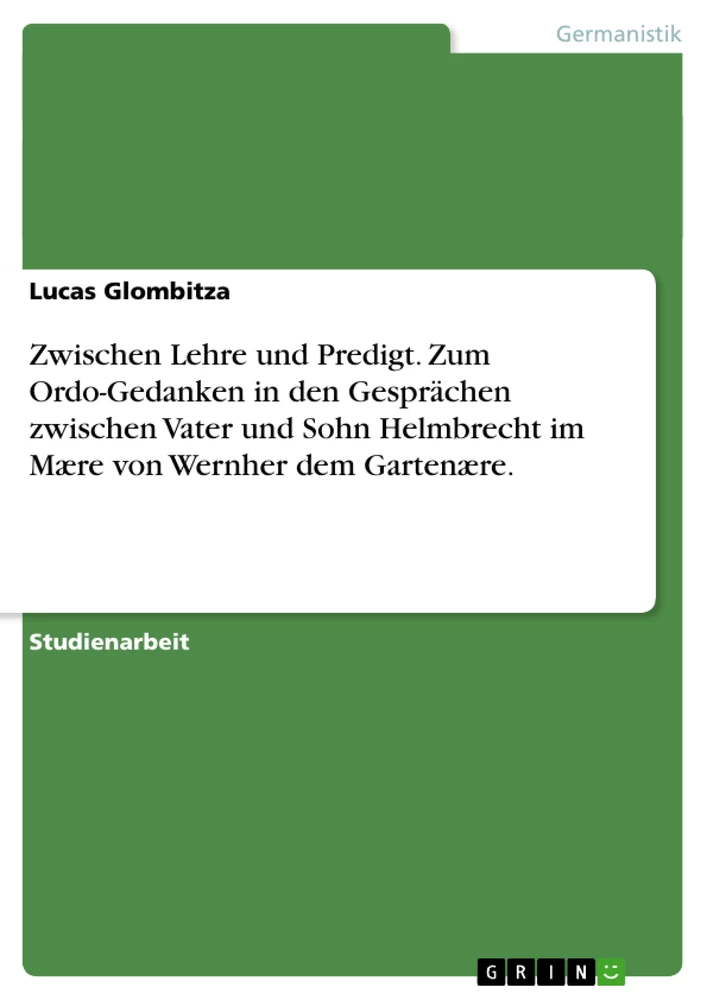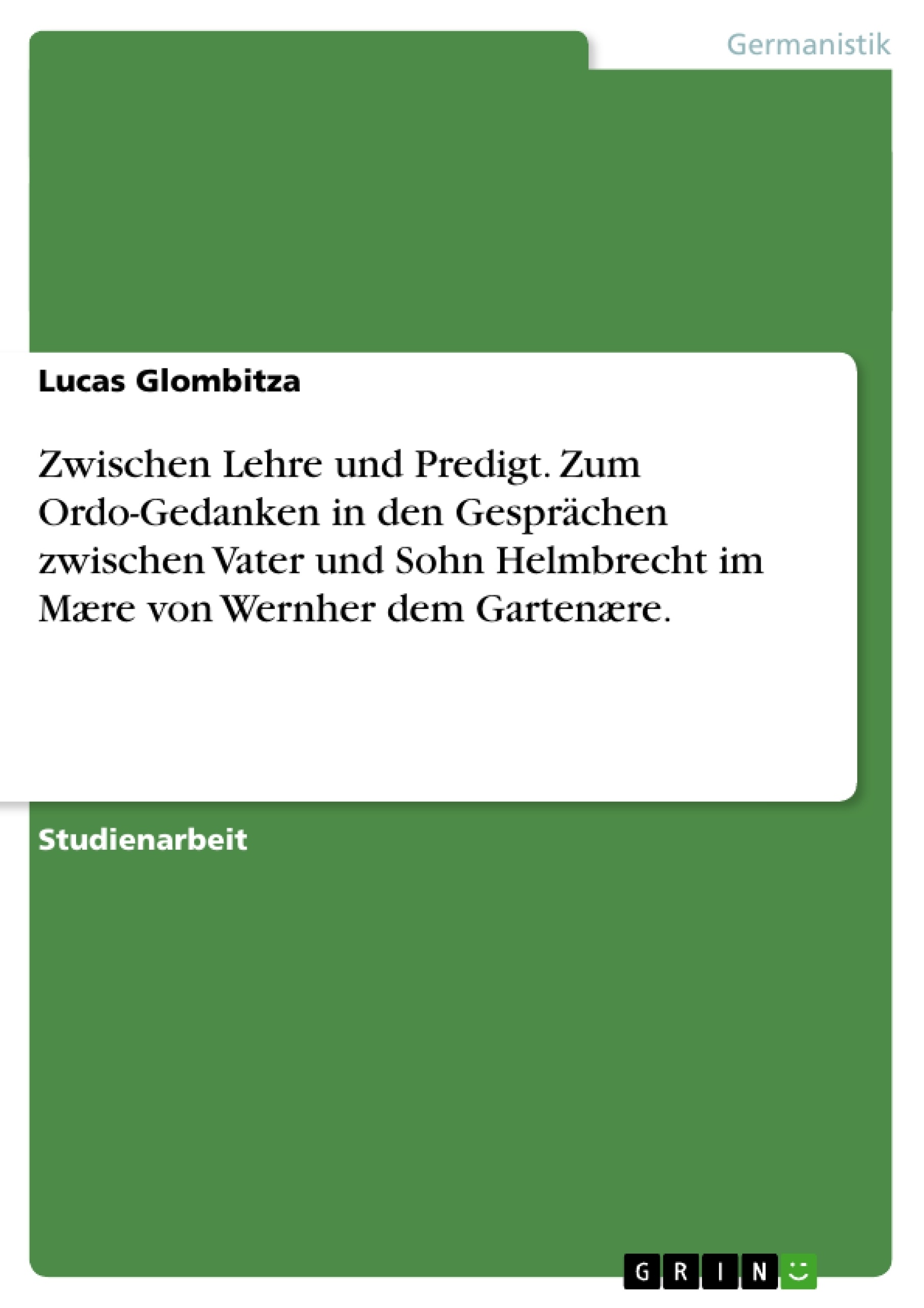[...] Die vorliegende Arbeit will die Bedeutung des Ordo-Gedanken, wie sie in den Gesprächen zwischen Vater und Sohn deutlich wird, herausarbeiten. Dazu sollen die Gespräche analysiert und interpretiert werden. Welche Rolle erfüllen beide Figuren im Hinblick auf die Lehre, die erteilt werden soll? Worin bestehen die Ordo-Verletzungen des jungen Helmbrecht und wie sind sie zu bewerten? Ist der Vater wirklich eine uneingeschränkt positive Figur, die den Gegenpol zum amoralischen Sohn bildet, oder ist er in die Kritik mit einbezogen? Das Handlungsmodell des Textes ist vom literarischen Vorbild des höfischen Romans bestimmt. Die Beutezüge Helmbrechts sind nach dem Vorbild der aventiure-Fahrten eines ritterlichen Helden gestaltet. Ohne das Modell des doppelten Cursus aus dem höfischen Roman überstrapazieren zu wollen, kann auch im „Helmbrecht“ eine Art doppelter Cursus ausgemacht werden. Der erste Cursus beschreibt die Phase vor Helmbrechts erstem Beutezug. Der zweite Cursus umfasst die Zwischenheimkehr und den zweiten Beutezug. Das Finale bildet die nach höfischem Vorbild abgehaltene Hochzeit Gotelints und Lemberslints, die dann in das eigentliche Finale, die Ergreifung der Verbrecher durch die Schergen und die Bestrafung Helmbrechts, übergeht. Diese Ähnlichkeit zum höfischen Roman ist freilich nur auf das Handlungsmodell bezogen. Inhaltlich findet geradezu eine Verkehrung des höfischen Romans statt. Helmbrecht sucht auf seiner „aventiure-Fahrt“ nicht den Kampf mit Rittern und ehrwürdigen Gegnern, sondern vergeht sich an Witwen und Waisen (1463ff.) sowie Frauen (677f.) und Kindern (1853ff.), also an jenen Gruppen, die in besonderer Weise unter dem Schutz der Waffentragenden stehen. Es gibt je nach Auffassung zwei oder vier Gespräche zwischen Vater und Sohn Helmbrecht. Das Gespräch vor dem Beutezug und das Gespräch bei der Zwischenheimkehr Helmbrechts kann jeweils in zwei Teile gegliedert werden. Der zweite Teil des Gesprächs stellt jedes Mal den Versuch des Vaters dar, den Sohn doch noch von seinem Vorhaben abzuhalten, zu einem Zeitpunkt, als dieser sich bereits zum Gehen gewandt hat. Die vorliegende Arbeit geht von vier Gesprächen zwischen Vater und Sohn aus. Ihre Analyse und Interpretation erfolgt in den Kapiteln 2.1. bis 2.4. Im Kapitel 2.2. findet anhand des Textes ein kurzer Exkurs zur Beziehung des Mære zur franziskanischen Predigt, wie sie von Berthold von Regensburg überliefert ist, statt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Vorgedanken
- 2. Analyse und Interpretation der Gespräche zwischen Vater und Sohn
- 2.1. ordenunge kontra girischeit – Das erste Gespräch (226 - 388)
- 2.2. Vom rehten und unrehten tuon - Das zweite Gespräch (408 - 645)
- 2.3. Der Topos von der „guten alten Zeit“ – Das dritte Gespräch (904 – 1040)
- 2.4. Gewalt als Ordo-Verletzung – Das vierte Gespräch (1078 - 1292)
- 3. Die Mahnung zur ordenunge - ein Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Ordo-Gedanken im Mære vom Meier Helmbrecht von Wernher dem Gartenære, insbesondere in den Gesprächen zwischen Vater und Sohn. Ziel ist die Analyse und Interpretation dieser Gespräche, um die Rolle beider Figuren im Hinblick auf die vermittelte Lehre zu beleuchten und die Ordo-Verletzungen Helmbrechts zu bewerten. Die Arbeit hinterfragt auch die vermeintlich positive Darstellung des Vaters.
- Der mittelalterliche Ordo-Gedanke und seine Verletzung durch Helmbrecht.
- Die didaktische Funktion der Gespräche zwischen Vater und Sohn.
- Die Charakterisierung des Vaters und seine Rolle in der Erziehung seines Sohnes.
- Die Verbindung des Mære zur franziskanischen Predigt.
- Das Handlungsmodell des Textes im Vergleich zum höfischen Roman.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Vorgedanken: Die Einleitung situiert Wernhers Mære vom Meier Helmbrecht historisch und literarisch. Sie betont den mittelalterlichen Ordo-Gedanken als zentrales Thema und die Debatte um den Text als Lehr- und Mahndichtung. Die Arbeit fokussiert auf die Gespräche zwischen Vater und Sohn, analysiert deren Bedeutung für den Ordo-Gedanken und hinterfragt die Rolle beider Figuren. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und erwähnt die methodische Herangehensweise, wobei die Grenzen des Projekts klar definiert werden, z.B. die Aussparung einer detaillierten Analyse der Träume des Vaters.
2. Analyse und Interpretation der Gespräche zwischen Vater und Sohn: Dieses Kapitel analysiert die vier Gespräche zwischen Vater und Sohn Helmbrecht. Es untersucht die jeweiligen Konflikte, die Verletzung der Ordnung und die didaktische Absicht des Autors. Der Fokus liegt auf der Gegenüberstellung von „ordenunge“ und „girischeit“, dem „rechten“ und „unrechten Tun“, der Sehnsucht nach der „guten alten Zeit“ und der Gewalt als ultimative Ordo-Verletzung. Die Analyse berücksichtigt die literarischen Vorbilder, insbesondere den höfischen Roman, und setzt die Gespräche in den Kontext der franziskanischen Predigt.
Häufig gestellte Fragen zum Mære vom Meier Helmbrecht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Ordo-Gedanken im Mære vom Meier Helmbrecht von Wernher dem Gartenære, insbesondere in den Gesprächen zwischen Vater und Sohn. Sie untersucht die Rolle beider Figuren im Hinblick auf die vermittelte Lehre und bewertet die Ordo-Verletzungen Helmbrechts. Die Arbeit hinterfragt auch die vermeintlich positive Darstellung des Vaters.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den mittelalterlichen Ordo-Gedanken und seine Verletzung durch Helmbrecht, die didaktische Funktion der Vater-Sohn-Gespräche, die Charakterisierung des Vaters und seine Rolle in der Erziehung, die Verbindung des Mære zur franziskanischen Predigt und das Handlungsmodell des Textes im Vergleich zum höfischen Roman.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus drei Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung und Vorgedanken) situiert den Text historisch und literarisch und beschreibt die methodische Herangehensweise. Kapitel 2 (Analyse und Interpretation der Gespräche zwischen Vater und Sohn) analysiert vier Gespräche zwischen Vater und Sohn, untersucht die Konflikte, die Ordnungverletzungen und die didaktische Absicht. Kapitel 3 (Die Mahnung zur ordenunge - ein Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Gespräche zwischen Vater und Sohn werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf vier Gespräche zwischen Vater und Sohn: das erste Gespräch (Zeilen 226-388) mit dem Fokus auf „ordenunge“ kontra „girischeit“, das zweite Gespräch (Zeilen 408-645) zum Thema „rechtes“ und „unrechtes Tun“, das dritte Gespräch (Zeilen 904-1040) zum Topos der „guten alten Zeit“ und das vierte Gespräch (Zeilen 1078-1292) mit Gewalt als Ordo-Verletzung.
Welche methodische Herangehensweise wird verwendet?
Die Arbeit verwendet eine literaturwissenschaftliche Methode, die die Gespräche zwischen Vater und Sohn im Kontext des mittelalterlichen Ordo-Gedankens, der franziskanischen Predigt und des höfischen Romans analysiert und interpretiert. Die Grenzen des Projekts werden klar definiert, z.B. wird eine detaillierte Analyse der Träume des Vaters ausgeschlossen.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse der Vater-Sohn-Gespräche zusammen und beleuchtet die Bedeutung des Ordo-Gedankens im Mære vom Meier Helmbrecht als Lehr- und Mahndichtung. Es wird die didaktische Funktion des Textes und die Rolle der Figuren im Hinblick auf die vermittelte Lehre herausgearbeitet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Mære vom Meier Helmbrecht, Wernher der Gartenære, Ordo-Gedanke, mittelalterliche Literatur, Vater-Sohn-Beziehung, Didaktik, Franziskanische Predigt, höfischer Roman, Ordnung, Gewalt, „ordenunge“, „girischeit“, „rechtes Tun“, „unrechtes Tun“.
- Citar trabajo
- Lucas Glombitza (Autor), 2004, Zwischen Lehre und Predigt. Zum Ordo-Gedanken in den Gesprächen zwischen Vater und Sohn Helmbrecht im Mære von Wernher dem Gartenære., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40542