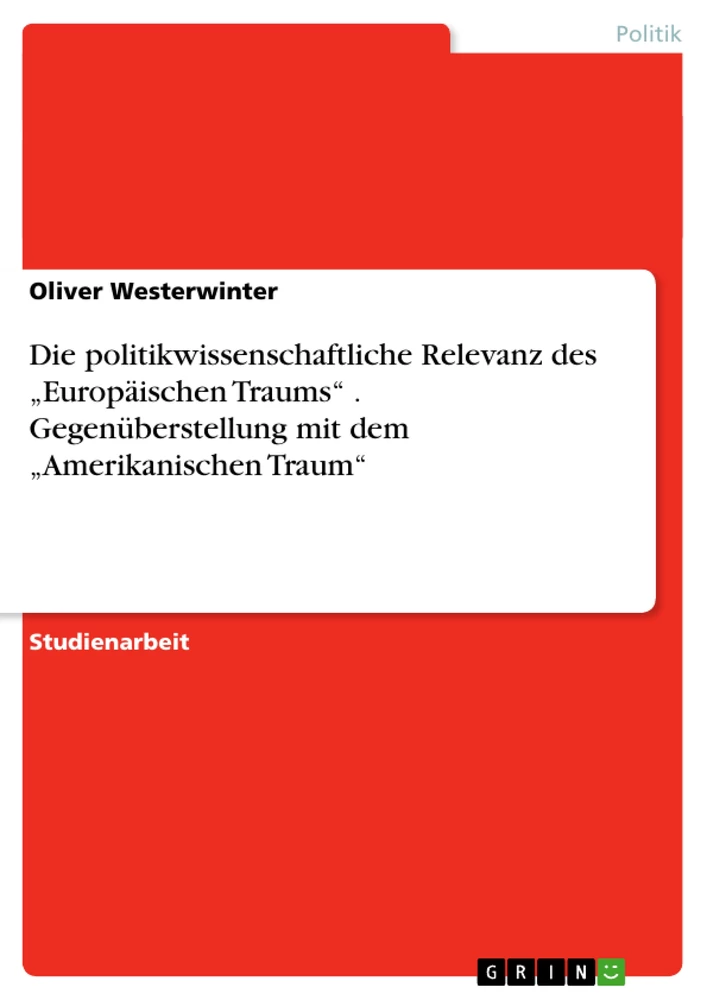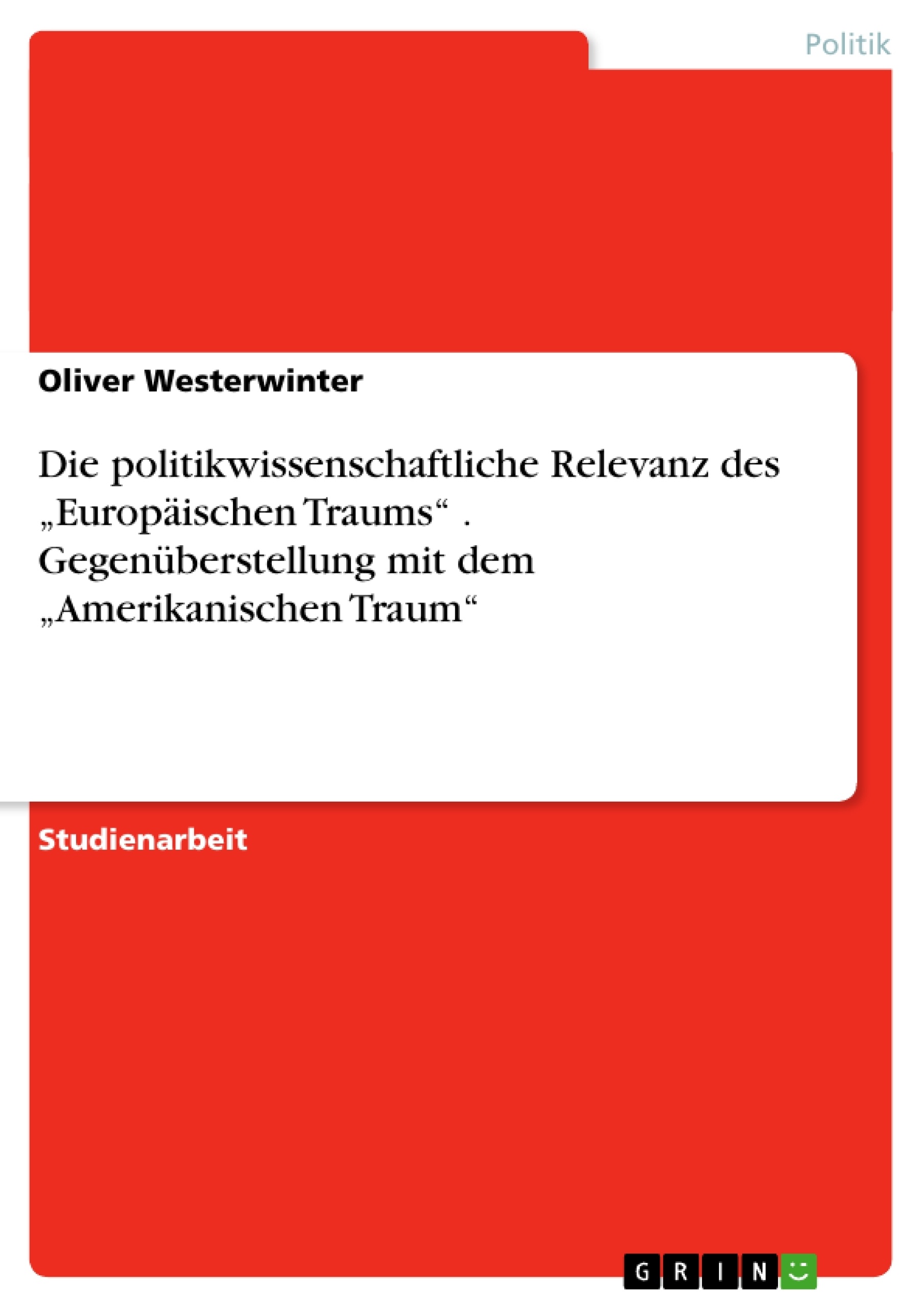Zu Beginn des 21. Jahrhunderts läßt sich die Welt als eine Pluralität der sich auf verschiedenen Ebenen manifestierenden Risiken, Vielfalten und Interdependenz-zusammenhänge charakterisieren. Die jeweiligen Manifestationsebenen können subnationaler und nationaler, aber auch – und dieses trifft zunehmend zu – transnationaler und globaler Art sein. Eine auf diese Weise zu charakterisierende Welt läßt den Begriff des Politischen, als dessen Kern die „Herstellung kollektiv verbindlicher Entscheidungen“ verstanden werden kann , zunehmend als problematisch erscheinen. Diese Problematik des Begriffs des Politischen resultiert vor allem aus dem Gleichsetzen des Politischen mit dem Staat, der als zentraler Ort des Herstellens kollektiv verbindlicher Entscheidungen angesehen wird. Der Staat – verstanden als Nationalstaat – wird zu einem wesentlichen Teil territorial definiert , so daß der auf den Staat bezogene Begriff des Politischen ebenfalls einen territorial-exklusiven und daher in einer in vielfältiger Hinsicht sich pluralisierenden Welt anachronistischen Charakter aufweist. Der „Amerikanische Traum“ beziehungsweise das Konzept, welches sich aus diesem extrahieren läßt, kann als ein Vehikel für diese territorial-exlkusive und vertikal-hierarchisch gefaßte Variante des Begriffs des Politischen verstanden werden. In einer sich pluralisierenden Welt büßt jedoch der Nationalstaat auf subnationaler und nationaler sowie in gewisser Weise auch auf transnationaler und globaler Ebene kontinuierlich Steuerungspotential ein und Grenzen als Demarkationslinien nationalstaatlicher Exklusivität verlieren zunehmend an Bedeutung. Daher scheint das Konzept des „Amerikanischen Traums“ und mit diesem die skizzierte Variante des Begriffs des Politischen als problematisch. Nach Jeremy Rifkin läßt sich am Anfang des 21. Jahrhunderts das Heraufdämmern eines zwar noch diffusen „Europäische(n) Traum(s)“ , welcher ebenfalls in Form eines Konzeptes systematisiert werden kann, als eine potentielle Alternative zum „Amerikanischen Traum“ konstatieren. Rifkin zufolge scheint dieses europäische Konzept eher als sein amerikanisches Pendant mit der Welt des beginnenden 21. Jahrhunderts kompatibel.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ein politikwissenschaftlicher Zugang zu „Träumen“ - einige begriffstheoretische Vorüberlegungen
- Das Konzept des „Amerikanischen“ und das des „Europäischen Traums“ im Vergleich – Darstellung, Kritik und politikwissenschaftliche Relevanz
- Das Konzept des „Amerikanischen Traums“ – Versuch einer Skizze
- Das Konzept des „Europäischen Traums“ – Versuch einer Skizze
- Eine kritische Betrachtung der politikwissenschaftlichen Relevanz der Rifkin´schen „Traumgegenüberstellung“ – einige Schlaglichter
- Die dem amerikanischen und europäischen Konzept jeweils inhärenten Umrisse einer Variante des Begriffs des Politischen
- Kontinuität im Wandel – eine veränderte Modalität des Politischen und neue Probleme?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept des „Europäischen Traums“ und dessen möglicher Relevanz für die Politikwissenschaft. Die Analyse basiert auf einer Gegenüberstellung des „Amerikanischen“ und des „Europäischen Traums“, die im Werk von Jeremy Rifkin dargestellt wird. Die Arbeit untersucht, inwieweit das europäische Konzept als Vehikel einer spezifischen Variante des Begriffs des Politischen verstanden werden kann und wie sich diese Variante von der im „Amerikanischen Traum“ verankerten unterscheidet.
- Der Wandel des Begriffs des Politischen im Kontext von Globalisierung und Interdependenz
- Die Rolle des Nationalstaates in einer sich pluralisierenden Welt
- Der „Europäische Traum“ als mögliches Vehikel eines sich verändernden Begriffs des Politischen
- Vergleichende Analyse des „Amerikanischen“ und des „Europäischen Traums“
- Die politikwissenschaftliche Relevanz der Rifkin´schen „Traumgegenüberstellung“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Begriffs des Politischen im Kontext einer sich pluralisierenden Welt dar. Sie argumentiert, dass das traditionelle, staatliche Verständnis des Politischen an Grenzen stößt und das Konzept des „Amerikanischen Traums“ als ein Vehikel für diese territorial-exklusive Variante des Begriffs des Politischen verstanden werden kann.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der begriffstheoretischen Vorüberlegung, wie kollektive „Träume“ aus politikwissenschaftlicher Perspektive analysiert werden können. Der Autor argumentiert, dass es notwendig ist, diese „Träume“ auf ihren wesentlichen Gehalt zu reduzieren und sie als Konzepte zu verstehen.
Das dritte Kapitel analysiert sowohl das Konzept des „Amerikanischen Traums“ als auch das des „Europäischen Traums“ separat. Die Analyse beinhaltet eine kritische Betrachtung der beiden Konzepte und einen Vergleich der aus ihnen extrahierbaren Begriffe des Politischen.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Frage, inwieweit das Konzept des „Europäischen Traums“ als Vehikel einer sich partiell verändernden Variante des Begriffs des Politischen verstanden werden kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe des „Amerikanischen“ und des „Europäischen Traums“ als Konzepte, die unterschiedliche Varianten des Begriffs des Politischen repräsentieren. Im Fokus steht die Analyse der sich verändernden Bedeutung des Politischen im Kontext von Globalisierung, Interdependenz und Pluralisierung der Welt. Weitere zentrale Themen sind die Rolle des Nationalstaates, das Verhältnis von Staat und Gesellschaft sowie die Frage der „Herstellung kollektiv verbindlicher Entscheidungen“ in einer komplexen und vernetzten Welt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der "Europäische Traum" nach Jeremy Rifkin?
Rifkin beschreibt ihn als ein Konzept, das stärker auf globale Interdependenz, Nachhaltigkeit und Lebensqualität setzt, im Gegensatz zum individualistischen "Amerikanischen Traum".
Warum gilt der Nationalstaat heute als problematisch für das "Politische"?
In einer globalisierten Welt verliert der territorial definierte Nationalstaat an Steuerungspotenzial, da politische Entscheidungen zunehmend transnationale Ebenen betreffen.
Wie unterscheidet sich der amerikanische vom europäischen Begriff des Politischen?
Der amerikanische Traum steht oft für eine territorial-exklusive und hierarchische Variante, während das europäische Konzept eher mit einer vernetzten, pluralistischen Welt kompatibel scheint.
Was ist die politikwissenschaftliche Relevanz dieser "Träume"?
Die Analyse zeigt, wie kollektive Visionen als Konzepte für die Herstellung verbindlicher Entscheidungen und die Organisation von Gesellschaften dienen können.
Welchen Einfluss hat die Globalisierung auf diese Konzepte?
Die Globalisierung führt dazu, dass Grenzen an Bedeutung verlieren und neue Modalitäten des Politischen notwendig werden, die über nationale Exklusivität hinausgehen.
- Quote paper
- Oliver Westerwinter (Author), 2005, Die politikwissenschaftliche Relevanz des „Europäischen Traums“ . Gegenüberstellung mit dem „Amerikanischen Traum“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40571