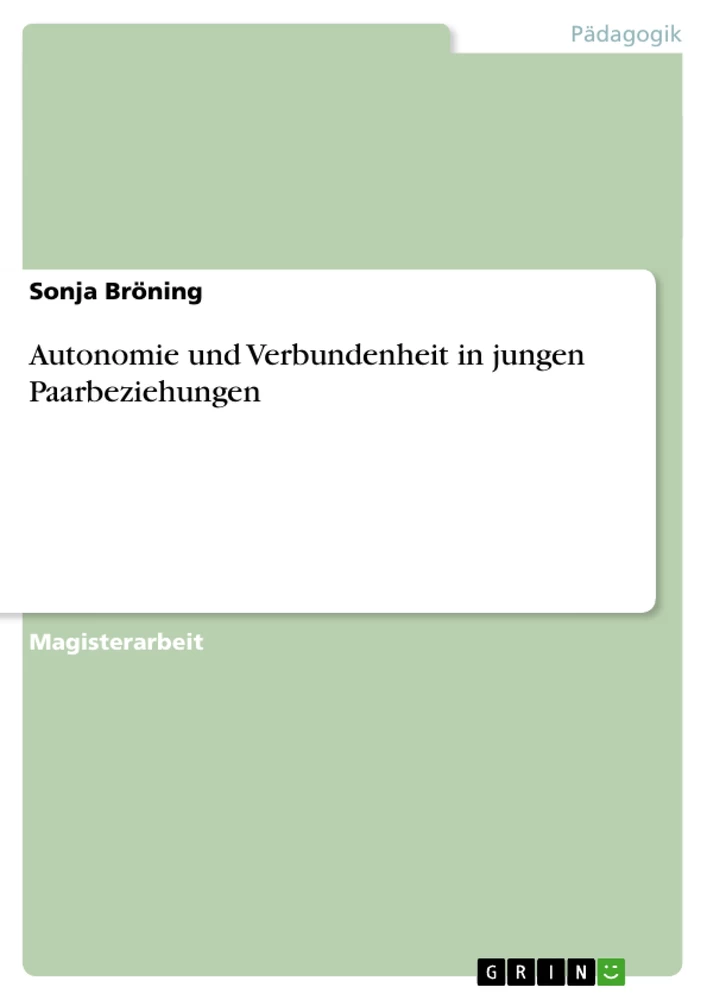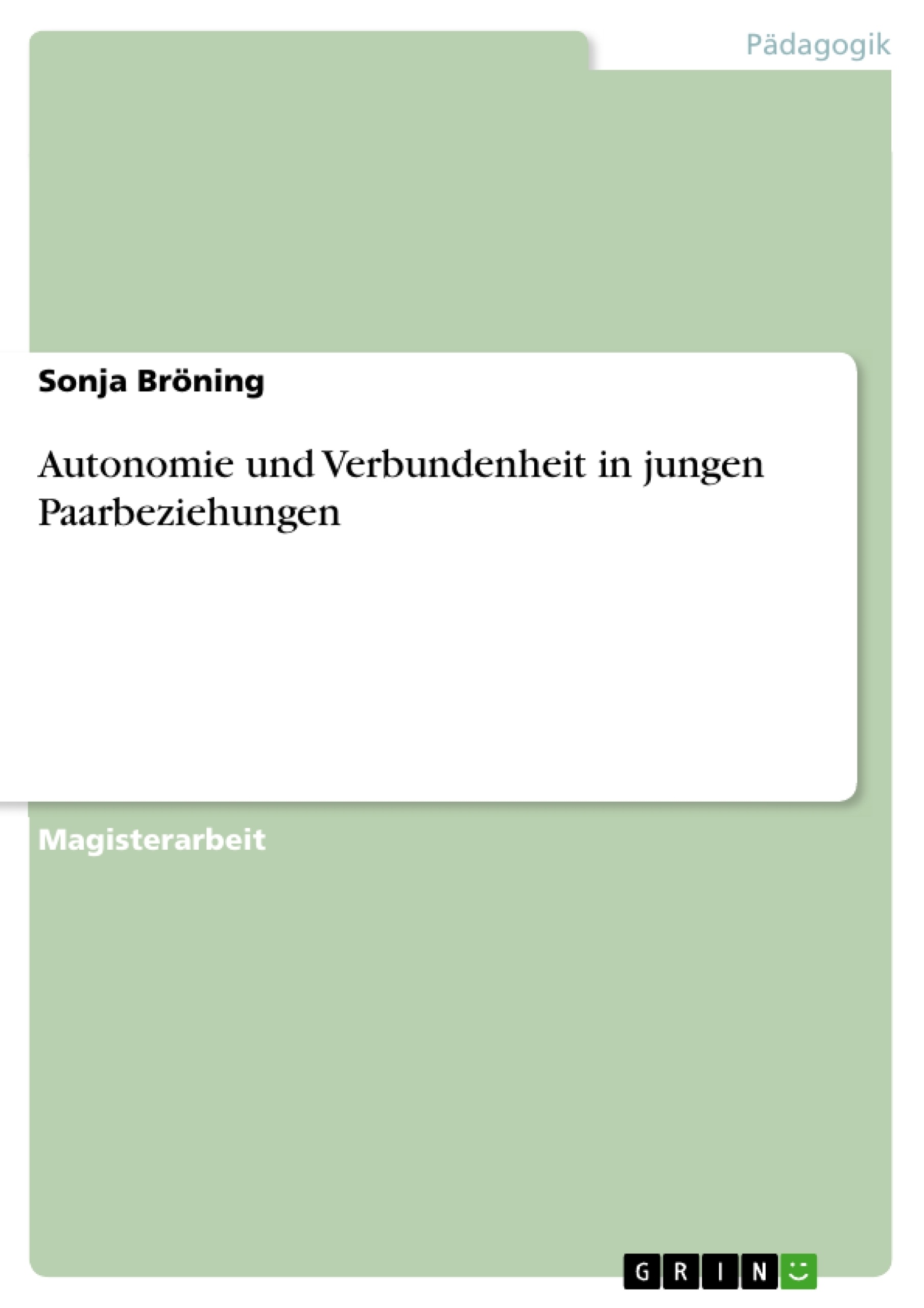Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Balance von Autonomie und Verbundenheit in Liebesbeziehungen. Bedürfnisse nach Autonomie und Verbundenheit sind zu einem großen Teil durch die Beziehungserfahrungen eines Menschen im Lebensverlauf geprägt. Dies wird in dieser Arbeit vor dem Hintergrund der Bindungstheorie beleuchtet. In Liebesbeziehungen stehen Bedürfnisse nach Autonomie und Verbundenheit in einer dialektischen Beziehung zueinander und müssen daher immer wieder in eine Balance gebracht werden. Dies geschieht innerhalb der partnerschaftlichen Kommunikation und Interaktion. Es wird der aktuelle Forschungsstand zur partnerschaftlichen Interaktion dargestellt.
In Konfliktsituationen zeigt sich, ob die Partner ihre Autonomie wahren können, indem die eigene Meinung sowie Bedürfnisse und Wünsche klar geäußert werden, und gleichzeitig die Verbundenheit zum Partner aufrechterhalten können. Daher wird die Interaktion einer Stichprobe von 38 jungen Paaren im Rahmen eines Konfliktgesprächs beobachtet, und es werden Autonomie und Verbundenheit fördernde und verhindernde Verhaltensweisen identifiziert. Es wird untersucht, ob diese Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Persönlichkeitsvariablen wie Selbstwert und Depressivität, mit der Einschätzung des Konfliktstils beider Partner und mit der aktuellen Beziehungsrepräsentation und der Beziehungszufriedenheit stehen.
Insgesamt bewährte sich das „Autonomy and Relatedness Coding System“ (Allen, 1995), das in übersetzter und überarbeiteter Form (Becker-Stoll et al., 1996) erstmals auf Paarinteraktionen angewandt wurde. Durch die Verhaltensbeobachtung konnte aufgezeigt werden, an welchen Stellen die Selbstwahrnehmung der Probanden hinsichtlich ihres Konfliktstils hinter der Fremdbeurteilung durch den Partner zurück blieb. Frauen schätzten ihre verbale Aggressivität, Männer ihre Fähigkeit zu konstruktivem Problemlösen falsch ein. Weiterhin belegen die Ergebnisse den transaktionalen Charakter von Beziehungsrepräsentationen und Verhaltensweisen in der Interaktion, der sich in Bezug auf Frauen und Männer unterscheidet. Der Selbstwert der Probanden moderierte den Zusammenhang zwischen Beziehungsrepräsentation und Verhalten. Dies weist auf die Vielfältigkeit der Einflüsse von inneren Arbeitsmodellen und Kognitionen auf das Verhalten in der Interaktion hin.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Autonomie und Verbundenheit – Theoretischer Rahmen
- 2.1 Die Partnerschaftsforschung
- 2.1.1 Junge Paarbeziehungen als Forschungsgegenstand
- 2.1.2 Einflussfaktoren auf Verläufe von Liebesbeziehungen
- 2.2 Bindung in Liebesbeziehungen
- 2.2.1 Grundzüge der Bindungstheorie
- 2.2.2 Bindung im Erwachsenenalter
- 2.2.3 Liebesbeziehungen als Bindungsbeziehungen
- 2.2.4 Auswirkung von Beziehungrepräsentationen auf Liebesbeziehungen
- 2.3 Autonomiebedürfnis und Autonomieentwicklung
- 2.3.1 Das Konzept der Autonomie und sein Bezug zur Bindung
- 2.3.3 Autonomieentwicklung im Jugendalter
- 2.3.4 Autonomie und Verbundenheit in Liebesbeziehungen
- 2.4 Zusammenfassung: Autonomie und Verbundenheit in Paarbeziehungen
- 3. Autonomie und Verbundenheit in der Interaktion
- 3.1 Kommunikation und Konflikt in der Partnerschaft
- 3.2 Die Beobachtung von Paarinteraktionen
- 3.2.1 Die Methode der Interaktionsbeobachtung
- 3.2.2 Befunde der Interaktionsbeobachtung von Paaren
- 3.3 Paarbeobachtung im Kontext von Autonomie und Bindung
- 3.3.1 Eine Theorie - viele Beobachtungsansätze
- 3.3.2 Beobachtung von nicht-bindungsspezifischen Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Bindungsrepräsentation
- 3.3.3 Beobachtung von bindungsspezifischen Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Bindungsrepräsentation
- 3.4 Zusammenfassung: Autonomie und Verbundenheit in der Paarinteraktion
- 4. Fragestellung und Methode
- 4.1 Konkretisierung der Fragestellung
- 4.2 Stichprobe und Datenerhebung
- 4.3 Erhebungsinstrumente
- 4.3.1 Skalen aus den Fragebögen der Intensivstudie
- 4.3.2 Beobachtungsdaten zu Autonomie und Verbundenheit in der Interaktion
- 4.4 Verfahren der Datenanalyse
- 5. Ergebnisse
- 5.1 Einführende Analysen
- 5.1.1 Statistische Kennwerte und Interkorrelationen der Beobachtungsskalen bei jeweils Männern und Frauen (Fragestellung 1)
- 5.1.2 Interkorrelationen der Beobachtungsskalen zwischen Männern und Frauen und geschlechtsspezifische Unterschiede (Fragestellung 2)
- 5.2 Beobachtetes Verhalten, Persönlichkeitsvariablen und Beziehungszufriedenheit (Fragestellung 3 und 4)
- 5.3 Beobachtetes Verhalten und Einschätzung der Konfliktstile (Fragestellung 5)
- 5.4 Beobachtetes Verhalten und Beziehungsrepräsentation
- 5.4.1 Zusammenhang zwischen Beziehungsrepräsentation und Verhalten (Fragestellung 6)
- 5.4.2 Zusammenhang zwischen Selbstwert, Beziehungsrepräsentation und Verhalten (Fragestellung 7)
- 6. Diskussion
- 6.1 Diskussion der Befunde zu den Beobachtungsdaten allgemein
- 6.2 Diskussion der Befunde zu den Persönlichkeitsvariablen, der Paarzufriedenheit und den Konfliktstilen
- 6.3 Diskussion der Befunde zur Beziehungsrepräsentation
- 6.4 Abschließende Evaluation
- 7. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die komplexe Interaktion von Autonomie und Verbundenheit in Paarbeziehungen junger Erwachsener. Ziel ist es, das Zusammenspiel dieser beiden zentralen Bedürfnisse in der partnerschaftlichen Kommunikation und im Konfliktverhalten zu analysieren. Die Studie verknüpft theoretische Überlegungen der Bindungstheorie mit empirischen Befunden aus der Paarinteraktionsforschung.
- Autonomiebedürfnis und -entwicklung in jungen Paarbeziehungen
- Zusammenhang zwischen Bindungsstilen und Interaktionsverhalten
- Auswirkungen von Autonomie und Verbundenheit auf die Beziehungszufriedenheit
- Konfliktlösungsstile und deren Beziehung zu Autonomie und Verbundenheit
- Rolle von Beziehungsrepräsentationen im Kontext von Autonomie und Verbundenheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Magisterarbeit ein und erläutert die Relevanz der Untersuchung von Autonomie und Verbundenheit in Paarbeziehungen junger Erwachsener. Es skizziert den Forschungsstand und die Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen. Die Arbeit knüpft an die zentrale Fragestellung an, wie sich Autonomie und Verbundenheit in der Interaktion von Paaren manifestieren und welche Bedeutung sie für die Beziehungsqualität haben.
2. Autonomie und Verbundenheit – Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel liefert den theoretischen Hintergrund der Arbeit. Es beleuchtet die Partnerschaftsforschung, insbesondere im Fokus auf junge Paarbeziehungen und die Einflussfaktoren auf deren Entwicklung. Die Bindungstheorie wird als zentrales Erklärungsmodell eingeführt, ihre Grundzüge erläutert und auf das Erwachsenenalter sowie Liebesbeziehungen angewendet. Das Konzept der Autonomie und seine Beziehung zur Bindung wird detailliert diskutiert, inklusive der Autonomieentwicklung im Jugendalter und deren Einfluss auf Liebesbeziehungen. Der Fokus liegt auf der theoretischen Verknüpfung von Autonomie und Verbundenheit als komplementäre Bedürfnisse in partnerschaftlichen Beziehungen.
3. Autonomie und Verbundenheit in der Interaktion: Dieses Kapitel befasst sich mit der empirischen Erforschung von Autonomie und Verbundenheit in der Paarinteraktion. Es beschreibt die Methodik der Interaktionsbeobachtung und präsentiert Befunde aus bisherigen Studien. Es wird ein detaillierter Überblick über verschiedene Beobachtungsansätze gegeben, sowohl bindungsspezifische als auch nicht-bindungsspezifische Verhaltensweisen werden im Zusammenhang mit Bindungsrepräsentationen analysiert. Das Kapitel betont die Herausforderungen und Chancen der Beobachtungsmethodik im Kontext von Autonomie und Bindung.
4. Fragestellung und Methode: Dieses Kapitel konkretisiert die Forschungsfragen der Arbeit und beschreibt detailliert die angewandte Methodik. Es erläutert die Stichprobenauswahl, die Datenerhebungsmethoden und die verwendeten Erhebungsinstrumente, inklusive Fragebögen und Beobachtungsinstrumenten. Die Verfahren der Datenanalyse werden ebenfalls ausführlich dargestellt, um die wissenschaftliche Fundiertheit der Studie zu gewährleisten.
5. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es werden statistische Analysen vorgestellt, die die Zusammenhänge zwischen beobachtetem Verhalten, Persönlichkeitsvariablen, Beziehungszufriedenheit, Konfliktstilen und Beziehungsrepräsentationen beleuchten. Die Ergebnisse werden im Detail erläutert und im Kontext der Forschungsfragen interpretiert.
Schlüsselwörter
Autonomie, Verbundenheit, Paarbeziehung, junge Erwachsene, Bindungstheorie, Interaktionsbeobachtung, Beziehungszufriedenheit, Konfliktlösung, Beziehungsrepräsentation, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Autonomie und Verbundenheit in Paarbeziehungen junger Erwachsener
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die komplexe Interaktion von Autonomie und Verbundenheit in Paarbeziehungen junger Erwachsener. Der Fokus liegt auf dem Zusammenspiel dieser beiden zentralen Bedürfnisse in der partnerschaftlichen Kommunikation und im Konfliktverhalten. Die Studie verknüpft theoretische Überlegungen der Bindungstheorie mit empirischen Befunden aus der Paarinteraktionsforschung.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich maßgeblich auf die Bindungstheorie, um Autonomie und Verbundenheit in Liebesbeziehungen zu erklären. Es werden die Grundzüge der Bindungstheorie erläutert und auf das Erwachsenenalter sowie Liebesbeziehungen angewendet. Das Konzept der Autonomie und seine Beziehung zur Bindung wird detailliert diskutiert, inklusive der Autonomieentwicklung im Jugendalter und deren Einfluss auf Liebesbeziehungen.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet eine Kombination aus Fragebögen und Interaktionsbeobachtung. Die Interaktionsbeobachtung dient der empirischen Erforschung von Autonomie und Verbundenheit in der Paarinteraktion. Es werden verschiedene Beobachtungsansätze beschrieben, sowohl bindungsspezifische als auch nicht-bindungsspezifische Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Bindungsrepräsentationen analysiert. Die Datenanalyse umfasst statistische Verfahren, um Zusammenhänge zwischen beobachtetem Verhalten, Persönlichkeitsvariablen, Beziehungszufriedenheit, Konfliktstilen und Beziehungsrepräsentationen aufzuzeigen.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht verschiedene Forschungsfragen, darunter: Wie manifestieren sich Autonomie und Verbundenheit in der Interaktion von Paaren? Welche Bedeutung haben sie für die Beziehungsqualität? Wie hängen Bindungsstile mit Interaktionsverhalten zusammen? Welche Auswirkungen haben Autonomie und Verbundenheit auf die Beziehungszufriedenheit? Welche Rolle spielen Konfliktlösungsstile und Beziehungsrepräsentationen im Kontext von Autonomie und Verbundenheit?
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Das Kapitel "Ergebnisse" präsentiert statistische Analysen, die die Zusammenhänge zwischen beobachtetem Verhalten, Persönlichkeitsvariablen, Beziehungszufriedenheit, Konfliktstilen und Beziehungsrepräsentationen beleuchten. Die Ergebnisse werden detailliert erläutert und im Kontext der Forschungsfragen interpretiert. Konkrete Befunde zu den Zusammenhängen zwischen Beziehungsrepräsentation und Verhalten, Selbstwert, Beziehungsrepräsentation und Verhalten sowie zu geschlechtsspezifischen Unterschieden werden dargestellt.
Welche Stichprobe wurde untersucht?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Stichprobenauswahl, die im Kapitel "Fragestellung und Methode" erläutert wird. Informationen zur Größe und den Charakteristika der Stichprobe (z.B. Alter, Geschlecht) sind dort zu finden.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Theoretischer Rahmen (Autonomie und Verbundenheit), Autonomie und Verbundenheit in der Interaktion, Fragestellung und Methode, Ergebnisse, Diskussion und Ausblick. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis findet sich im HTML-Code der Arbeit.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe der Arbeit sind: Autonomie, Verbundenheit, Paarbeziehung, junge Erwachsene, Bindungstheorie, Interaktionsbeobachtung, Beziehungszufriedenheit, Konfliktlösung, Beziehungsrepräsentation und Kommunikation.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler*innen, die sich mit Paarbeziehungen, Bindungstheorie und Paarinteraktion beschäftigen. Sie liefert einen Beitrag zum Verständnis der komplexen Interaktion von Autonomie und Verbundenheit in jungen Paarbeziehungen und kann für weitere Forschung in diesem Bereich genutzt werden.
- Arbeit zitieren
- Sonja Bröning (Autor:in), 2005, Autonomie und Verbundenheit in jungen Paarbeziehungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40680