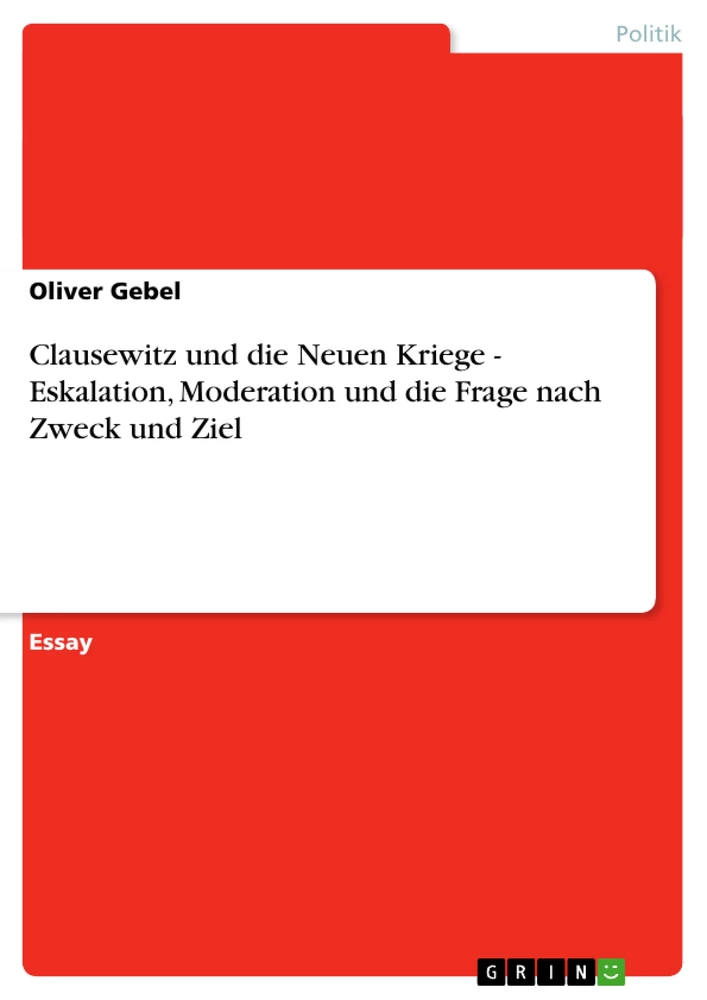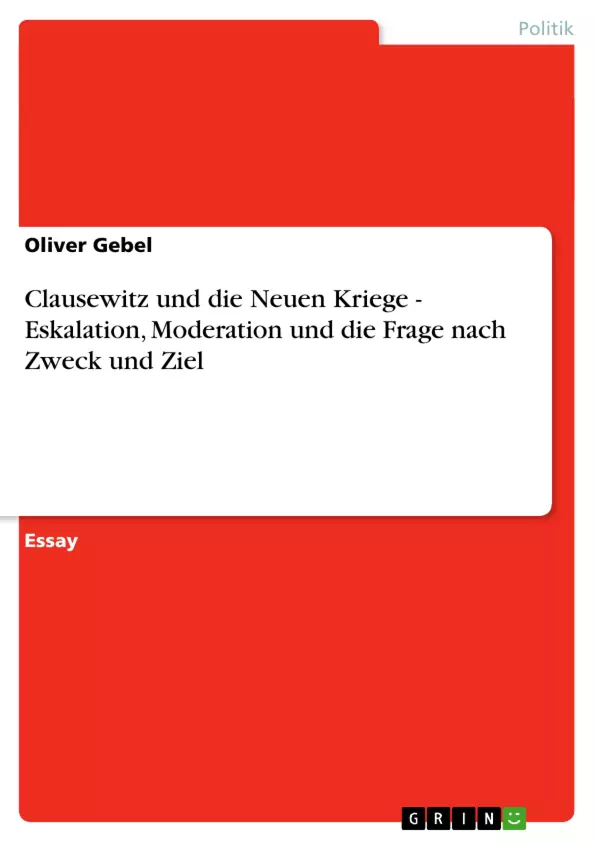In diesem Essay wird ein Bogen von den kriegerischen zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen im Europa des 19. Jahrhunderts - deren Zeitzeuge und Co-Akteur der preußische General und Militärtheoretiker v. Clausewitz war - bis in die unmittelbare Gegenwart gespannt, um die Privatisierung bzw. Entstaatlichung des Krieges und das Phänomen des globalen Terrors zu analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- 2. Das Phänomen Krieg – damals und heute
- 3. Der Krieg im Wandel
- 5. Clausewitz - ein zeitloses Verständnis des Krieges?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Parallelen und Unterschiede zwischen den „klassischen“ und „neuen“ Kriegen im Kontext des Denkens von Carl von Clausewitz. Ziel ist es, bestehendes Wissen über die Evolution von Kriegsführung zu analysieren und die Anwendbarkeit von Clausewitz’ Theorien auf zeitgenössische Konflikte zu evaluieren.
- Die Entwicklung des Krieges im Wandel der Zeit
- Der Vergleich von Clausewitz' Kriegstheorie mit modernen Konflikten
- Die Rolle der Politik in der Kriegsführung
- Unterschiede zwischen klassischen und neuen Kriegsformen
- Die Bedeutung von Eskalation und Moderation in Kriegshandlungen
Zusammenfassung der Kapitel
2. Das Phänomen Krieg – damals und heute: Dieses Kapitel beschreibt den fundamentalen Paradigmenwechsel in der Kriegsführung vom zweiten zum dritten Jahrtausend. Es werden die Unterschiede in der Positionierung des Krieges als politisches Instrument, der Kriegsführung selbst, der Eskalation und Entgrenzung von Konflikten hervorgehoben. Besonders wird die autonom wirkende Dynamik und intentionelle Perpetuität zeitgenössischer bewaffneter Konflikte, die sich innerstaatlich, parastaatlich oder als globaler Terror manifestieren, thematisiert. Die Arbeit von Clausewitz wird als wichtiges Werkzeug zur Analyse dieser Phänomene vorgestellt.
3. Der Krieg im Wandel: Der Kapitel beleuchtet die Geschichte des Krieges als ständigen Begleiter der menschlichen Zivilisation, von mikrosozialen Verbänden bis zu globalen Interdependenzen. Die letzten 2000 Jahre werden exemplarisch betrachtet, um die Entwicklung der Organisation menschlicher Gemeinwesen und die stets prägende Rolle von Gewalt und Krieg zu zeigen. Die Entwicklung vom mittelalterlichen Personenverbandsstaat zum modernen Nationalstaat und die damit verbundenen Veränderungen in der Kriegsführung werden analysiert. Die Kriege des modernen Nationalstaates werden als organisierte, kalkulierte Ereignisse beschrieben, im Gegensatz zu chaotischen Gemetzeln. Die napoleonischen Kriege werden als Zäsur dargestellt, die den regelhaften Krieg durchbrachen und seine Dimensionen erweiterten. Clausewitz’ Werk „Vom Kriege“ wird als umfassende Analyse des Krieges in diesem Kontext vorgestellt.
5. Clausewitz - ein zeitloses Verständnis des Krieges?: Dieses Kapitel untersucht die Relevanz von Clausewitz' Erkenntnissen für die Kriegserscheinungen des 21. Jahrhunderts. Es wird der funktionale Zusammenhang zwischen Kriegführung und Politik im Zeitalter der Kabinettskriege beleuchtet. Clausewitz' Betonung der Unterordnung des Krieges unter das Primat der Politik wird hervorgehoben. Der klassische zwischenstaatliche Krieg wird als pragmatisch-rationale Geisteshaltung dargestellt. Der Vergleich mit den „neuen“ Kriegen zeigt sowohl Kongruenzen als auch diametrale Unterschiede hinsichtlich Entstehung, Verlauf und Beendigung von Kriegen auf. Während Clausewitz' Konzept des Krieges als letztmöglicher Ausweg zur Sicherung der staatlichen Existenz im 18. und 19. Jahrhundert verständlich war, zeigen sich in den "neuen" Kriegen deutliche Abweichungen, die jedoch auch alte Traditionen der Kriegsführung wiederaufgreifen.
Schlüsselwörter
Clausewitz, Kriegstheorie, neue Kriege, klassische Kriege, Eskalation, Moderation, Politik, Gewalt, Nationalstaat, zeitgenössische Konflikte, globaler Terror, militärische Gewalt, internationales Recht, Frieden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Kriegsführung im Wandel
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Parallelen und Unterschiede zwischen „klassischen“ und „neuen“ Kriegen im Kontext der Kriegstheorie von Carl von Clausewitz. Sie untersucht die Evolution der Kriegsführung und evaluiert die Anwendbarkeit von Clausewitz’ Theorien auf zeitgenössische Konflikte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Krieges im Wandel der Zeit, den Vergleich von Clausewitz' Kriegstheorie mit modernen Konflikten, die Rolle der Politik in der Kriegsführung, die Unterschiede zwischen klassischen und neuen Kriegsformen, und die Bedeutung von Eskalation und Moderation in Kriegshandlungen.
Welche Kapitel sind enthalten und worum geht es in ihnen?
Kapitel 2 („Das Phänomen Krieg – damals und heute“) beschreibt den Paradigmenwechsel in der Kriegsführung und hebt Unterschiede in der Positionierung des Krieges als politisches Instrument hervor. Kapitel 3 („Der Krieg im Wandel“) beleuchtet die Geschichte des Krieges von mikrosozialen Verbänden bis zu globalen Interdependenzen, mit Fokus auf die Entwicklung vom mittelalterlichen zum modernen Nationalstaat und die napoleonischen Kriege als Zäsur. Kapitel 5 („Clausewitz - ein zeitloses Verständnis des Krieges?“) untersucht die Relevanz von Clausewitz' Erkenntnissen für den 21. Jahrhundert, beleuchtet den Zusammenhang zwischen Kriegführung und Politik und vergleicht Clausewitz' Konzept mit „neuen“ Kriegen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Clausewitz, Kriegstheorie, neue Kriege, klassische Kriege, Eskalation, Moderation, Politik, Gewalt, Nationalstaat, zeitgenössische Konflikte, globaler Terror, militärische Gewalt, internationales Recht, Frieden.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist die Analyse des bestehenden Wissens über die Evolution von Kriegsführung und die Evaluierung der Anwendbarkeit von Clausewitz’ Theorien auf zeitgenössische Konflikte.
Wie wird Clausewitz in dieser Arbeit verwendet?
Die Arbeit nutzt Clausewitz' Werk als wichtiges Werkzeug zur Analyse der Phänomene des Krieges, sowohl in historischen als auch in zeitgenössischen Kontexten. Sie untersucht die Relevanz seiner Theorien für das Verständnis moderner Konflikte und vergleicht seine Ansichten mit den Realitäten „neuer“ Kriege.
Was sind die Hauptunterschiede zwischen klassischen und neuen Kriegen laut dieser Arbeit?
Die Arbeit hebt Unterschiede in der Positionierung des Krieges als politisches Instrument, der Kriegsführung selbst, der Eskalation und Entgrenzung von Konflikten hervor. „Neue“ Kriege zeigen laut der Arbeit deutliche Abweichungen von Clausewitz' Konzept, greifen aber auch alte Traditionen der Kriegsführung wieder auf.
- Quote paper
- Oliver Gebel (Author), 2004, Clausewitz und die Neuen Kriege - Eskalation, Moderation und die Frage nach Zweck und Ziel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40784