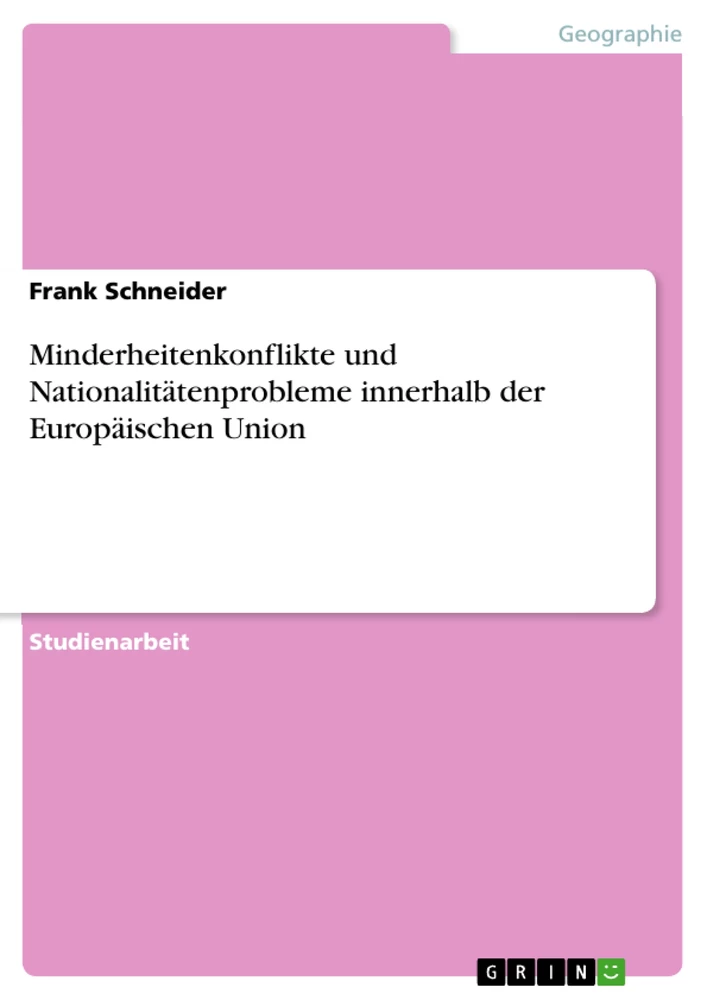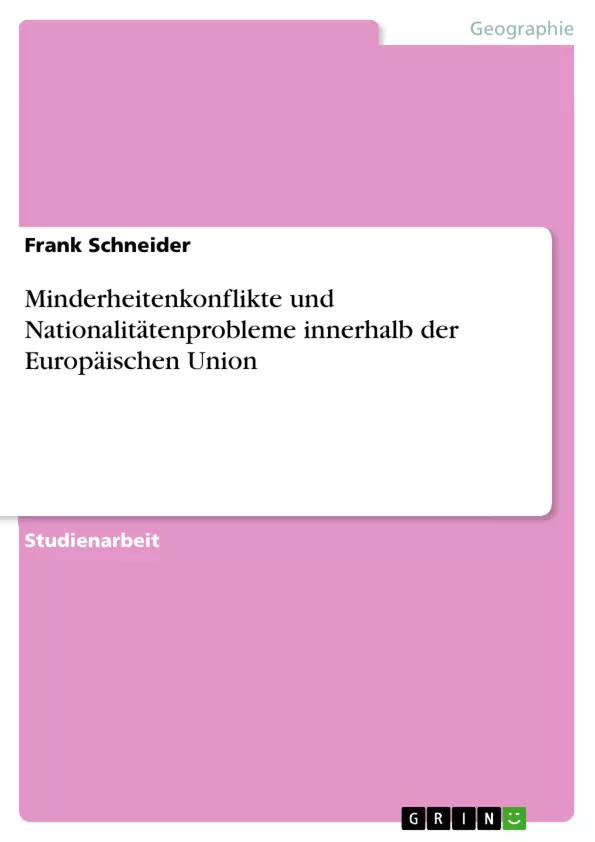Einleitung
Die Europäische Union ist ein völkerrechtlicher Bund, der sich aus 15 Nationalstaaten zusammensetzt. Diese grenzen sich voneinander hinsichtlich mehrerer Merkmale, wie etwa Geschichte, Tradition, Religion oder Abstammung, ab.
Dennoch scheint es offensichtlich, dass die Grenzen, die zwischen den einzelnen Staaten als Resultat von politischen Ereignissen gezogen wurden, nicht unbedingt der Aufteilung der Bevölkerung entsprechen müssen. Vielmehr wurden Grenzen über Menschen gezogen und dabei auf die natürliche Zusammensetzung der ansässigen Bevölkerung verzichtet.
Tausende Menschen sind nun am Anfang des 3. Jahrtausends immer noch nicht in der Lage friedlich zusammenzuleben, obwohl uns die Geschichte lehrte, insbesondere die Deutsche, dass Blutvergießen nicht zum Ziel führt.
"Die These, wir hätten in Westeuropa gelernt, mit Minderheitenproblemen und Nationalismus so umzugehen, dass sie nicht mehr zu gewalttätigen Auseinandersetzungen eskalieren, läuft Gefahr, die Dinge schönzureden. Nicht einmal auf die Definition einer nationalen Minderheit können sich die EU-Staaten einigen, geschweige denn auf eine allgemein verbindliche Minderheitenpolitik. (...) Gerade im Sinne der ureigenen emanzipatorischen Prinzipien demokratischer Selbstregierung wird die EU nicht umhinkönnen, längst fällige Schritte in Richtung Regionalisierung und Föderalisierung, kultureller Autonomie und des garantierten Minderheitenschutzes zu unternehmen. Die sezessionistischen Nationalismen von Schotten und Walisern in Großbritannien, der ungelöste Nordirlandkonflikt, die Grenz- und Minderheitenkonflikte Griechenlands mit seinen türkischen und albanischen Nachbarn, der baskische Separatismus in Spanien, die Regierungskoalition aus Neofaschisten und Nationalpopulisten 1994 in Italien sind nur einige Beispiele für die Aktualität dieser Fragen in Westeuropa." (Aus: Bruno Schoch, Nationale Konfliktpotentiale in Westeuropa, HSFK-Report 8/1995)
Ob Mentalität oder zu stark ausgeprägter Nationalismus, diese Menschen bilden die Gruppe der stets anwachsenden Minderheit. Sie alle werden heute als Minderheiten angesehen, auch wenn das für sie eine Zumutung darstellt.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Minderheiten
- Allgemeines zum Begriff
- Definition: Minderheitenprobleme
- Minderheiten nach territorialen Kontext
- Nationale Minderheit
- Staatenlose Minderheiten
- Nationalitäten
- Allgemeines zum Begriff
- Definition: Nationalitätenkonflikte
- Beispiele
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Problematik von Minderheitenkonflikten und Nationalitätenproblemen innerhalb der Europäischen Union. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die durch die Existenz von Minderheiten und Nationalitäten in einem multikulturellen und multiethnischen Kontext entstehen.
- Definition von Minderheiten und Nationalitäten
- Analyse von Minderheitenkonflikten und Nationalitätenproblemen
- Die Rolle des territorialen und historischen Kontextes
- Herausforderungen für die Europäische Union im Umgang mit Minderheiten
- Beispiele für Minderheitenkonflikte in Europa
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Europäische Union als einen völkerrechtlichen Bund aus 15 Nationalstaaten vor, die sich durch unterschiedliche Merkmale wie Geschichte, Tradition, Religion und Abstammung voneinander abgrenzen. Die Arbeit fokussiert auf die Herausforderung, dass politische Grenzen nicht immer mit der natürlichen Zusammensetzung der Bevölkerung übereinstimmen und somit zu Spannungen und Konflikten führen können.
Minderheiten
Allgemeines zum Begriff
Dieser Abschnitt bietet eine allgemeine Definition des Begriffs "Minderheit" und beleuchtet die wichtigsten Merkmale, die eine Gruppe zur Minderheit machen. Dazu gehören eine zahlenmäßige Unterlegenheit gegenüber der Mehrheitsbevölkerung, die Staatsbürgerschaft des Wohnsitzstaates, sowie Unterschiede in Sprache, Religion, Rasse/Ethnizität und Kultur.
Definition: Minderheitenprobleme
Hier wird der Begriff "Minderheitenprobleme" definiert. Der Fokus liegt auf Konflikten, die aus der Existenz von nicht integrierten Minderheiten in einem Gebiet resultieren. Diese Konflikte entstehen durch unterschiedliche Lebensgewohnheiten, Vorurteile und soziale Spannungen.
Minderheiten nach territorialen Kontext
Dieser Abschnitt betrachtet Minderheiten im Kontext ihres territorialen Standorts. Der Schwerpunkt liegt auf Nationalen Minderheiten, die in einem Staat leben, dessen Ethnie, Sprache und Sitten in einem anderen Staat die Mehrheit bilden. Beispiele sind die Türken in Westdeutschland und die Maghrebiner in Frankreich.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen von Minderheiten, Nationalitäten, Minderheitenkonflikten und Nationalitätenproblemen. Der Fokus liegt auf der Analyse von Konflikten, die durch Unterschiede in Kultur, Sprache, Religion und Ethnie entstehen. Zu den wichtigsten Themen gehören die Integration von Minderheiten, die Rolle des territorialen Kontextes, sowie die Herausforderungen für die Europäische Union im Umgang mit internen Konflikten.
Häufig gestellte Fragen
Warum gibt es in der EU trotz politischer Grenzen Minderheitenkonflikte?
Oft wurden politische Grenzen über Menschen hinweg gezogen, ohne die natürliche Zusammensetzung der Bevölkerung zu berücksichtigen, was zu Spannungen zwischen Ethnien führen kann.
Was definiert eine Gruppe als „Minderheit“?
Wesentliche Merkmale sind eine zahlenmäßige Unterlegenheit, die Staatsbürgerschaft des Wohnsitzstaates sowie Unterschiede in Sprache, Religion, Kultur oder Ethnie.
Was ist der Unterschied zwischen nationalen und staatenlosen Minderheiten?
Nationale Minderheiten haben eine Bezugsethnie, die in einem anderen Staat die Mehrheit bildet. Staatenlose Minderheiten verfügen über keinen eigenen Mutterstaat.
Welche Beispiele für Minderheitenkonflikte werden in Westeuropa genannt?
Genannt werden unter anderem der baskische Separatismus in Spanien, der Nordirlandkonflikt sowie sezessionistische Bewegungen in Schottland und Wales.
Was muss die EU tun, um diese Konflikte nachhaltig zu lösen?
Die Arbeit legt nahe, dass Schritte in Richtung Regionalisierung, Föderalisierung, kultureller Autonomie und ein garantierter Minderheitenschutz notwendig sind.
Wie entstehen „Minderheitenprobleme“ konkret?
Sie resultieren meist aus mangelnder Integration, unterschiedlichen Lebensgewohnheiten, Vorurteilen und daraus entstehenden sozialen Spannungen.
- Quote paper
- Frank Schneider (Author), 2002, Minderheitenkonflikte und Nationalitätenprobleme innerhalb der Europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4094