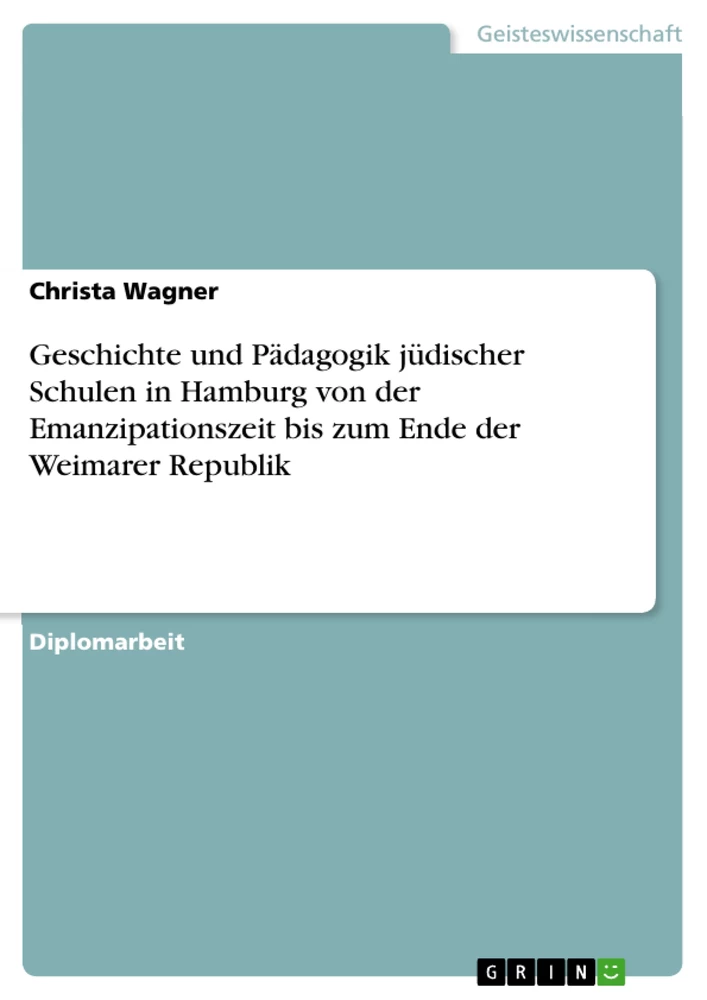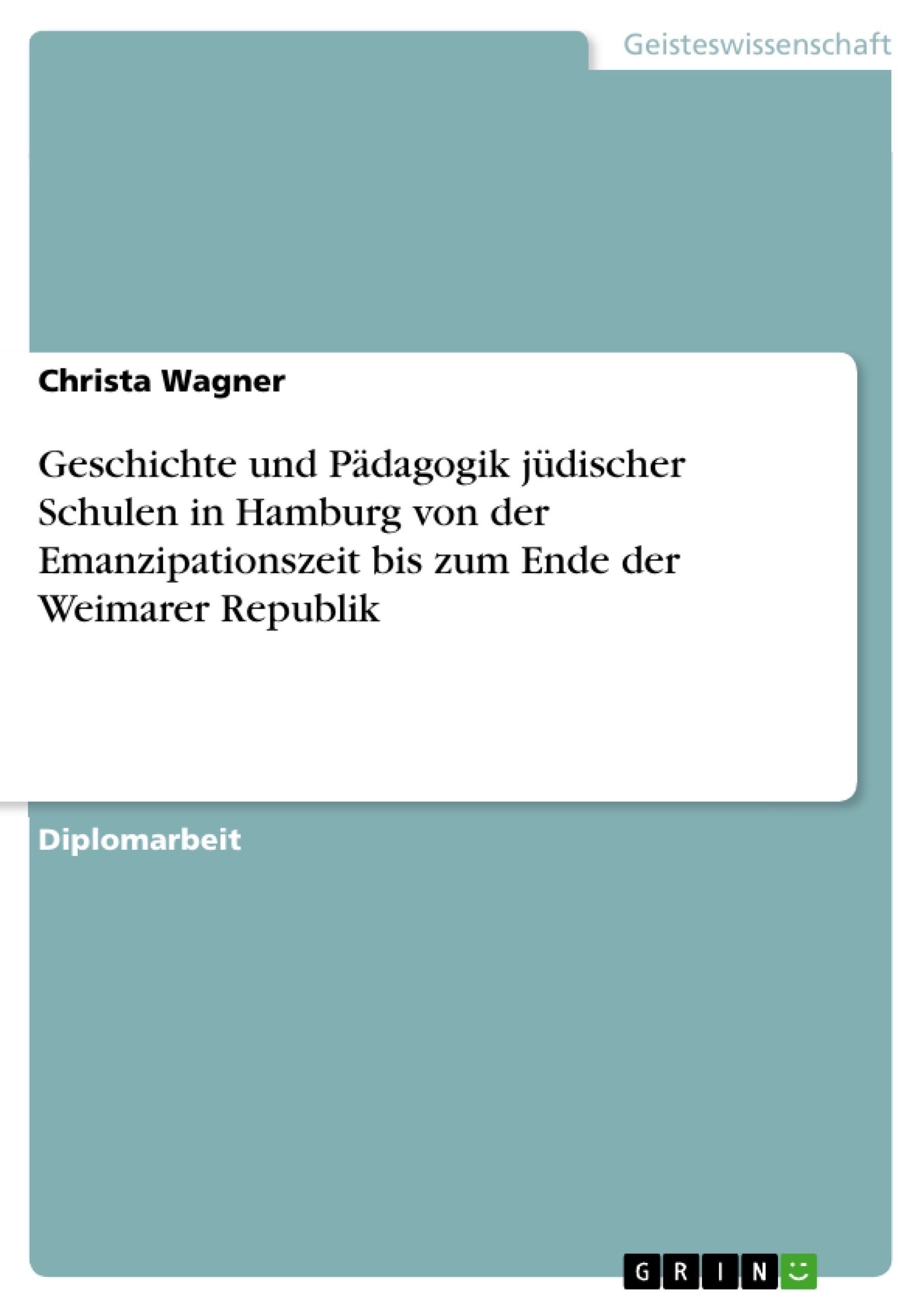1.Einleitung
Zur Beschäftigung mit dem Thema dieser Diplomarbeit bin ich durch den Besuch einiger Museumsaustellungen zum Thema ,,Juden in Deutschland" in den letzten Jahren und durch eine Seminararbeit über Janusz Korczak gekommen. Dadurch habe ich einen ersten Überblick über einige Aspekte jüdischer Erziehung bekommen können. Insbesondere die Begegnung moderner pädagogischer Ansätze mit religiös geprägten jüdischen Erziehungsvorstellungen sowie die Einflüße außerschulischer, politischer und geistesgeschichtlicher Entwicklungen auf das jüdische Schulleben interessieren mich sehr.
Ich werde mich bei folgender Arbeit auf den Zeitraum vom Beginn der Emanzipation bis zum Ende der Weimarer Republik beschränken, weil dieser Zeitraum in gewisser Hinsicht für die Juden in Deutschland eine in sich geschlossene Periode darstellt, die mit dem Verlassen des Ghettos begann und mit dem NS-Terror mit neuerlicher Ghettosierung und schließlich mit der Vernichtung endete. Insbesondere seit der Aufklärung und spätestens seit Erreichen der - zumindest beschränkten - gesellschaftlichen und rechtlichen Emanzipation der deutschen Juden seit etwa 1850 sind Entwicklungslinien festzustellen, bei denen unter anderem reformpädagogische Ansätze mit Assimilierungstendenzen verschmolzen. Dadurch sind aber auch Gegenbewegungen im jüdischen Schulwesen entstanden, die zum Beispiel durch eine Betonung des Religionsunterrichts Assimilierungstendenzen entgegenwirken wollten. Wie diese Vorstellungen im einzelnen damals aussahen und wie sie von den jüdischen Gemeinden und der nicht-jüdischen Umwelt aufgenommen wurden, möchte ich darstellen.
Zwar hat es auch im NS-Staat jüdische Schulen gegeben, in deren Rahmen versucht wurde, das gewachsene jüdische schulische Leben weiterzuführen, dennoch stellt dieses mittlerweile guterforschte und zugänglich gemachte letzte Kapitel jüdischen Schulwesens im Deutschen Reich in diesem Zusammenhang einen Sonderfall dar.Zwischen der Machtübernahme durch die Nazis 1933 bis zu der mit Verschleppung und Massenmord an Lehrern und Schülern verbundenen endgültigen Auflösung des jüdischen Erziehungswesens in Deutschland 1942 waren die jüdischen Schulen exemplarisch für den Leidensweg, der den jüdischen Deutschen aufgezwungen wurde.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hamburgs Territorium und Staatsaufbau, Wirtschaft und Bevölkerung vom 17. Jahrhundert bis 1933
- Die politische, soziale und wirtschaftliche Situation der jüdischen Einwohner Hamburgs bis 1933
- Die Sephardim
- Die Aschkenasim
- Die Aschkenasim bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
- Die Aschkenasim in der Emanzipationszeit
- Die Aschkenasim im Kaiserreich und in der Weimarer Republik
- Schulwesen in Hamburg
- bis 1860
- ab 1860
- Jüdisches Schulwesen in Hamburg
- Talmud-Tora-Schule
- Von 1805 bis 1849
- Von 1849 bis 1921
- Von 1921 bis 1933
- Israelitische Stiftungsschule von 1815
- 1815-1848
- Ära Rée
- Israelitische Töchterschule
- Die Vorläuferschulen 1798 - 1884
- Die Ära Mary Marcus 1884 - 1924
- Die Ära Alberto Jonas ab 1924
- Höhere Mädchenschule von Dr. Jakob Loewenberg
- Ereignis- und Organisationsgeschichte
- Pädagogische Konzepte und Umsetzung
- Bieberstraßen-Schule
- Talmud-Tora-Schule
- Jüdisches Schulwesen ab 1933
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Geschichte und Pädagogik jüdischer Schulen in Hamburg von der Emanzipationszeit bis zum Ende der Weimarer Republik. Ziel ist es, die Entwicklung des jüdischen Schulwesens in diesem Zeitraum zu beleuchten, die Interaktion mit reformpädagogischen Ansätzen und Assimilationstendenzen zu analysieren und die Reaktion der jüdischen Gemeinden und der nicht-jüdischen Umwelt auf diese Entwicklungen darzustellen.
- Entwicklung des jüdischen Schulwesens in Hamburg während der Emanzipationszeit und der Weimarer Republik
- Interaktion von religiös geprägten jüdischen Erziehungsvorstellungen und reformpädagogischen Ansätzen
- Einfluss von politischen und geistesgeschichtlichen Entwicklungen auf das jüdische Schulleben
- Die Rolle verschiedener Schulformen (z.B. Talmud-Tora-Schule, Stiftungsschule, Töchterschule)
- Die Bedeutung herausragender Hamburger Lehrerpersönlichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die Geschichte jüdischer Schulen in Hamburg von der Emanzipation bis 1933, eine Periode, die mit dem Verlassen des Ghettos begann und mit dem NS-Terror endete. Der Fokus liegt auf der Verschmelzung reformpädagogischer Ansätze mit Assimilationstendenzen und den daraus resultierenden Gegenbewegungen im jüdischen Schulwesen. Die Arbeit konzentriert sich auf Hamburg aufgrund seiner großen jüdischen Gemeinde und der Vielfalt an Schulkonzepten.
Hamburgs Territorium und Staatsaufbau, Wirtschaft und Bevölkerung vom 17. Jahrhundert bis 1933: Dieses Kapitel liefert den historischen und sozioökonomischen Kontext, in dem sich das jüdische Schulwesen in Hamburg entwickelte. Es beschreibt den Aufbau der Stadt, ihre wirtschaftliche Entwicklung und die demografische Zusammensetzung der Bevölkerung, einschließlich der jüdischen Minderheit, im relevanten Zeitraum.
Die politische, soziale und wirtschaftliche Situation der jüdischen Einwohner Hamburgs bis 1933: Dieser Abschnitt detailliert die Lebensbedingungen der jüdischen Bevölkerung in Hamburg, unterteilt in Sephardim und Aschkenasim, mit Fokus auf deren politische, soziale und wirtschaftliche Integration und Herausforderungen im Laufe der Zeit. Er beleuchtet die Entwicklung von der eingeschränkten Teilhabe bis hin zur (relativen) Emanzipation im 19. und frühen 20. Jahrhundert.
Schulwesen in Hamburg: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das allgemeine Schulwesen in Hamburg vor und nach 1860, um den Rahmen für das jüdische Schulwesen zu setzen. Es beschreibt die Strukturen, die pädagogischen Ansätze und die Entwicklungen im allgemeinen Bildungssystem.
Jüdisches Schulwesen in Hamburg: Dieser Abschnitt analysiert detailliert verschiedene jüdische Schulformen in Hamburg, einschließlich der Talmud-Tora-Schule, der Israelitischen Stiftungsschule, der Israelitischen Töchterschule und der höheren Mädchenschule von Dr. Jakob Loewenberg. Die einzelnen Kapitel beschreiben die Geschichte, die pädagogischen Konzepte und die Bedeutung jeder Schule im Kontext des jüdischen Lebens in Hamburg.
Schlüsselwörter
Jüdisches Schulwesen, Hamburg, Emanzipation, Weimarer Republik, Talmud-Tora-Schule, Israelitische Stiftungsschule, Israelitische Töchterschule, Reformpädagogik, Assimilation, Antisemitismus, Pädagogik, Geschichte.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Jüdisches Schulwesen in Hamburg (17. Jahrhundert bis 1933)
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Arbeit untersucht die Geschichte und Pädagogik jüdischer Schulen in Hamburg von der Emanzipationszeit bis zum Ende der Weimarer Republik. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des jüdischen Schulwesens, der Interaktion mit reformpädagogischen Ansätzen und Assimilationstendenzen sowie der Reaktion der jüdischen Gemeinden und der nicht-jüdischen Umwelt.
Welche Zeitspanne wird in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit betrachtet den Zeitraum vom 17. Jahrhundert bis 1933, mit besonderem Schwerpunkt auf der Emanzipationszeit und der Weimarer Republik. Sie beleuchtet die Entwicklung vom Leben im Ghetto bis zum Beginn des NS-Terrors.
Welche Schulen werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene jüdische Schulformen in Hamburg, darunter die Talmud-Tora-Schule, die Israelitische Stiftungsschule, die Israelitische Töchterschule und die höhere Mädchenschule von Dr. Jakob Loewenberg. Für jede Schule werden Geschichte, pädagogische Konzepte und Bedeutung im Kontext des jüdischen Lebens in Hamburg untersucht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des jüdischen Schulwesens in Hamburg, die Interaktion von religiös geprägten jüdischen Erziehungsvorstellungen und reformpädagogischen Ansätzen, den Einfluss politischer und geistesgeschichtlicher Entwicklungen, die Rolle verschiedener Schulformen und die Bedeutung herausragender Hamburger Lehrerpersönlichkeiten.
Welchen historischen Kontext liefert die Arbeit?
Die Arbeit liefert den historischen und sozioökonomischen Kontext, in dem sich das jüdische Schulwesen entwickelte. Sie beschreibt den Aufbau Hamburgs, seine wirtschaftliche Entwicklung und die demografische Zusammensetzung der Bevölkerung, einschließlich der jüdischen Minderheit, im relevanten Zeitraum. Sie beleuchtet auch die politische, soziale und wirtschaftliche Situation der jüdischen Einwohner Hamburgs, aufgeteilt in Sephardim und Aschkenasim.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jüdisches Schulwesen, Hamburg, Emanzipation, Weimarer Republik, Talmud-Tora-Schule, Israelitische Stiftungsschule, Israelitische Töchterschule, Reformpädagogik, Assimilation, Antisemitismus, Pädagogik, Geschichte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zum historischen Kontext Hamburgs, der Situation der jüdischen Bevölkerung, dem allgemeinen und dem jüdischen Schulwesen in Hamburg und abschließend einer Zusammenfassung. Jedes Kapitel zu den jüdischen Schulen bietet detaillierte Einblicke in die jeweilige Institution.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Entwicklung des jüdischen Schulwesens in Hamburg während der Emanzipationszeit und der Weimarer Republik zu beleuchten und die Interaktion mit reformpädagogischen Ansätzen und Assimilationstendenzen zu analysieren.
- Quote paper
- Christa Wagner (Author), 2000, Geschichte und Pädagogik jüdischer Schulen in Hamburg von der Emanzipationszeit bis zum Ende der Weimarer Republik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4106