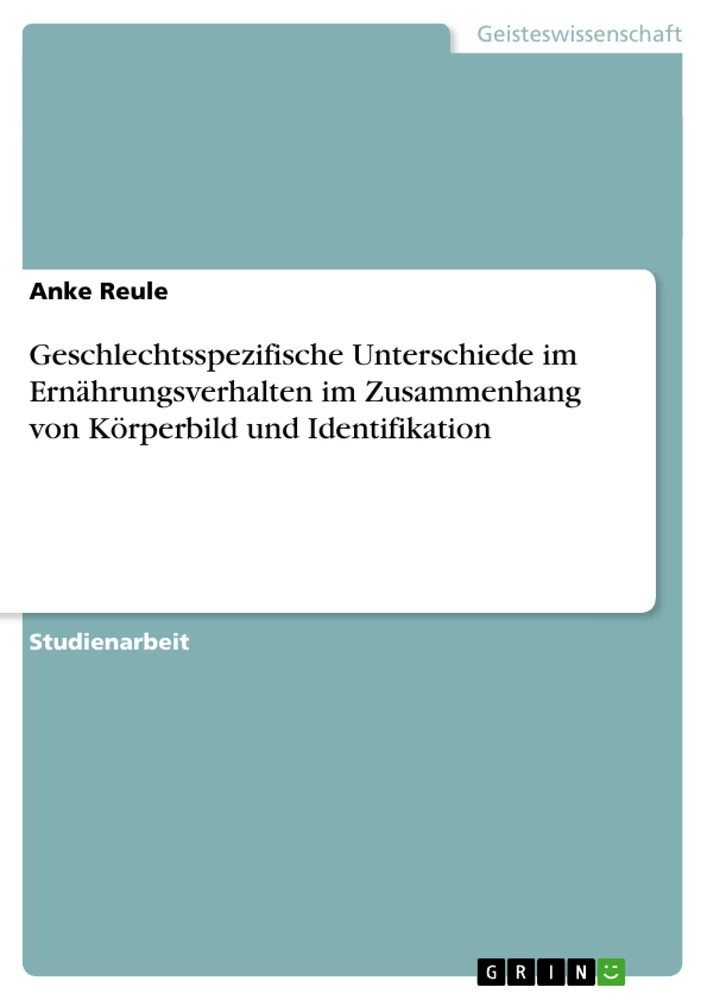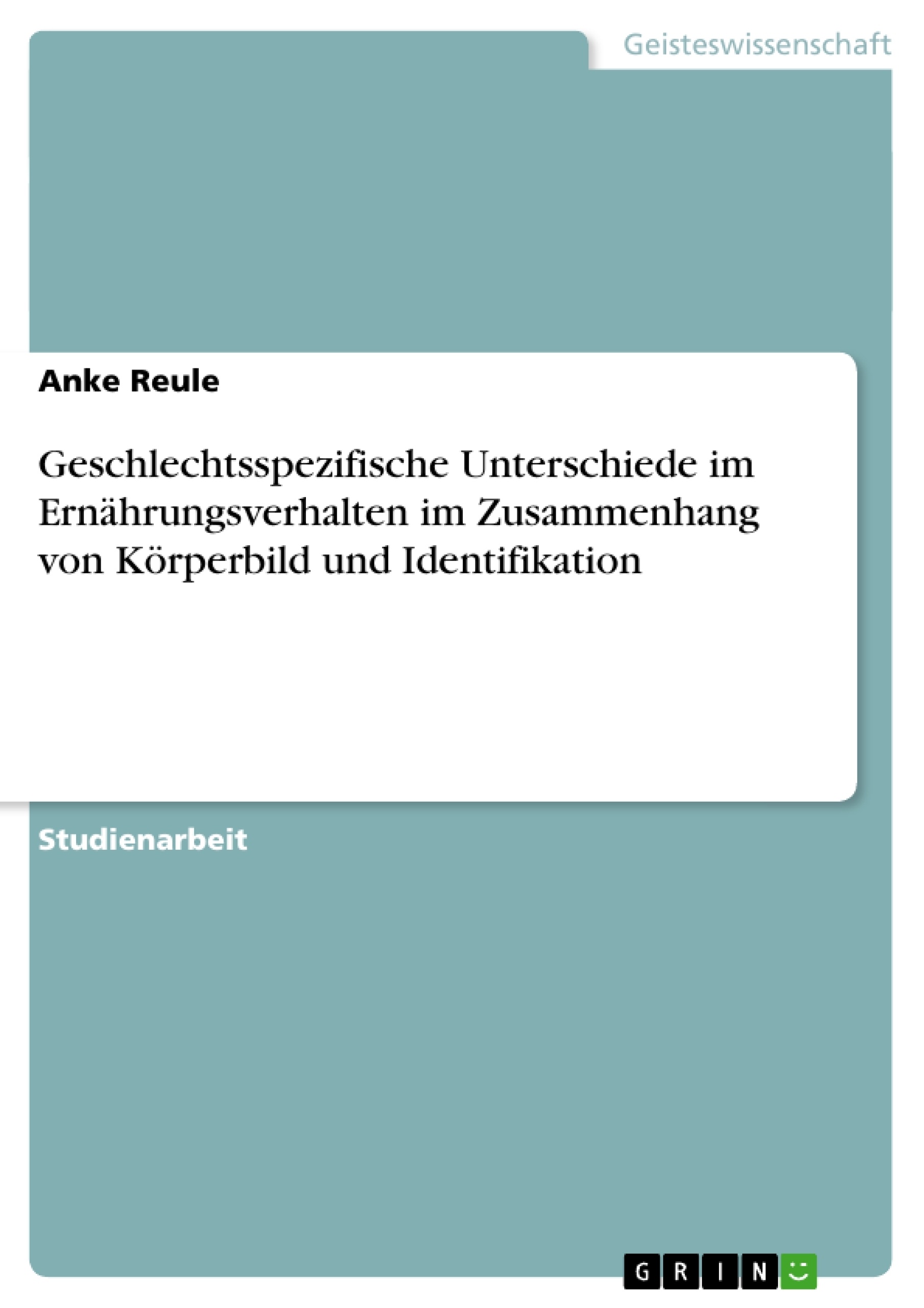Ernährung als Tätigkeit ist eine alltägliche Handlung. Sie ist eine natürliche Notwendigkeit, der jeder von Geburt an gerecht werden muss. Dieses Bedürfnis wird je nach Zeit, Kultur, Anlass, Alter, Stand, Religion und anderen Kriterien außerordentlich vielseitig beantwortet. Eine solch umfangreiche praktische Zuwendung sollte in theoretischer Konzeptualisierung nicht weniger Beachtung finden, könne man meinen. Umso überraschender ist dann die Feststellung, dass sich Aspekten der Ernährung über einen langen Zeitraum hinweg fast ausschließlich aus naturwissenschaftlicher Perspektive zugewandt wurde. Eine biologische bzw. physiologische Betrachtung ist allerdings unzureichend, um die Vielfalt und den Wandel von Ernährungsgewohnheiten einerseits, die Missachtung von ernährungsphysiologischen Erkenntnissen andererseits, zu erklären.
Nicht minder problematisch ist der Zugang zu Ernährung aus geschlechtstheoretischer Richtung. Auch hier bleiben Betrachtungen oft ihrem Begriff verhaftet, ohne sich in einer interpretativen Fassung zu finden. Wie Setzwein formuliert, ist „dieses Forschungsfeld … bislang vornehmlich empirisch beackert worden.“ Zwar finden sich ausreichend Darstellungen über unterschiedliche Ernährungsvorlieben und Einstellungen zum Thema ‚Ernährung’; allerdings fehlt es oft an einer programmatischen Konzeptualisierung festgestellter geschlechtsspezifischer Neigungen.
Wie auch die Vielgestaltigkeit globaler Ernährungsgewohnheiten nicht hinreichend aus ernährungsphysiologischer Perspektive verstanden werden kann, müssen auch geschlechtstypische Vorlieben kultur- und sozialwissenschaftlich untersucht werden. Auch sie bewegen sich im Rahmen gesellschaftlicher Bedingungen; Änderungen dieser ziehen zumeist auch eine Umgestaltung bisheriger Zuordnungen in Kategorien ‚männlich’ und ‚weiblich’ nach sich. In diesem Wandel wird der ‚Überlieferungscharakter’ vom Kulturphänomen Essen deutlich; eine wissenschaftliche Betrachtung darf sich daher nicht einseitig biologisch begründen, sondern muss dass komplexe Bedingungsgefüge sozialer Gegebenheiten und dessen Rückkopplung/Zusammenhang/Wirkung auf die jeweilige Befriedigung des Hungergefühls einschließen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einführung in das Thema
- 1.2 Gliederung der Hausarbeit
- 2. Geschlechtsspezifische Unterschiede im Kulturphänomen Essen
- 2.1 Geschlechtsunterschiede als statistische Tendenzen
- 2.2 Darstellung geschlechtsspezifischer Differenzen
- 2.2.1 Bevorzugte Lebensmittel
- 2.2.2 Die Bedeutung von Essen
- 3. Das Geschlecht als soziale Kategorie
- 3.1 Weiblichkeit und „Männlichkeit als relative Begriffe
- 3.2 Zum Begriff des ,gender'
- 4. Symbolischer Interaktionismus als Erklärungsmodell für geschlechtsspezifische Ernährungsunterschiede
- 5. Die Bedeutung des Körpers als Identifikationsmedium
- 5.1 weibliche und männliche Sozialistation
- 5.2 Das Körperverständnis als Ergebnis des Sozialisationsprozesses
- 5.3 Körperwahrnehmung von Frauen und Männern
- 6. Eẞgewohnheiten als a-verbale Kommunikation
- 6.1 Die Interpretation geschlechtstyp. Bevorzugung von Nahrungsmitteln
- 6.2 Die Interpretation geschlechtstyp. Bedeutung von Essen
- 7. Fazit und Aussichten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht geschlechtsspezifische Unterschiede im Ernährungsverhalten im Kontext von Körperbild und Identifikation. Sie analysiert die Rolle des „doing gender“ und des symbolischen Interaktionismus bei der Konstruktion geschlechtstypischer Ernährungsgewohnheiten. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie das Geschlecht als soziale Kategorie das Ernährungsverhalten beeinflusst und welche Bedeutung der Körper als Identifikationsmedium in diesem Zusammenhang spielt.
- Geschlechtsspezifische Unterschiede im Ernährungsverhalten
- Die Rolle des „doing gender“ und des symbolischen Interaktionismus
- Der Körper als Identifikationsmedium und seine Bedeutung für die Ernährung
- Interpretation von geschlechtstypischen Essensvorlieben und -bedeutungen
- Die Konstruktion von Geschlecht durch Ernährung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der geschlechtsspezifischen Unterschiede im Ernährungsverhalten ein. Sie beleuchtet die Notwendigkeit, Ernährungsgewohnheiten nicht nur naturwissenschaftlich, sondern auch kultur- und sozialwissenschaftlich zu betrachten. Die Hausarbeit setzt sich zum Ziel, den „doing gender“-Ansatz im Hinblick auf die identitätsbildende Funktion einer geschlechtstypischen Ernährung zu untersuchen.
Kapitel 2 diskutiert die Darstellung geschlechtsspezifischer Differenzen im Ernährungsverhalten, indem es bevorzugte Lebensmittel und die Bedeutung von Essen im jeweiligen Geschlecht kontextualisiert. Kapitel 3 erläutert das Geschlecht als soziale Kategorie und beleuchtet die Begriffe „Weiblichkeit“, „Männlichkeit“ und „gender“.
Kapitel 4 stellt den symbolischen Interaktionismus als Erklärungsmodell für geschlechtsspezifische Ernährungsunterschiede vor. Kapitel 5 beleuchtet die Bedeutung des Körpers als Identifikationsmedium und die Rolle der Sozialisation im Körperverständnis. Kapitel 6 analysiert Essgewohnheiten als a-verbale Kommunikation und interpretiert geschlechtstypische Präferenzen und Bedeutungen im Zusammenhang mit Essen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Geschlecht, „gender“, Ernährung, Körperbild, Identifikation, symbolischer Interaktionismus, „doing gender“, Essensvorlieben, Essensbedeutung, Sozialisation, a-verbale Kommunikation.
- Citation du texte
- Anke Reule (Auteur), 2005, Geschlechtsspezifische Unterschiede im Ernährungsverhalten im Zusammenhang von Körperbild und Identifikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41094