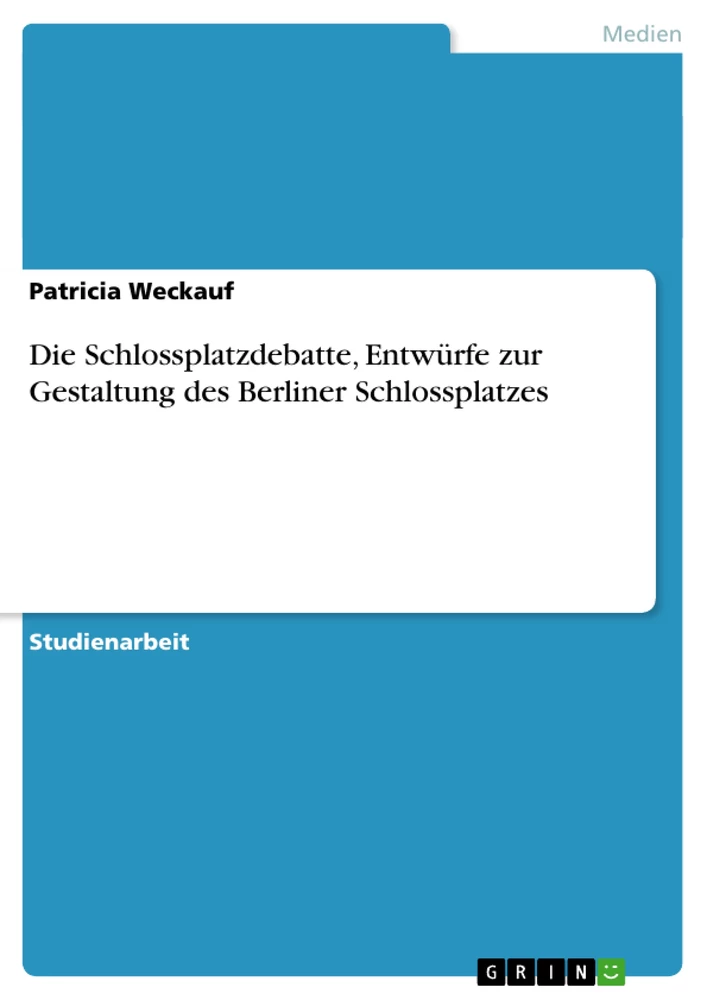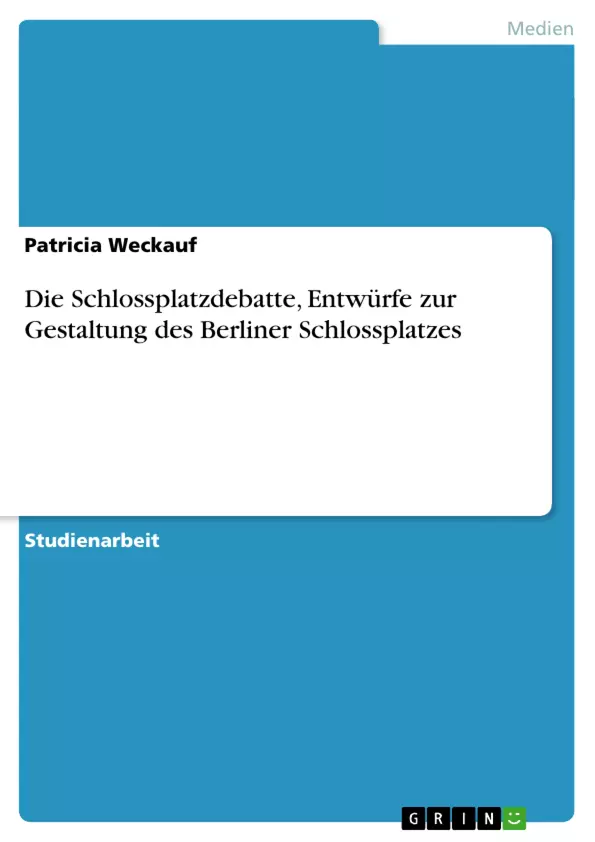Wie soll mit zerstörten Bauwerken umgegangen werden? Ist es legitim vergangene Architektur mit neuen Materialien wiederzuerrichten? Kann die Kopie das Original ersetzen?
Das Berliner Schloss soll wieder aufgebaut werden, nachdem es 1950 zerstört wurde. Ähnliche Beispiele für die Rekonstruktion historischer Architektur finden wir bei der Dresdener Frauenkirche, Groß St. Martin in Köln oder der Michaeliskirche in Hamburg, um nur einige deutsche Beispiele zu nennen. Doch schon seit ~1900 geht es nicht mehr nur um das schöne Erscheinungsbild, sondern auch um den richtigen Umgang mit dem Baudenkmal. Georg Dehio und Alois Riegel setzten sich um die Jahrhundertwende für den Erhalt, die Konservierung der Bausubstanz ein. Das Motto hieß „Konservieren, nicht Restaurieren.“ Es wurde auf den Alterswert des Gebäudes hingewiesen, den nur das Original inne habe und der nicht künstlich erzeugt werden könne und somit den Wert des Gebäudes ausmache.
Sollte der Wiederaufbau, die Kopie eines Gebäudes wirklich durchgeführt werden? Gibt es keine anderen Lösungen den Platz würdig zu gestalten? Und ist es gerechtfertigt das Schloss wiederentstehen zu lassen, wenn dafür ein anderes Gebäude, der Palast der Republik, das diesen, wenn auch jungen Alterswert inne hat, nur wegen seines äußeren, wenig ansprechenden Erscheinungsbildes, abgerissen werden soll?
Diesen Fragen nach einer alternativen Lösung stellten sich viele Architekten in verschiedenen Wettbewerben. Vertreten waren Liebhaber des Schlossbaus, Befürworter einer modernen Architektur und Verfechter des Palastes der Republik. Einige Entwurfsbeispiele werden in dieser Hausarbeit vorgestellt werden. Dabei wird darauf zu achten sein, welche Prioritäten der jeweilige Architekt setzt. Ob dabei die Denkmalpflege berücksichtigt oder ob der äußere Eindruck dem historischen Wert vorgezogen wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Schlossplatzdebatte
- Seit 1991
- Entwürfe zur Gestaltung des Berliner Schlossplatzes
- Bernd Niebuhr
- Axel Schultes und Charlotte Frank
- Ingenhoven, Overdiek und Partner
- Sir Norman Foster
- Verein zur Erhaltung des Palastes der Republik
- Tim Heide, Verena von Beckerath, Andrew Alberts
- Meinhard von Gerkan
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Debatte um die Gestaltung des Berliner Schlossplatzes, welche in den 1990er Jahren begann. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Entwürfe von Architekten und Architektinnen, die sich mit der Frage der Rekonstruktion des Schlosses auseinandersetzen.
- Wiederaufbau des Berliner Schlosses
- Denkmalpflege und historische Architektur
- Architekturwettbewerbe und ihre Ergebnisse
- Alternativen zum Wiederaufbau des Schlosses
- Gestaltung des Berliner Schlossplatzes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Debatte um den Wiederaufbau des Berliner Schlosses in den Kontext historischer Architektur und Denkmalpflege. Kapitel 1 beleuchtet die Geschichte der Schlossplatzdebatte seit 1991, beginnend mit der Sprengung des Schlosses im Jahr 1950 und dem späteren Bau des Palastes der Republik.
Kapitel 2.1 bis 2.7 präsentieren die Entwürfe verschiedener Architekten und Architektinnen zum Schlossplatz. Dabei werden die unterschiedlichen Ansätze zur Gestaltung des Platzes und die jeweiligen Prioritäten der Architekten aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Berliner Schlossplatz, Schlossplatzdebatte, Denkmalpflege, Rekonstruktion, Architekturwettbewerb, Palast der Republik, Stadtschloss, Berliner Mitte, Gestaltung, Moderne Architektur, Historische Architektur.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist der Wiederaufbau des Berliner Schlosses umstritten?
Kritiker hinterfragen, ob eine Kopie das Original ersetzen kann und ob es legitim ist, dafür den Palast der Republik als Zeugnis der DDR-Geschichte abzureißen.
Was besagt das Motto „Konservieren, nicht Restaurieren“?
Es stammt von Denkmalschützern wie Georg Dehio, die den Wert eines Gebäudes in seiner originalen Bausubstanz und dessen Alterswert sehen, nicht in der äußeren Form.
Welche Architekten reichten alternative Entwürfe ein?
Unter anderem Bernd Niebuhr, Axel Schultes, Sir Norman Foster und Meinhard von Gerkan präsentierten unterschiedliche Visionen zwischen Rekonstruktion und Moderne.
Welche Rolle spielt der Palast der Republik in der Debatte?
Einige Entwürfe sahen den Erhalt des Palastes vor, da er einen eigenständigen historischen Wert besaß, während Befürworter des Schlosses ihn als ästhetisch störend empfanden.
Was war das Ziel der Schlossplatz-Wettbewerbe?
Eine würdige Gestaltung der Berliner Mitte zu finden, die entweder die historische Lücke schließt oder einen modernen städtebaulichen Akzent setzt.
- Quote paper
- Patricia Weckauf (Author), 2005, Die Schlossplatzdebatte, Entwürfe zur Gestaltung des Berliner Schlossplatzes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41160