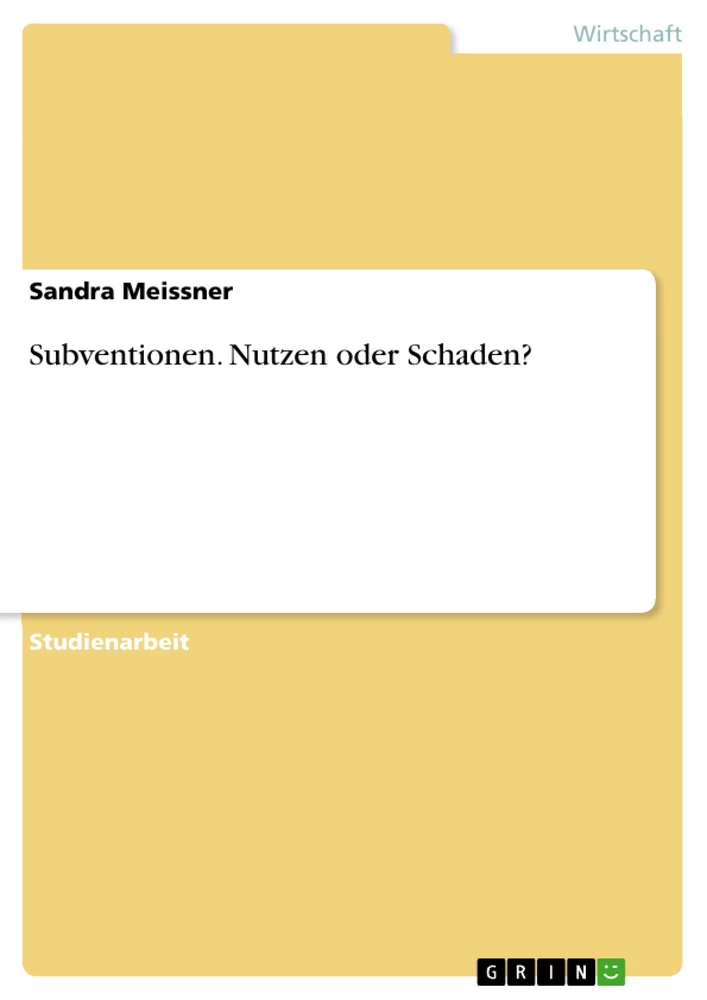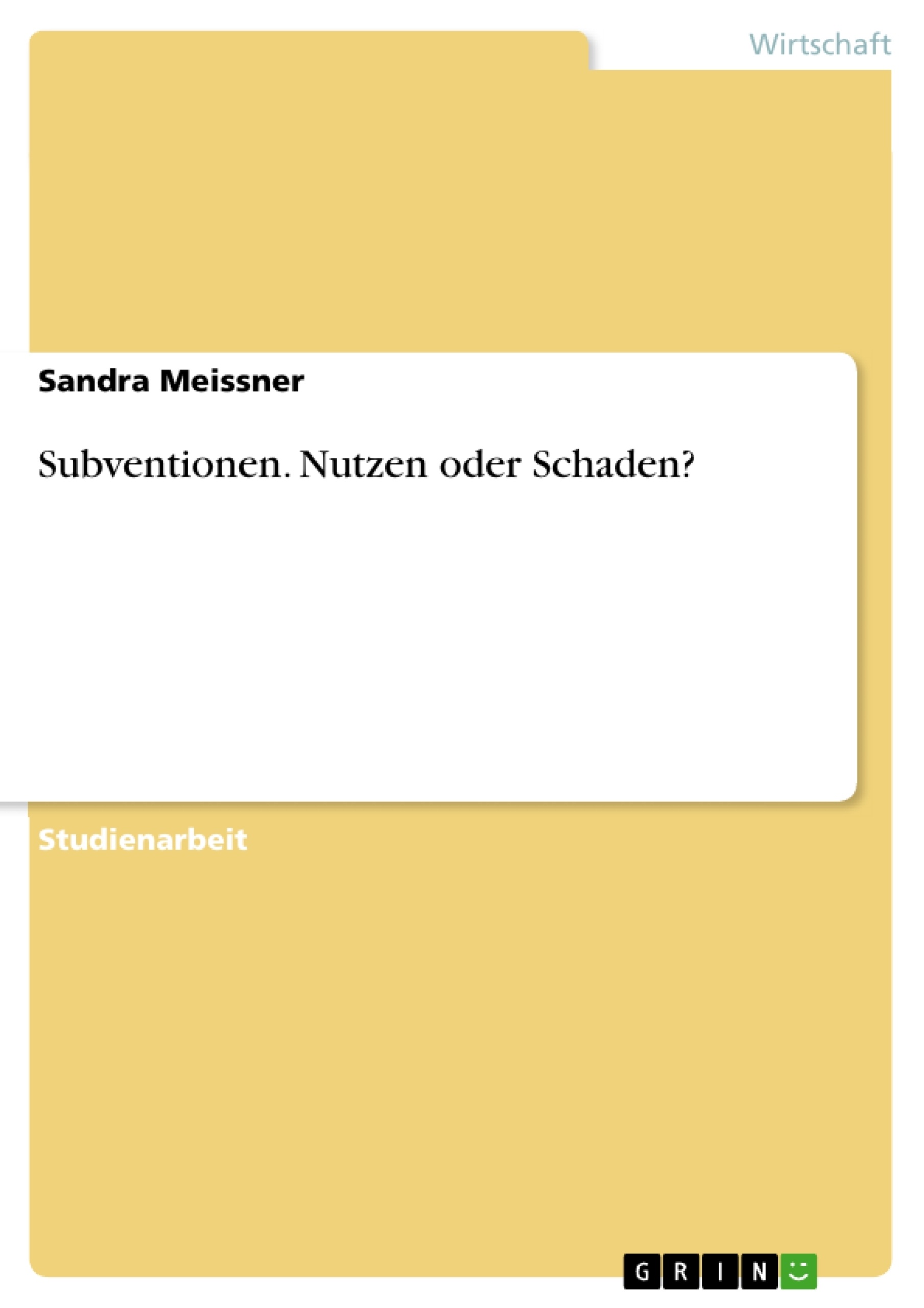In der folgenden Hausarbeit beschäftige ich mich mit dem Thema Subventionen. Dabei erkläre ich die einzelnen Definitionen des Subventionsbegriffes und wie diese einen Einfluss auf den Subventionsbetrag haben. Weiter erläutere ich die politischen Hintergründe der Vergabe von Subventionen, sowie die Möglichkeiten des Staates, die Unternehmen zu unterstützen. Danach folgen die Auswirkungen der Subventionen auf die Makroökonomie, mit Hinweis auf die Vertreter der Neoklassik und des Keynesianismus, sowie die Auswirkungen auf die Mikroökonomie anhand eines selbstgewählten Beispiels, welches den Wohlfahrtsverlust durch Subventionen aufzeigen soll. In meinem Fazit präsentiere ich dann meine persönliche Meinung zu Subventionen und beantworte so die Frage: „Subventionen – Nutzen oder Schaden?“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Subventionsbegriff
- Abgrenzung des Subventionsbegriffs
- Subventionen nach Subventionsbericht der Bundesregierung
- Subventionen nach Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (VGR)
- Subventionen nach Institut für Weltwirtschaft Kiel (IfW Kiel)
- Abgrenzung des Subventionsbegriffs
- Vergabe von Subventionen
- Politische Hintergründe
- Auswirkungen von Subventionen
- Auswirkungen auf die Makroökonomie
- (Neo-) Klassik
- Keynesianismus
- Auswirkungen auf die Mikroökonomie
- Konsumentenrente
- Produzentenrente
- Auswirkungen von Subventionen auf die Gesamtwohlfahrt
- Auswirkungen auf die Makroökonomie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert den Begriff der Subventionen und untersucht deren Auswirkungen auf die Volkswirtschaft. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Definitionen des Subventionsbegriffs und untersucht die politischen Hintergründe der Subventionsvergabe. Zudem werden die Auswirkungen von Subventionen auf die Makro- und Mikroökonomie analysiert, wobei die Perspektiven der Neoklassik und des Keynesianismus beleuchtet werden. Das Beispiel eines selbstgewählten Fallbeispiels soll den Wohlfahrtsverlust durch Subventionen verdeutlichen.
- Definitionen des Subventionsbegriffs
- Politische Hintergründe der Subventionsvergabe
- Auswirkungen von Subventionen auf die Makroökonomie
- Auswirkungen von Subventionen auf die Mikroökonomie
- Wohlfahrtsverlust durch Subventionen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Themenstellung der Hausarbeit vor und gibt einen Überblick über die behandelten Themen.
- Subventionsbegriff: In diesem Kapitel werden verschiedene Definitionen des Subventionsbegriffs erläutert und die Unterschiede in der Abgrenzung des Begriffs aufgezeigt. Die Kapitel betrachten die Definitionen aus der Perspektive des Subventionsberichts der Bundesregierung, der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) und des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW Kiel).
- Vergabe von Subventionen: Dieses Kapitel beleuchtet die politischen Hintergründe der Vergabe von Subventionen und die Möglichkeiten des Staates, Unternehmen zu unterstützen.
- Auswirkungen von Subventionen: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen von Subventionen auf die Makroökonomie, wobei die Perspektiven der Neoklassik und des Keynesianismus beleuchtet werden. Zudem wird ein selbstgewähltes Beispiel zur Veranschaulichung des Wohlfahrtsverlusts durch Subventionen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Subventionen, Subventionsbegriff, Makroökonomie, Mikroökonomie, Neoklassik, Keynesianismus, Wohlfahrtsverlust, politische Hintergründe, Vergabe von Subventionen, Finanzhilfen, Steuervergünstigungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird der Begriff "Subvention" definiert?
Es gibt verschiedene Definitionen, etwa nach dem Subventionsbericht der Bundesregierung, der VGR oder dem IfW Kiel, die jeweils unterschiedliche Umfänge an Finanzhilfen und Steuervergünstigungen einschließen.
Welche Position vertritt die Neoklassik gegenüber Subventionen?
Die Neoklassik sieht Subventionen eher kritisch, da sie Marktverzerrungen verursachen und zu einem Wohlfahrtsverlust führen können.
Was sagt der Keynesianismus zur Subventionspolitik?
Aus keynesianischer Sicht können Subventionen sinnvoll sein, um die Nachfrage zu steuern, Wirtschaftszweige zu stützen oder Krisen abzufedern.
Was versteht man unter Konsumenten- und Produzentenrente?
Dies sind mikroökonomische Maße für die Wohlfahrt; Subventionen verändern diese Renten und führen oft zu einem "Deadweight Loss" (Wohlfahrtsverlust) für die Gesamtwirtschaft.
Was sind die politischen Hintergründe für die Vergabe von Subventionen?
Politische Ziele können der Erhalt von Arbeitsplätzen, die Förderung neuer Technologien oder der Schutz heimischer Industrien vor internationalem Wettbewerb sein.
- Quote paper
- Sandra Meissner (Author), 2018, Subventionen. Nutzen oder Schaden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/411772