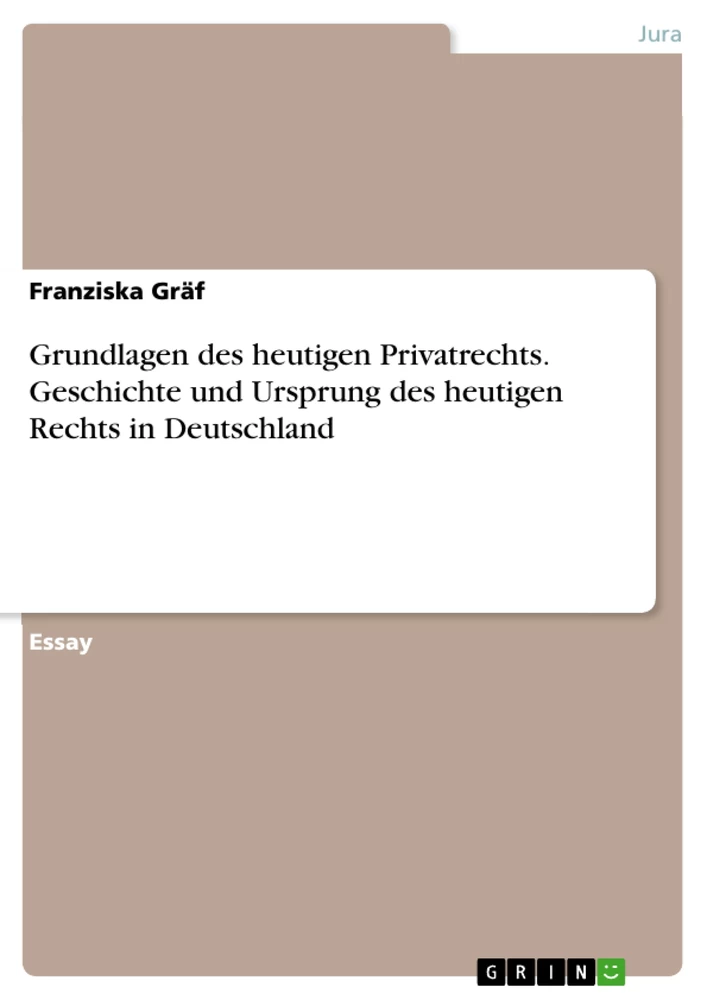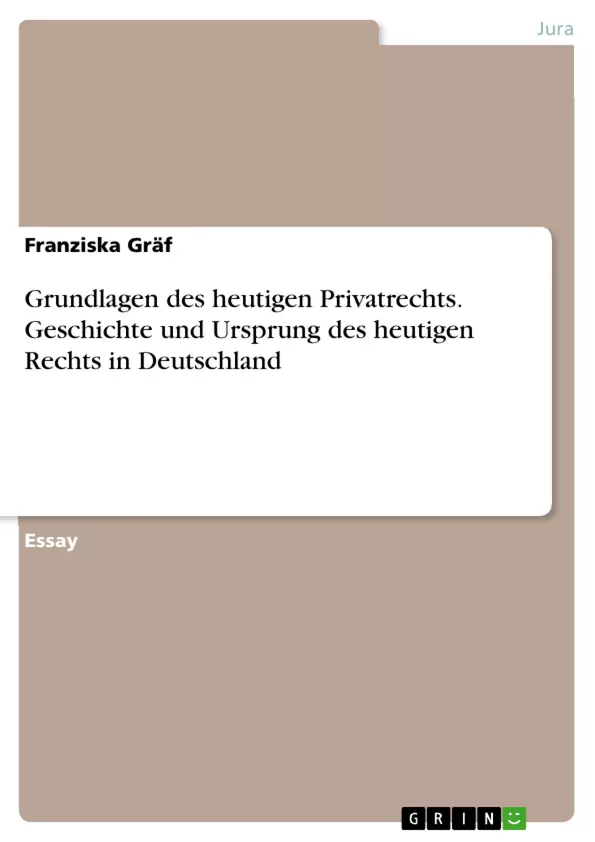Die Literatur des deutschen Privatrechts setzt bereits im 13. Jahrhundert mit dem Rechtsbuch des Ritters Eyke von Repgowe, dem Sachenspiegel, zwischen 1220 und 1235 ein. Noch im 14.Jahrhundert beginnen im römischen Recht gebildete Juristen den Sachenspiegel und andere Rechtsbücher zu glossieren, um deren Harmonie mit dem römisch-kanonischen Recht nachzuweisen. Mit der Rezeption hört die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem deutschen Recht allerdings auf und das römische Recht trat an seine Stelle. Erst in der frühen Neuzeit, sowie in der frühen Moderne schritt die Schaffung eines einheitlichen Privatrechts erneut in einem langwierigen Prozess voran.
Inhaltsverzeichnis
- Grundlagen des heutigen Privatrechts - Geschichte und Ursprung des heutigen Rechts in Deutschland
- Die Anfänge des Privatrechts in Deutschland
- Die Rezeption des römischen Rechts
- Die Entstehung eines einheitlichen Privatrechts
- Die Entwicklung des BGB
- Die Reichszuständigkeit für das Zivilrecht
- Die Arbeit der Kommissionen
- Die Kritik am ersten Entwurf des BGB
- Die Verabschiedung des BGB
- Die Kritik am BGB
- Das BGB im Wandel der Zeit
- Das BGB während der Weimarer Republik
- Das BGB im Nationalsozialismus
- Das BGB in der Nachkriegszeit
- Die Schuldrechtsmodernisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des deutschen Privatrechts, insbesondere die Entstehung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Sie verfolgt das Ziel, die Entstehung des BGB von seinen Anfängen bis zur heutigen Zeit nachzuvollziehen und die wichtigsten Entwicklungsschritte und Einflüsse aufzuzeigen.
- Die Anfänge des deutschen Privatrechts
- Die Rezeption des römischen Rechts und ihr Einfluss auf die Entwicklung des deutschen Rechts
- Die Herausforderungen bei der Schaffung eines einheitlichen deutschen Privatrechts im 19. Jahrhundert
- Die Entwicklung des BGB: Vom ersten Entwurf bis zur Verabschiedung
- Die Anpassung des BGB an die gesellschaftlichen Veränderungen im 20. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung der Anfänge des deutschen Privatrechts im 13. Jahrhundert, ausgehend vom Sachsenspiegel des Ritters Eyke von Repgowe. Anschließend wird die Rezeption des römischen Rechts im 14. Jahrhundert beschrieben, die zu einer Unterbrechung der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem deutschen Recht führte. Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen bei der Schaffung eines einheitlichen Privatrechts im 19. Jahrhundert und die Bedeutung des Wiener Kongresses 1815 und der Revolutionen von 1830 und 1848. Es geht auf die Entstehung des BGB ein, beginnend mit der Reichsgesetzgebung 1873 und den Arbeiten der Kommissionen zur Entwicklung des Gesetzesentwurfs. Die Kritik am ersten Entwurf des BGB und die letztendliche Verabschiedung des Gesetzes im Jahr 1896 werden ebenfalls erläutert. Der letzte Abschnitt des Kapitels beleuchtet die Anpassung des BGB an die gesellschaftlichen Veränderungen im 20. Jahrhundert, einschließlich der Weimarer Republik, des Nationalsozialismus, der Nachkriegszeit und der Schuldrechtsmodernisierung.
Schlüsselwörter
Deutsches Privatrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Geschichte des Rechts, Rezeption des römischen Rechts, Sachsenspiegel, Reichsgesetz, Gesetzgebungsprozess, Kritik, Anpassung, Schuldrechtsmodernisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Sachsenspiegel und warum ist er wichtig?
Der Sachsenspiegel (ca. 1220-1235) von Eyke von Repgowe ist das älteste Rechtsbuch des deutschen Privatrechts und bildet die Grundlage der frühen Rechtsliteratur in Deutschland.
Wie beeinflusste das römische Recht die deutsche Rechtsgeschichte?
Durch die Rezeption im 14. Jahrhundert trat das römische Recht an die Stelle der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem heimischen deutschen Recht, was die Rechtsentwicklung massiv prägte.
Wann wurde das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) verabschiedet?
Das BGB wurde nach einem langwierigen Prozess im Jahr 1896 verabschiedet und trat am 1. Januar 1900 in Kraft.
Welche Kritik gab es am ersten Entwurf des BGB?
Der erste Entwurf wurde oft als zu abstrakt, unsozial und zu stark am römischen Recht orientiert kritisiert, was zu Überarbeitungen in der zweiten Kommission führte.
Wie veränderte sich das BGB im Nationalsozialismus?
Die Arbeit beleuchtet, wie das BGB während der NS-Zeit ideologisch überlagert wurde, bevor es in der Nachkriegszeit wieder auf demokratische Grundwerte zurückgeführt wurde.
Was war die Schuldrechtsmodernisierung?
Dies war eine der bedeutendsten Reformen des BGB in der jüngeren Geschichte, um das Recht an moderne Anforderungen und EU-Vorgaben anzupassen.
- Quote paper
- Franziska Gräf (Author), 2017, Grundlagen des heutigen Privatrechts. Geschichte und Ursprung des heutigen Rechts in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/411878