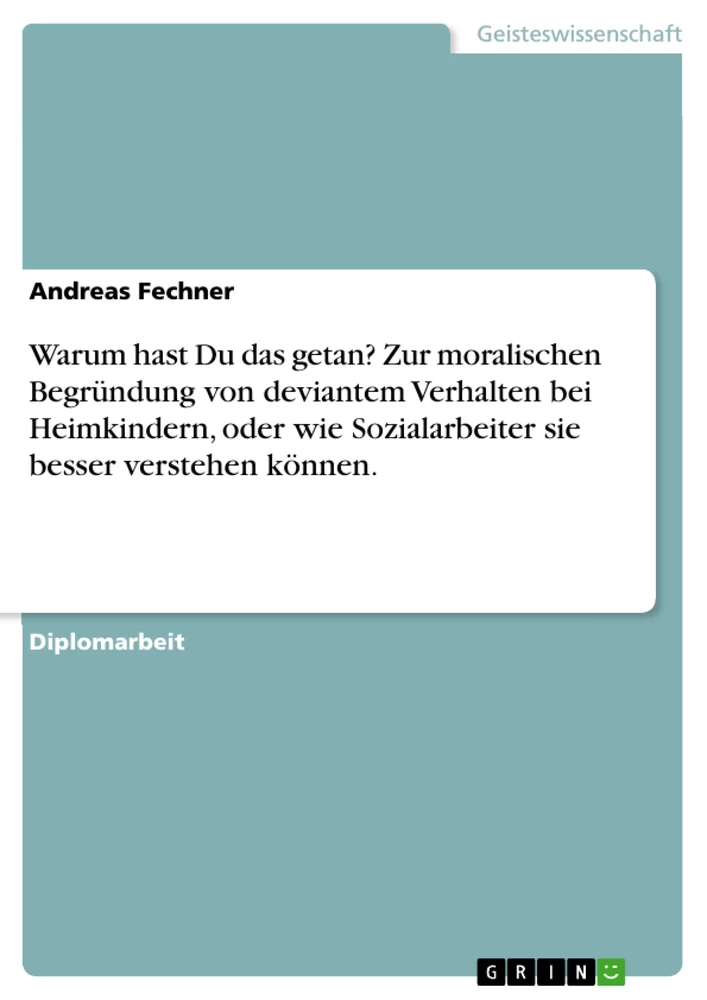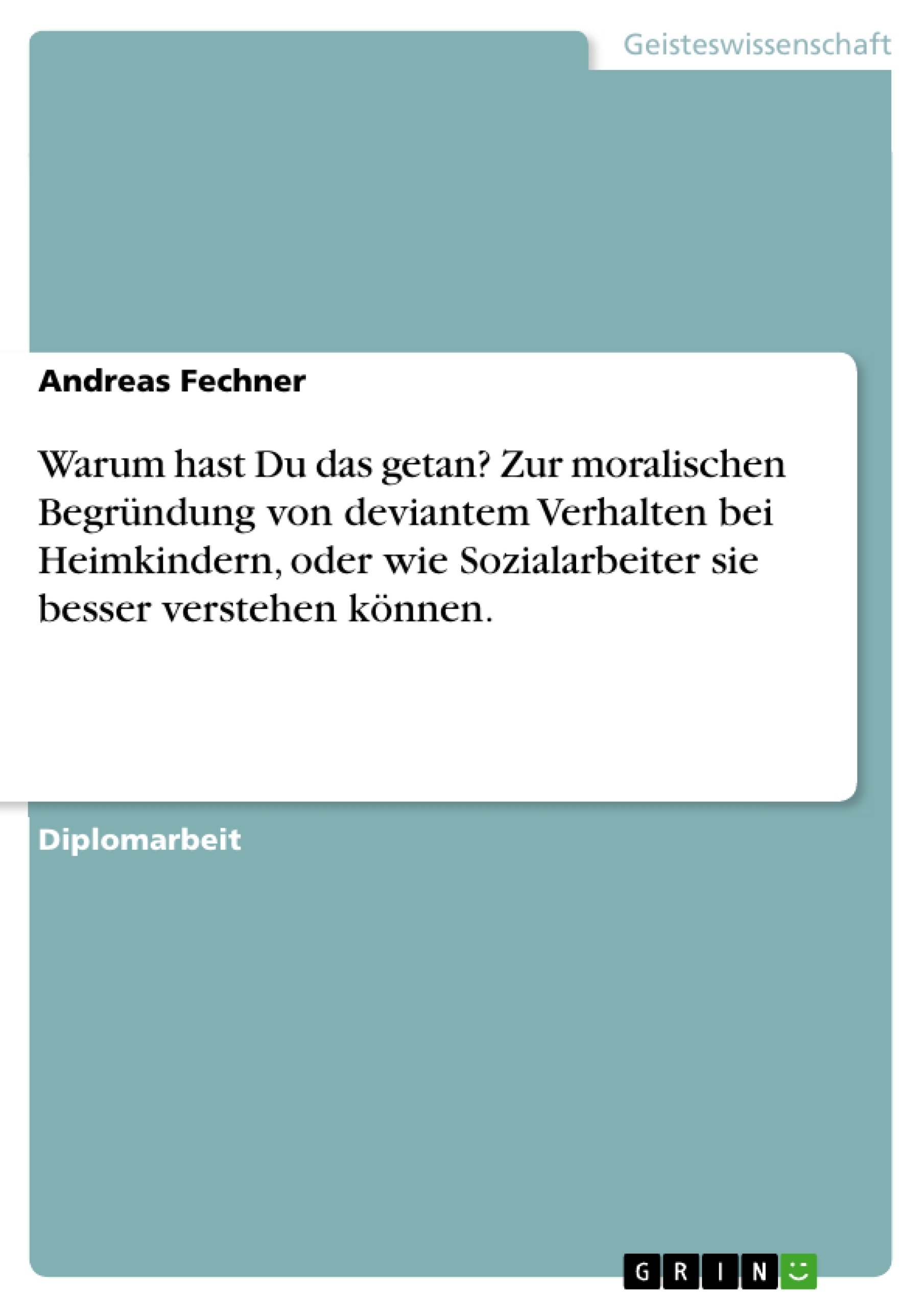Einleitung
Daniela ist 18 Jahre alt und wohnt in einem Sozial-Therapeutischen Jugendwohnhaus. Sie konnte bei ihrer medikamenten-abhängigen Mutter und ihrem Stiefvater nicht mehr wohnen. Die Mutter hat sie Medikamente besorgen geschickt und den Besuch der Schule verboten. Daniela erreichte nach langem ringen beim Jugendamt, dass sie von ihrer Mutter weg konnte. Daniela und ihrer kleinen Schwester wurde vom Jugendamt eine Wohnung vermittelt. Da Daniela schon siebzehn Jahre alt war glaubte das Jugendamt sie könne sich um ihre Schwester kümmern. Daniela wollte sich jetzt auf den Hauptschulabschluss konzentrieren, da ihr die Wichtigkeit eines Schulabschlusses bewusst war. Sie besuchte die Schule sehr unregelmäßig und musste sie wegen zu viel Fehlzeiten verlassen. Das Jugendamt erkannte die Notwendigkeit einer Betreuung. Auf dem Hintergrund der Vorgeschichte und durch Gespräche mit Daniela erwog das Jugendamt die Finanzierung eines Platzes im Sozial-Therapeutischen-Jugendwohnhaus(JWH). Sie zog ins JWH ein. Mit der Selbstständigkeit im eigenen Zuhause war sie überfordert. Die Finanzierung des Wohnhausplatzes war an den Besuch der Schule gekoppelt. Daniela ist 18Jahre alt und hat die Schulpflicht erfüllt. Bei Schwänzen der Schule droht ihr der Rausschmiß aus Schule, dem JWH und der Abrutsch in die Sozialhilfe. Nach zwei Monaten im JWH begann sie die Schule zu schwänzen und die Maßnahme wurde nach Verwarnungen durch das Jugendamt beendet.
Die Frage der Betreuer und mir als Praktikanten war: ,,Warum hast du das getan?"
Während meiner Studienpraktika und danach folgenden Urlaubsvertretungen konnte ich die Arbeit in dem Sozial-Therapeutischen-Jugendwohnhaus kennen lernen. Hierbei konnte ich verschiedene Schicksale von Jugendlichen erleben, die alle schlechte Erlebnisse in der Familie gemeinsam hatten. In den meisten der Fälle musste auch mit deviantem Verhalten gerechnet werden. Durch den Kontakt zum Jugendwohnhaus der nun drei Jahre besteht, konnte ich die Entwicklungen in der Betreuung der Jugendlichen mit verfolgen. Ich musste hierbei feststellen, dass drei-viertel der Fälle in die Sozialhilfe abrutschen und die Hilfe in bezug auf die Entwicklung einer neuen Rollenperspektive als Auszubildender nicht erfolgreich war. Deviantes Verhalten war hierbei der Grund für das Scheitern.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärungen
- Heimkinder
- Jugend
- Moral
- Normen
- Werte
- Konventionen
- Devianz
- Heimkinder
- Institution Heim
- Zielgruppe: Heimkind
- Gefährdungslagen
- Der Leidensweg
- Fallbezug
- Die Entwicklung zur individuellen Persönlichkeit
- Entwicklungsphasen
- Jugendalter/Heranwachsen
- Adoleszenz
- Entwicklungsaufgaben
- Der Überbegriff: Jugend
- Der Weg zur Selbstständigkeit
- Das biologische Reifen
- Pubertätswachstumsschub
- Geschlechtsreifung
- Die Entwicklung von Beziehungen
- Endogen-organismische Modell
- Exogen-kontextuelles Modell
- Handlungstheoretisch-konstruktivistische Modell
- Peergroups-Elternbeziehungsmodell
- Die Entwicklung von Identität
- Identitätstheorie nach Erikson
- Berufliche Identität/ ein Problem für Heimkinder
- Entwicklungsaufgaben und Krisen des Adoleszenten
- Belastungsfaktoren
- DSM-III R
- MAS
- Moralische Entwicklung
- Entwicklung eines moralischen Urteils
- Klugheit
- Moral
- Abwehrstrategie oder um Lösung bemühen
- Das Kind ist kein schlechter Erwachsener
- Entwicklungstheorie
- Stufen der Entwicklung
- Zwischenstufen
- Entwicklungsfaktoren
- Vergleich zwischen Moral, Kognition und Perspektivenübernahme
- Devianz
- Erklärungsmodelle von Devianz
- Die Anomietheorie
- Theorie der Ziel-Mittel Diskrepanz
- Die Subkulturtheorie
- Die Theorie des differentiellen Lernens
- Die Zuschreibungsansätze
- Das Teufelskreismodell
- Prävention- oder Handlungsansätze
- Gefährdungslagen
- Deviantes Verhalten moralisch begründen
- Fallbeispiel Daniela
- Fallbeispiel Marijan
- Pädagogische Grundmodelle der moralischen Erziehung
- Die romantische Erziehungsphilosophie
- Der werteübermittlungs oder technologische Ansatz
- Der progressive Ansatz
- Der Disskursansatz
- Prävention durch Sozialarbeiter oder Betreuer
- Stimulierung der moralischen Entwicklung/ Nachholtheorie
- Messen der moralischen Urteilsfähigkeit
- Entwicklungsförderung betreiben
- Prävention von Seiten des Staates
- Die Polizei
- Das Gesetz
- Die Schule
- Schlußbetrachtung
- Die Herausforderungen und Belastungsfaktoren, denen Heimkinder im Alltag begegnen
- Die Entwicklung der Persönlichkeit und der moralischen Urteilsfähigkeit von Jugendlichen, insbesondere im Kontext von Heimerziehung
- Die Rolle von Sozialarbeitern bei der Prävention und Bewältigung von deviantem Verhalten
- Die Bedeutung von moralischen Erziehungskonzepten in der Arbeit mit Heimkindern
- Die Anwendung verschiedener Erklärungsmodelle für deviantes Verhalten in der Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit von Andreas Fechner beschäftigt sich mit der moralischen Begründung von deviantem Verhalten bei Heimkindern. Das Ziel ist es, Sozialarbeiter ein besseres Verständnis für dieses Verhalten zu ermöglichen, indem die Entwicklung und die moralische Urteilsfähigkeit von Heimkindern beleuchtet werden.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt die Arbeit mit zwei Fallbeispielen von Heimkindern, Daniela und Marijan, ein, die unterschiedliche Formen von deviantem Verhalten aufzeigen. Diese Beispiele dienen als Ausgangspunkt für die weitere Betrachtung der Themen der Arbeit.
Das erste Kapitel erläutert die wichtigsten Begrifflichkeiten, die im Zusammenhang mit der Arbeit verwendet werden, darunter Heimkinder, Jugend, Moral, Normen, Werte, Konventionen und Devianz.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Institution Heim und der Zielgruppe der Heimkinder, beleuchtet die Gefährdungslagen, denen diese ausgesetzt sind, und geht auf den Leidensweg und Fallbeispiele ein.
Das dritte Kapitel widmet sich der Entwicklung der individuellen Persönlichkeit und beschreibt die Entwicklungsphasen und -aufgaben des Jugendalters und der Adoleszenz. Es befasst sich mit der Entstehung von Identität und den Belastungsfaktoren, denen Jugendliche in dieser Zeit ausgesetzt sein können.
Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die moralische Entwicklung und die Entwicklung eines moralischen Urteils bei Jugendlichen. Es untersucht verschiedene Entwicklungstheorien und die Rolle von Moral und Kognition in der Perspektivenübernahme.
Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema Devianz und verschiedenen Erklärungsmodellen für dieses Verhalten, wie der Anomietheorie, der Theorie der Ziel-Mittel-Diskrepanz, der Subkulturtheorie, der Theorie des differentiellen Lernens, den Zuschreibungsansätzen und dem Teufelskreismodell.
Das sechste Kapitel analysiert Präventions- und Handlungsansätze in der Arbeit mit Heimkindern. Es betrachtet die Bedeutung der moralischen Begründung von deviantem Verhalten, verschiedene pädagogische Grundmodelle der moralischen Erziehung und die Rolle von Sozialarbeitern bei der Prävention von deviantem Verhalten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Heimkinder, Jugend, Moral, Devianz, moralische Entwicklung, Pädagogik, Sozialarbeit, Prävention, Erklärungsmodelle, Handlungsansätze und Fallbeispiele. Die Arbeit befasst sich mit der moralischen Begründung von deviantem Verhalten bei Heimkindern und zielt darauf ab, Sozialarbeiter ein besseres Verständnis für dieses Verhalten zu ermöglichen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter deviantem Verhalten bei Heimkindern?
Deviantes Verhalten bezeichnet Handlungen, die von den gesellschaftlichen Normen abweichen, wie z. B. Schulschwänzen, Aggressivität oder Delinquenz, oft als Reaktion auf traumatische Vorerfahrungen.
Warum scheitern viele Maßnahmen in der Jugendhilfe?
Das Dokument zeigt auf, dass oft die Entwicklung einer stabilen Rollenperspektive fehlt und Jugendliche durch Belastungsfaktoren in ihrer moralischen Entwicklung blockiert sind.
Wie hängen Moral und Devianz zusammen?
Deviantes Verhalten kann oft moralisch begründet sein (z. B. Überlebensstrategie), was Sozialarbeiter verstehen müssen, um die moralische Urteilsfähigkeit der Jugendlichen gezielt zu fördern.
Was sind die Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz?
Dazu gehören die Ablösung von den Eltern, der Aufbau von Peer-Beziehungen, die Akzeptanz der eigenen Körperlichkeit und die Entwicklung einer beruflichen Identität.
Welche Rolle spielen Sozialarbeiter bei der Prävention?
Sie fungieren als Begleiter, die durch Stimulierung der moralischen Entwicklung und Schaffung von Erfahrungsräumen helfen, den "Teufelskreis" der Devianz zu durchbrechen.
- Citar trabajo
- Andreas Fechner (Autor), 2002, Warum hast Du das getan? Zur moralischen Begründung von deviantem Verhalten bei Heimkindern, oder wie Sozialarbeiter sie besser verstehen können., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4121