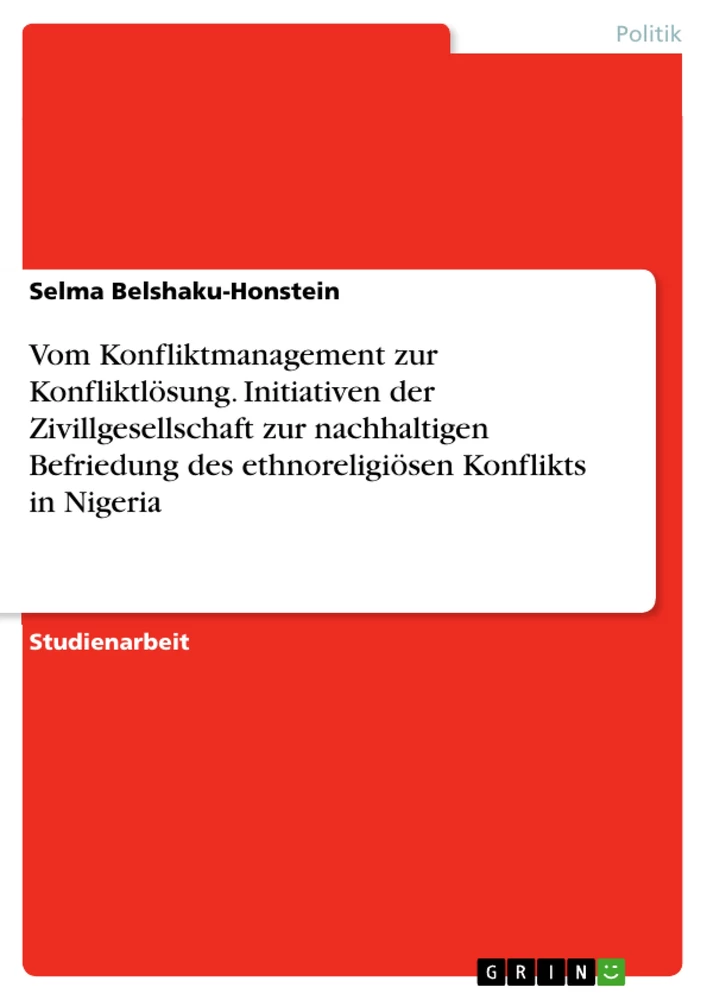Mit ca. 150 Millionen Einwohnern ist Nigeria nicht nur das bevölkerungsreichste Land Afrikas, sondern auch ein sehr komplexer, multiethnischer und multikultureller Staat mit vielen Religionen. Es beheimatet ca. 395 Volksgruppen, rund 514 Sprachen und Idiome werden gesprochen. Einer Studie von 2003 zufolge sind 50,5 % der Nigerianer Muslime, 48,2% Christen und nur ein kleiner Bevölkerungsanteil bekennt sich zur traditionellen afrikanischen Religion.
Neben der hohen Arbeitslosigkeit und der Armut gibt es viele andere Probleme in Nigeria wie z.B. eine allgegenwärtige Korruption in der Politik und Verwaltung auf zentraler wie lokaler Ebene, marode öffentliche Infrastruktur und dazu noch Gewaltkonflikte in verschiedenen Regionen des Landes – Middle Belt, Nigerdelta und im Norden - mit zahlreichen Opfern und großer Zerstörungskraft. Beim Konflikt im Middle Belt, mit der Hauptstadt Jos des Bundesstaates Plateau als Epizentrum, geht es um den Kampf zwischen den indigenen Volksgruppen, den „Einheimischen“, die überwiegend christlich sind, und den zugezogenen, mehrheitlich moslemischen Volksgruppen, die als „Siedler“ gelten, um wirtschaftliche und politische Vormachtstellung. Die blutigen Auseinandersetzungen in Jos sind im großen Ausmaß erst im September 2001 ausgebrochen und haben über 1000 Tote abverlangt.
Weitere Episoden der Massentötung mit Zerstörung von Kirchen und Moscheen, Priesterseminaren, Schulen, Geschäfte und Häuser einschließlich des Stadtmarktes ereigneten sich in den Jahren 2002, 2004, 2008 und 2010. Die Folge sind Tausende Tote, Hunderttausende Binnenvertriebene, eine Spaltung der Stadt nach ethnischen und religiösen Grenzen und ein Klima der Unsicherheit und Angst. Der blutige Konflikt in Jos hat sich auf andere Teile des Bundesstaates Plateau, bzw. die ländlichen Gebiete ausgebreitet. Massenmorde gab es in vielen Dörfern in der Umgebung von Jos insbesondere in den Jahren 2001-2002 und 2010.
Seit der Krise im Jahr 2011 hat sich die Lage in Plateau, insbesondere in Jos, deutlich verbessert. Mit Ausnahme der Bombenanschläge von Boko Haram gab es seit 2011 keine Gewaltausschreitungen mehr. Im Februar 2016 wurde in der LGA Jos-Süd mit Beteiligung von SFCG die Rückkehr des Friedens gefeiert. Welchen Beitrag haben die NGOs und speziell SFCG zur Wiederkehr des friedlichen Zusammenlebens in Jos geleistet?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Konflikt in Plateau und seiner Hauptstadt Jos – Ursachen und verschärfende Faktoren
- Maßnahmen des Staates zur Konfliktbewältigung
- Friedensinitiativen der Zivilgesellschaft. Die Arbeit der SFCG in Kooperation mit lokalen NRO
- Aktivitäten der NROs in Jos im Bereich Konfliktmanagement und Friedensbildung
- Die Arbeit der SFCG: das Projekt „Plateau will Arise!“
- Der Schlüssel zum nachhaltigen Frieden in Plateau - Analyse und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert den ethnoreligiösen Konflikt im Bundesstaat Plateau, Nigeria, mit Fokus auf die Rolle der Zivilgesellschaft in der Konfliktlösung. Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen der zivilgesellschaftlichen Initiativen zur nachhaltigen Befriedung des Konflikts zu beleuchten.
- Ursachen und Eskalation des Konflikts in Plateau
- Zivilgesellschaftliche Initiativen zur Konfliktlösung
- Herausforderungen und Chancen der Zivilgesellschaft in der Konfliktbearbeitung
- Analyse der Nachhaltigkeit von Friedensinitiativen
- Potenziale und Grenzen der zivilgesellschaftlichen Friedensarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über den ethnoreligiösen Konflikt in Plateau und die Rolle der Zivilgesellschaft in der Konfliktlösung. Kapitel 2 beleuchtet die Ursachen und verschärfenden Faktoren des Konflikts in Plateau, während Kapitel 3 die Maßnahmen des Staates zur Konfliktbewältigung untersucht. Kapitel 4 analysiert die Arbeit der zivilgesellschaftlichen Organisation Search for Common Ground (SFCG) in Kooperation mit lokalen Nichtregierungsorganisationen (NROs) im Bereich des Konfliktmanagements und der Friedensbildung. Schließlich diskutiert Kapitel 5 die Schlüsselfaktoren für einen nachhaltigen Frieden in Plateau und zieht ein Fazit.
Schlüsselwörter
Ethnoreligiöser Konflikt, Nigeria, Plateau, Jos, Zivilgesellschaft, Friedensförderung, Konfliktmanagement, nachhaltige Befriedung, NROs, Search for Common Ground (SFCG), Plateau Will Arise!.
- Quote paper
- Selma Belshaku-Honstein (Author), 2017, Vom Konfliktmanagement zur Konfliktlösung. Initiativen der Zivillgesellschaft zur nachhaltigen Befriedung des ethnoreligiösen Konflikts in Nigeria, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412306