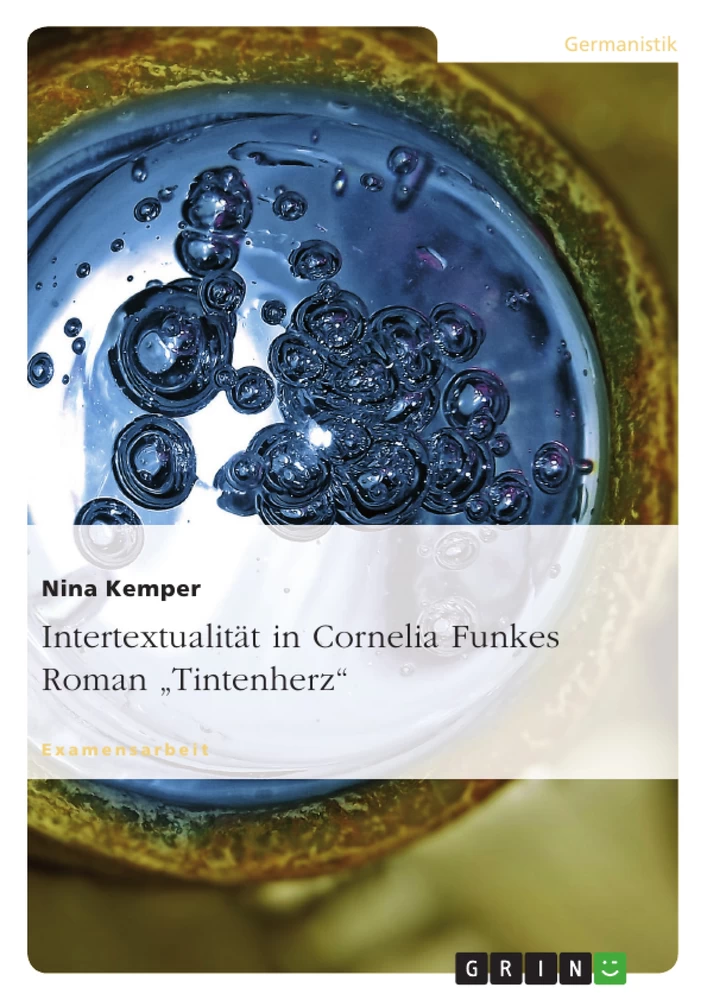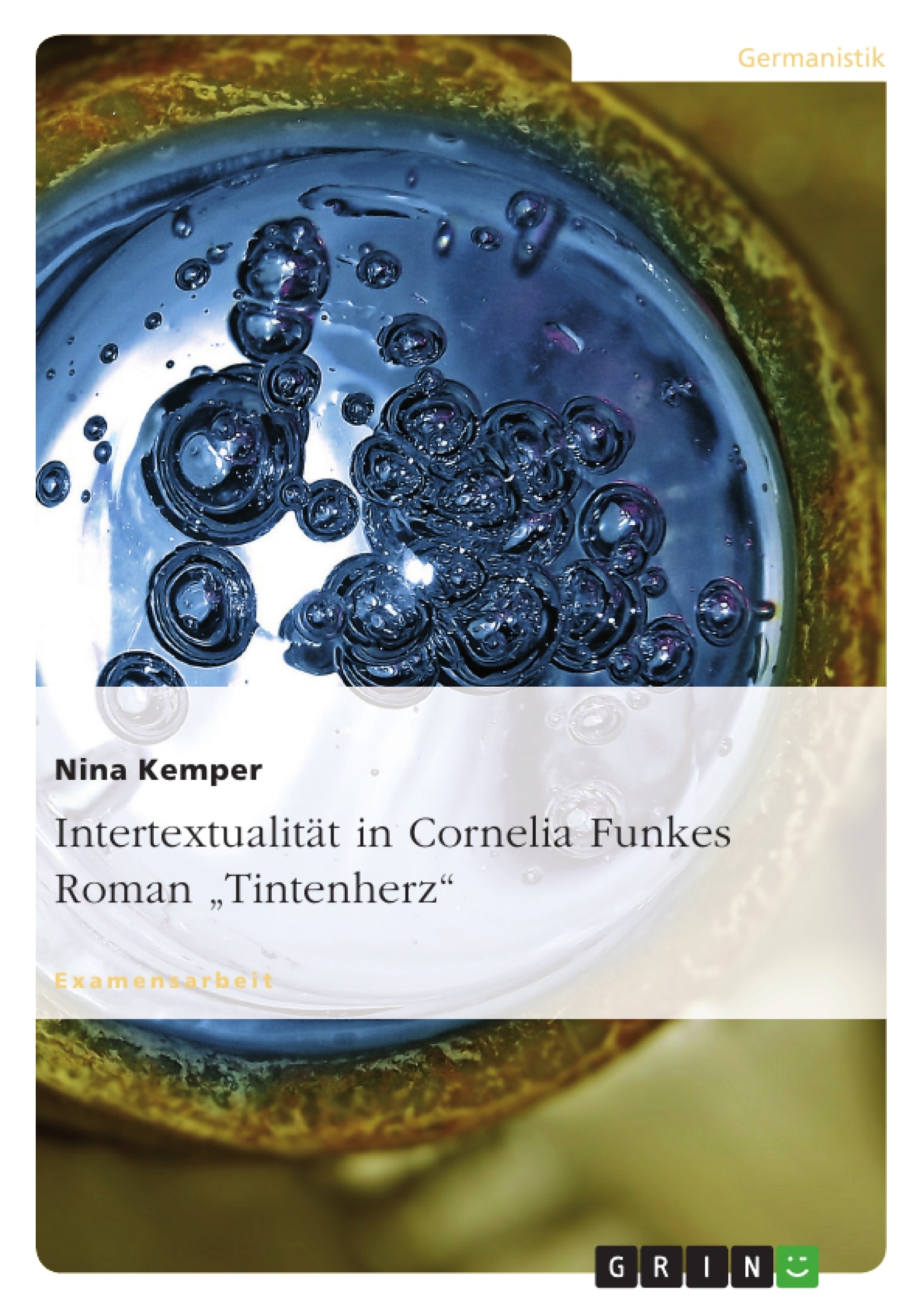Um dem Thema dieser Arbeit gerecht zu werden, ist es zunächst notwendig, den noch sehr jungen Begriff der Intertextualität näher zu betrachten. Ziel der theoretischen Betrachtung des Intertextualitätsbegriffes im ersten Teil soll es sein, einen Überblick über die theoretischen Erkenntnisse zur Intertextualität zu geben. Um dies zu ermöglichen, betrachtet diese Arbeit die Entwicklung des Begriffes der Intertextualität von Beginn an.
Im Laufe der theoretischen Ausführungen soll von einer weiten Definition des Begriffs zu einer engeren gelangt werden, welche im zweiten Teil für die Analyse von Tintenherz funktionalisiert wird.
Daraus ergibt sich, dass die frühen Konzepte der Intertextualität zwar kurz umrissen werden, die neueren und gleichzeitig konkretisierten Konzepte jedoch von weitaus größerer Bedeutung für diese Arbeit sind. So werden zum Beispiel Ergebnisse der Textverarbeitungsforschung in die Betrachtungen einfließen. Allgemein ist zu beachten, dass die folgenden Ausführungen keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Vielmehr wurden im Rahmen dieser Arbeit eigene inhaltliche Schwerpunkte gesetzt.
Die im ersten Teil gewonnenen Erkenntnisse sollen dann im zweiten Teil konkrete Anwendung bei der Analyse von Cornelia Funkes Tintenherz1 finden. Das Ziel soll dabei sein, die komplexe Intertextualitätsstruktur des Romans zu untersuchen und am Ende zu prüfen, ob die erarbeiteten theoretischen Grundlagen ausreichen, um diese Struktur zu beschreiben.
Im Rahmen der Untersuchungen wird sich zeigen, dass Cornelia Funke das Konzept der Intertextualität sehr vielseitig einsetzt und es so zu einem bedeutenden Charakteristikum ihres Romans macht. Welche Auswirkungen der Einsatz einer großen Anzahl intertextueller Verweise auf den Leser von Tintenherz haben kann und ob sich hinter der Intertextualität unter Umständen sogar der Schlüssel zum Erfolg des Romans verbirgt, wird in diesem Zusammenhang ebenfalls diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil I: Theoretische Grundlagen
- Konzepte der Intertextualität
- Weite Definition: Intertextualität als globales Konzept...
- Michail Bachtins Begriff der Dialogizität
- Intertextualität nach Julia Kristeva
- Enge Definition: Konkretisierung des Begriffs der Intertextualität.
- Gérard Genette
- Ulrich Broich und Manfred Pfister
- Susanne Holthuis
- Peter Stocker
- Formen der Intertextualität
- Formen der Intertextualität nach Genette.
- Einzeltextreferenz und Systemreferenz
- Zitat, Allusion und Paraphrase...
- Titel und Motto als Formen intertextueller Verweise
- Intertextualität und Markierung.
- Arten der Markierung von Intertextualität
- Funktionen der Markierung von Intertextualität¸
- Funktionen von Intertextualität
- Referenztextorientierte Funktionen
- Textorientierte Funktionen
- Produzentenorientierte Funktionen
- Intertextuelle Textverarbeitung.
- Faktoren intertextueller Textverarbeitung.
- Der Prozess intertextueller Textverarbeitung...
- Modelle eines intertextuellen Lesers
- Fazit I
- Teil II: Intertextualität in Cornelia Funkes Roman Tintenherz
- Über Tintenherz
- Die Mottotexte als Form der Intertextualität
- Die Prätexte
- Funktionen der Mottotexte.
- Unterstützung des Kapitelthemas.
- Vorausdeutung..
- Figurencharakterisierung..
- Intertextualität im inneren Kommunikationssystem
- Der intertextuelle Titel
- Das intertextuelle Zitat
- Thematisierung des Inhalts eines Referenztextes
- Einführung eines Referenztextes als physischen Gegenstand.
- Die Präsenz von Figuren aus einem Referenztext_ _
- Funktionen der Intertextualität im inneren Kommunikationssystem_
- Fiktionale Intertextualität
- Die zweiebige Intertextualitätsstruktur
- Formen fiktionaler Intertextualität
- Der Titel Tintenherz_
- Thematisierung des Inhalts von „Tintenherz“.
- „Tintenherz\" als physischer Gegenstand in der Handlung..
- Die Präsenz der Figuren aus „Tintenherz❝
- Funktionen der fiktionalen Intertextualität in Tintenherz
- Intertextualität und doppelte Adressiertheit in Tintenherz
- Fazit II
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Intertextualität und untersucht dessen Anwendung im Roman "Tintenherz" von Cornelia Funke. Der Fokus liegt auf der Analyse der komplexen Intertextualitätsstruktur des Romans und deren Auswirkungen auf die Rezeption des Textes durch den Leser.
- Die Entwicklung des Intertextualitätsbegriffs von einer weiten zu einer engeren Definition
- Die verschiedenen Formen der Intertextualität und deren Funktionsweisen
- Die Rolle der Intertextualität in der Kommunikation innerhalb des Romans
- Die Auswirkungen der Intertextualität auf die Konstruktion der fiktionalen Welt und die Figuren
- Die Bedeutung der Intertextualität für die Rezeption und Interpretation des Romans
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Intertextualität ein und erläutert den Aufbau der Arbeit. Im ersten Teil werden verschiedene Konzepte der Intertextualität von ihrer frühen Entwicklung bis hin zu modernen Konzepten der Textverarbeitungsforschung vorgestellt. Der zweite Teil analysiert die Intertextualitätsstruktur von Cornelia Funkes Roman "Tintenherz" anhand von Beispielen aus dem Text. Dabei werden die Mottotexte, die interne Kommunikation innerhalb des Romans und die fiktionale Intertextualität betrachtet.
Schlüsselwörter
Intertextualität, Dialogizität, Textverarbeitungsforschung, Cornelia Funke, Tintenherz, Mottotexte, interne Kommunikation, fiktionale Intertextualität, Rezeption
- Quote paper
- Nina Kemper (Author), 2005, Intertextualität in Cornelia Funkes Roman "Tintenherz", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41232