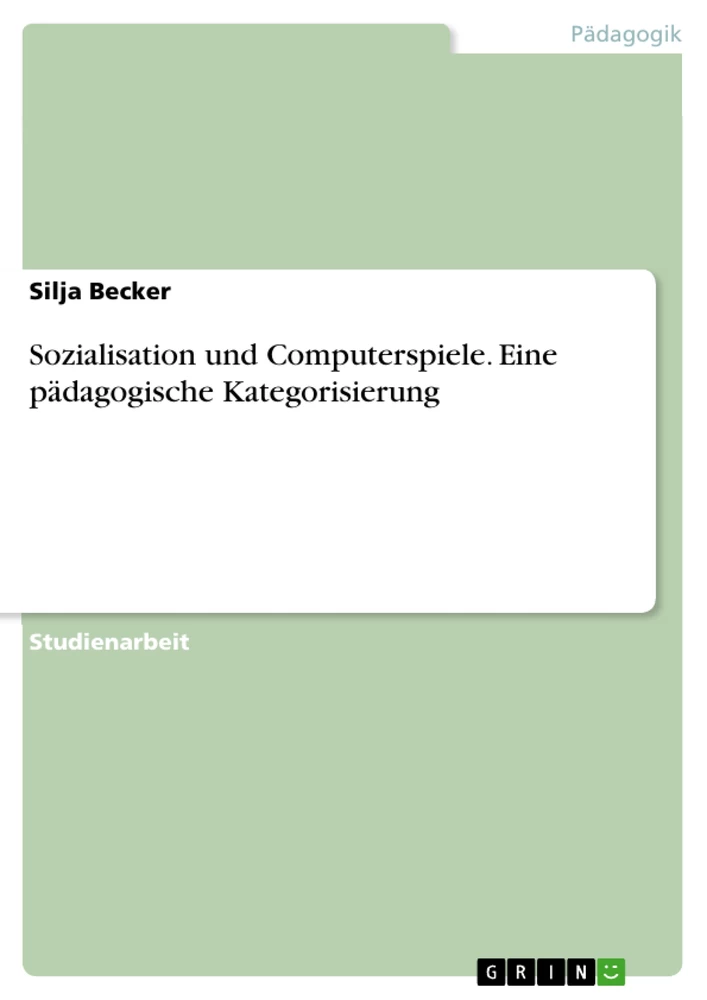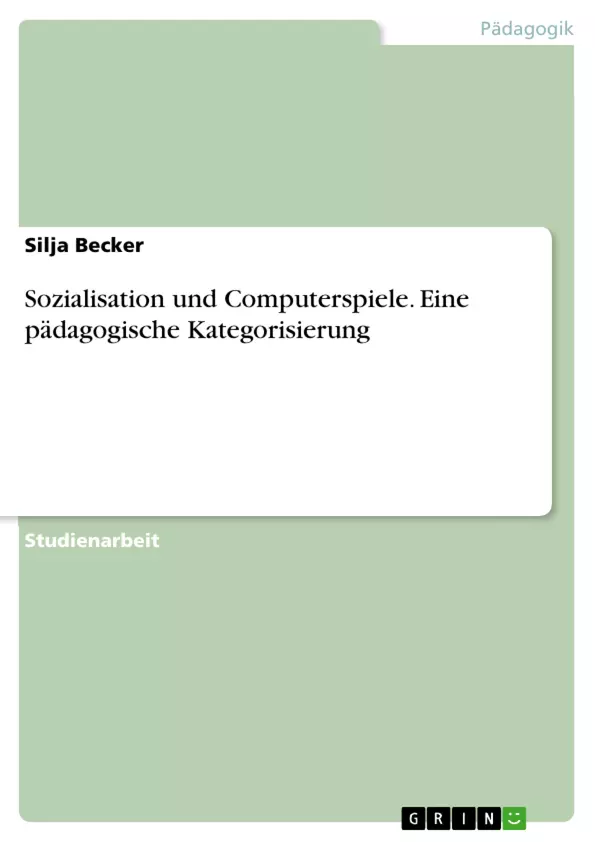Wie müssen Computerspiele pädagogisch kategorisiert werden? Bergen Computerspiele wirklich nur Gefahren und mögliche Chancen werden übersehen? Mit diesen Fragen befasse ich mich in der vorliegenden Hausarbeit.
Dazu wird im folgenden Kapitel zunächst eine Zusammenfassung der Entstehungsgeschichte, eine engere Eingrenzung von Computerspielen und deren Nutzern1 erfolgen. Dem schließt sich die Darlegung über Motivationslagen von Spielern und der Faszination, die von Computerspielen ausgeht, an. Im vierten Abschnitt werden unterschiedliche Theorien zur Wirkung von Computerspielen vorgestellt. Um die Schwierigkeiten bei den Anforderungen an die Medienpädagogik zu verdeutlichen, werde ich im fünften Kapitel die unterschiedlichen Kategorien von Computerspielen erörtern. Im darauffolgenden Abschnitt der Arbeit werde ich dann die ambivalente Sicht auf Computerspiele diskutieren. In gesellschaftlichen Diskussionen wird immer wieder auf die Gefahren von Spielen hingewiesen, was eine sehr einseitige Sichtweise ist. Aber verbirgt sich in Computerspielen nicht vielleicht auch das Potential einer Bildungschance für die Nutzer? Welche Möglichkeiten und Erfolgsaussichten Computerspiele Nutzern bieten können, wird an dieser Stelle verdeutlicht werden. Am Ende dieses Abschnittes werde im Fazit zusammenzutragen, wie es sich mit dem aktuellen Stand von Computerspielen in der Medienpädagogik verhält und welche Aussichten es gibt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Computerspiele und Nutzer
- 2.1 Computerspiele – eine historische Zusammenfassung
- 3. Warum spielt jemand Computerspiele? Motivation und Faszination
- 4. Wie wirken Computerspiele?
- 4.1 Die virtuelle Welt in einem konstruktivistischen Wirkungsmodell
- 4.1.1 Die reale Welt
- 4.1.2 Die Traumwelt
- 4.1.3 Die mentale Welt
- 4.1.4 Die Spielwelt
- 4.1.5 Die mediale Welt
- 4.1.6 Die virtuelle Welt
- 4.2 Das Stimulus Response-Modell
- 4.3 Uses-and-Gratification-Approach
- 4.4 Der medienbiographische Ansatz
- 4.5 Lerntheorie
- 4.6 Transfer und Transformation von Medien
- 4.1 Die virtuelle Welt in einem konstruktivistischen Wirkungsmodell
- 5. Kategorien von Computerspielen
- 5.1 Geschicklichkeits- und Denkspiele
- 5.2 Abenteuerspiele
- 5.3 Sportspiele
- 5.4 Flug- und Fahr- und Wirtschaftssimulationen
- 5.5 Strategiespiele
- 5.6 3-D-Shooter
- 5.7 Rollenspiele
- 5.8 Edutainment und Lernsoftware
- 6. Computerspiele - Gefahr oder Chance für den Nutzer?
- 7. Fazit: Wie lässt sich der aktuelle Stand von Computerspielen in der Medienpädagogik zusammenfassen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern Computerspiele sowohl Gefahren als auch Chancen für Nutzer bergen. Sie analysiert die Entstehung und Entwicklung von Computerspielen sowie die Motivationslagen von Spielern. Des Weiteren werden verschiedene Theorien zur Wirkung von Computerspielen vorgestellt und die unterschiedlichen Kategorien von Computerspielen diskutiert.
- Die historische Entwicklung von Computerspielen
- Die Motivation und Faszination von Computerspielen
- Theorien zur Wirkung von Computerspielen
- Die unterschiedlichen Kategorien von Computerspielen
- Die Ambivalenz von Computerspielen als Gefahr oder Chance
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Computerspiele und deren gesellschaftliche Relevanz ein, insbesondere im Kontext von Gewalt und Aggression. Kapitel 2 beleuchtet die Geschichte und Entwicklung von Computerspielen und untersucht die Frage, was ein Spiel ausmacht. Kapitel 3 widmet sich den Motivationen und Faszinationen von Computerspielen. In Kapitel 4 werden verschiedene Theorien zur Wirkung von Computerspielen vorgestellt, darunter das konstruktivistische Wirkungsmodell, das Stimulus Response-Modell, der Uses-and-Gratification-Approach und der medienbiographische Ansatz. Kapitel 5 erörtert die verschiedenen Kategorien von Computerspielen, von Geschicklichkeits- und Denkspielen bis hin zu 3-D-Shootern und Rollenspielen. Das Kapitel 6 befasst sich mit der ambivalenten Sicht auf Computerspiele und untersucht, ob sie eher Gefahren oder Chancen für den Nutzer darstellen.
Schlüsselwörter
Computerspiele, Medienpädagogik, Gewalt, Aggression, Motivation, Faszination, Wirkungsmodell, Kategorien, Gefahr, Chance, Bildung, Nutzer.
Häufig gestellte Fragen
Bergen Computerspiele nur Gefahren oder auch Chancen?
Die Arbeit diskutiert die ambivalente Sichtweise und zeigt auf, dass Computerspiele neben Risiken (Gewalt) auch Bildungspotenziale und Faszination bieten.
Welche Kategorien von Computerspielen werden unterschieden?
Es wird zwischen Geschicklichkeitsspielen, Abenteuerspielen, Simulationen, Strategiespielen, 3D-Shootern, Rollenspielen und Lernsoftware differenziert.
Was besagt das konstruktivistische Wirkungsmodell?
Dieses Modell analysiert, wie Nutzer die virtuelle Welt in Bezug zu ihrer realen, mentalen und medialen Welt setzen und verarbeiten.
Warum faszinieren Computerspiele so viele Menschen?
Die Faszination resultiert aus verschiedenen Motivationslagen, wie dem Erleben von Selbstwirksamkeit, dem Eintauchen in fremde Welten und dem Wettbewerb.
Welchen Stellenwert haben Computerspiele in der Medienpädagogik?
Die Medienpädagogik versucht, Strategien zu entwickeln, um die Bildungschancen von Spielen zu nutzen und gleichzeitig einen kritischen Umgang mit Risiken zu fördern.
- Quote paper
- Silja Becker (Author), 2010, Sozialisation und Computerspiele. Eine pädagogische Kategorisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412392