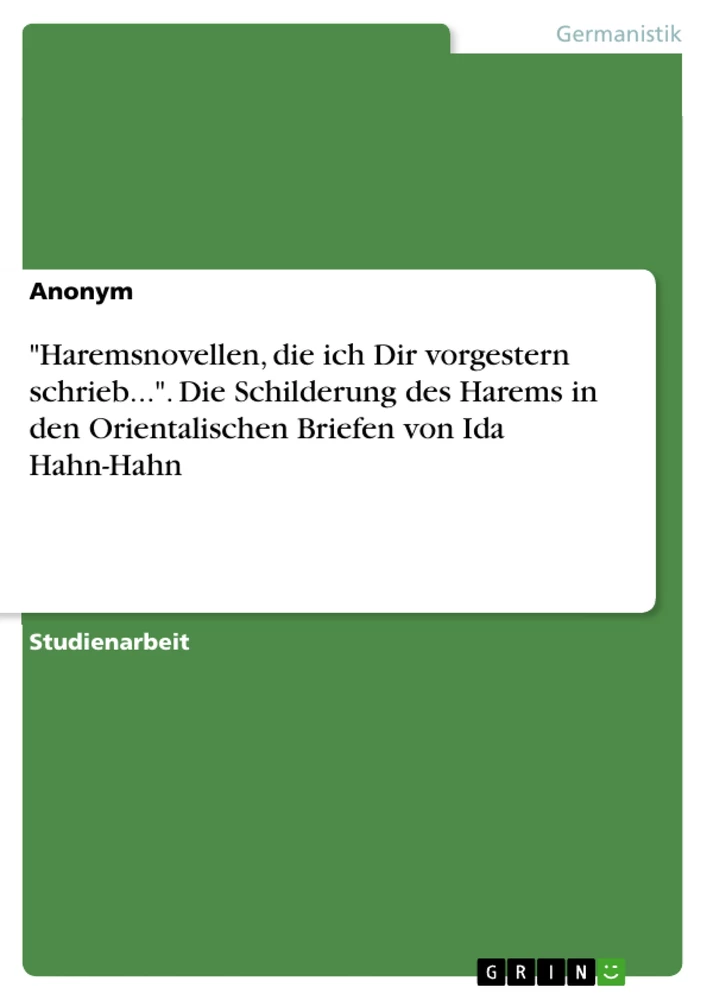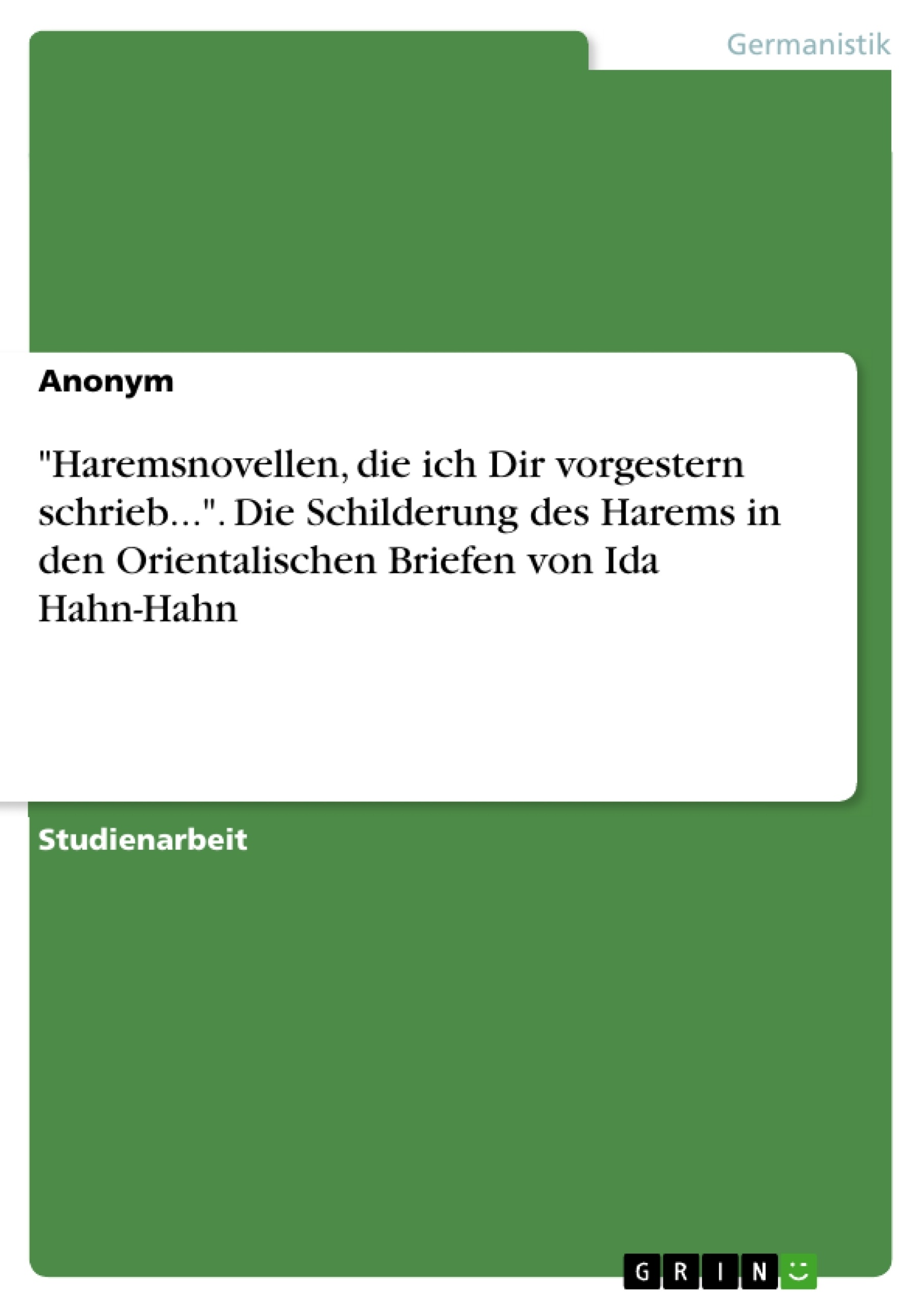"Zu den Haremsnovellen, die ich Dir vorgestern schrieb, liebster Bruder [...]" Dieses Zitat stammt von Ida Hahn-Hahn, nachdem sie ihrem Bruder Ferdinand Graf Hahn in einem ihrer Orientalischen Briefe von dem Harem Rifát Paschas aus Konstantinopel berichtete.
So stellt man sich anfangs bei einem Harem auf Vorstellungen aus 1001 Nacht oder Aladdin und die Wunderlampe ein. Diese Stereotype und Vorurteile des westlichen Blicks auf den Orient untersuchte 1979 Edward Said in seinem Orientalismus-Diskurs, allerdings aus männlicher Perspektive. So war seine Analyse auf die von Männern verfasste Texte und Bilder gestützt. Daher folgt die Frage: Wie aber nehmen Frauen einen solchen Ort wahr?
Der Untersuchungsgegenstand dabei ist der Reisebrief XIV: "Besuch im Harem von Rifát Pascha", aus dem Werk Orientalische Briefe Ida Hahn-Hahns, der im Folgenden auf verschiedene Aspekte hin mit verschiedenen Fragestellungen analysiert werden soll: Einerseits ist gerade die Adressierung des Briefs von besonderem Interesse, da Ida Hahn-Hahn die Haremsschilderung auch ihrer Mutter oder Schwester gleichen Geschlechts hätte schreiben können. Dennoch wollte sie gerade ihrem Bruder über den Harem berichten.
Zum anderen soll untersucht werden, weshalb Ida Hahn-Hahn den Brief wählte und weshalb sie mit der Intention schrieb, dass die Orientalischen Briefe publiziert und somit einem breiten Publikum zugängig gemacht werden. Das bedeutet, welches Bild vermittelt Ida Hahn-Hahn ihrem Leser über den Harem? Wie nimmt sie Fremderfahrungen wahr und inwieweit konstruiert dies ihre eigene Identität? Wie werden die Reiseerfahrungen ihrerseits manifestiert und wie wird Alterität aufgenommen?
Dabei stütze ich mich größtenteils auf die Forschungsliteratur "Der weibliche Blick auf den Orient. Reisebeschreibungen europäischer Frauen im Vergleich" und auf die von Yomb May: "Der Orient ... im Auge einer Tochter des Okzidents …: Ida von Hahn-Hahn und die (De-)Konstruktion kultureller Alterität in den Orientalischen Briefen", da dort die meisten meiner zu untersuchenden Aspekte ausführlich behandelt und analysiert werden und sie in meinem Inhaltsverzeichnis die neueste Forschungsliteratur zu diesem Thema darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Ida Hahn-Hahns Reisemotiv.
- Brief XIV: „Besuch im Harem von Rifát Pascha“.
- Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Reisebrief XIV: „Besuch im Harem von Rifát Pascha“ aus Ida Hahn-Hahns „Orientalischen Briefen“. Der Fokus liegt auf der Analyse der Haremsschilderung aus weiblicher Perspektive und der Konstruktion von Identität durch die Reiseerfahrungen. Dabei werden folgende Themenschwerpunkte beleuchtet:
- Die Adressierung des Briefs an ihren Bruder und die Auswahl des Themas Harem.
- Die Vermittlung eines bestimmten Bildes vom Harem an das breite Publikum.
- Die Wahrnehmung von Fremderfahrungen und die Konstruktion der eigenen Identität.
- Die Manifestation von Reiseerfahrungen und die Aufnahme von Alterität.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Das Zitat von Ida Hahn-Hahn, in dem sie ihrem Bruder von ihrem Besuch im Harem von Rifát Pascha erzählt, bildet den Ausgangspunkt der Arbeit. Der Text greift die Problematik des stereotypen, männlichen Blicks auf den Orient auf, den Edward Said in seinem Orientalismus-Diskurs analysierte. Im Fokus der Untersuchung steht der Reisebrief XIV, der aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird, um die Konstruktion von Geschlecht und Identität im Kontext des Orientalismus zu analysieren.
2. Ida Hahn-Hahns Reisemotiv
Ida Hahn-Hahn unternahm ihre Reise in den Orient nach ihrer Scheidung von ihrem Ehemann, um den Schmerz zu verarbeiten und sich neu zu orientieren. Ihr Interesse für den Orient wurde durch verschiedene Faktoren wie ihr Erzähltalent, ihre Bewunderung für George Byron und den Einfluss des Ägyptenfeldzugs Napoleons geprägt. Die Orientalischen Briefe, in denen sie ihre Reiseerfahrungen festhielt, wurden 1844 veröffentlicht und waren ein großer Erfolg.
3. Brief XIV: „Besuch im Harem von Rifát Pascha“
Der Brief an ihren Bruder beginnt mit der Beschreibung der "unglaublichen Satisfaction", die Ida Hahn-Hahn empfindet, ihm von einem Ort erzählen zu können, der Männern vorenthalten ist. Der Harem, als Frauen- und Kinderbereich, wird als Ort der Exklusivität und Authentizität dargestellt. Die Autorin betont, dass Frauen Einblicke in diesen Raum erhalten können, die Männern verwehrt bleiben, und hebt damit die besondere Perspektive ihrer Schilderung hervor.
Schlüsselwörter
Orientalische Briefe, Ida Hahn-Hahn, Harem, Geschlechterkonstruktionen, Orientalismus, Reiseerfahrungen, Identität, Alterität, weiblicher Blick, Fremderfahrungen, Reisemotive.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Ida Hahn-Hahn?
Ida Hahn-Hahn war eine bekannte deutsche Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts, die durch ihre Reiseberichte, insbesondere die „Orientalischen Briefe“, berühmt wurde.
Wie unterscheidet sich ihr Blick auf den Harem von männlichen Berichten?
Da Männern der Zutritt zum Harem verwehrt war, basierten ihre Berichte oft auf Fantasien. Ida Hahn-Hahn konnte als Frau reale Einblicke gewinnen und beschrieb den Ort als authentischen Lebensraum.
Warum adressierte sie den Brief über den Harem an ihren Bruder?
Dies ist von besonderem Interesse, da sie ihm exklusive Informationen über einen Ort lieferte, den er selbst niemals betreten durfte, was ihre Position als privilegierte Beobachterin stärkte.
Was kritisierte Edward Said am Orientalismus?
Said kritisierte die westliche, oft klischeehafte und machtgeladene Konstruktion des Orients durch europäische Autoren, wobei er sich jedoch primär auf männliche Perspektiven konzentrierte.
Welches Bild vom Harem vermittelt Ida Hahn-Hahn ihren Lesern?
Sie dekonstruiert teilweise die Klischees von 1001 Nacht und zeigt den Harem als einen durch Regeln und soziale Strukturen geprägten Raum der Alterität (Fremdheit).
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2014, "Haremsnovellen, die ich Dir vorgestern schrieb...". Die Schilderung des Harems in den Orientalischen Briefen von Ida Hahn-Hahn, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412556