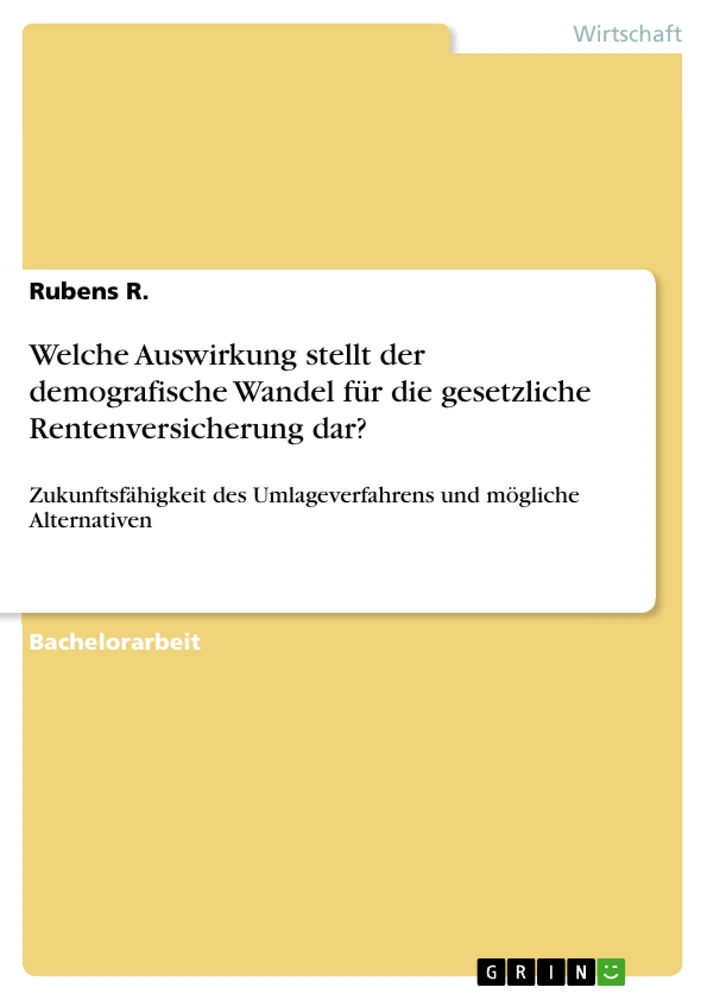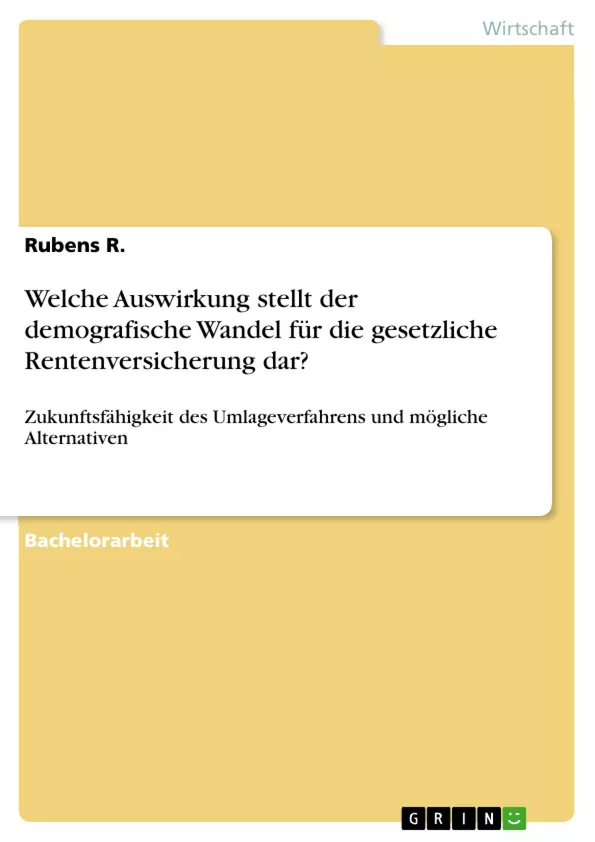Nicht zuletzt seit dem Bundestagswahlkampf 2013 wird in der Öffentlichkeit besonders über ein zentrales Thema gesprochen: die Rente. Seit Jahren ist es ein omnipräsentes Thema in der Politik. Für die Fürsprecher der deutschen Rentenversicherung gibt es kein alternatives System. Generationengerechtigkeit besteht aus ihrer Meinung nur, wenn die eine Generation mit ihren Beiträgen die Alterssicherung der anderen Generation übernimmt. Die Gegner sind da misstrauischer. Für sie handelt es sich um ein Auslaufmodell, das schnellstmöglich durch eine neue, kapitalgedeckte Form ersetzt werden sollte. Die Absicherung der Arbeit gehört seit über einem Jahrhundert zu den wichtigsten Leistungen in Deutschland. Die gesetzliche Rentenversicherung ist ein fester Bestandteil dieser Leistung und wurde seit der Kaiserzeit zusehends justiert und verbessert. Im Jahre 1986 sorgte der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm mit dem Satz „Denn eins ist sicher…Die Rente" für Aufruhe, da die seit Jahren zu niedrige Geburtenrate und die steigende Zahl von Rentenempfängern, das System der gesetzlichen Rentenversicherung an ihre Grenzen zu stoßen schien. Immer wieder wird über eine grundlegende Reformierung der Rente gesprochen. Der regierenden Politik war es jedoch nicht möglich gewesen, eine fundamentale und zukunftsfeste Änderung vorzunehmen. Die Sensibilität der Bevölkerung für dieses Thema scheint nach wie vor so hoch zu sein, dass sich jegliche Änderung des Systems womöglich negativ auf die Wählerstimmen auswirken könnte. Aktuell sind die Lasten für die Beitragszahler hoch, denn aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen verteilt sich die Beitragslast auf immer weniger Erwerbstätige. Die staatliche Zusicherung der Altersvorsorge, in seiner aktuellen Form als Generationenvertrag, scheint in Zukunft nicht mehr einhaltbar zu sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die gesetzliche Rentenversicherung
- Sozialpolitik unter Bismark bis zur Inflation der 1930er Jahre
- Die staatliche Rentenpolitik seit den fünfziger Jahre bis zur Jahrtausendwende
- Riester Rente, das richtige Modell?
- Demografischer Wandel
- Demografischer Status Quo
- Entwicklungsgründe der demografischen Faktoren
- Rentenauswirkung und Indikatoren des Reformbedarf
- Reformvorschläge und Finanzierungsmöglichkeiten
- Die Erhöhung und Flexibilisierung des Rentenbeitrittsalters
- Generierung höherer Beiträge seitens der Versicherten
- Die Ausweitung der kapitalgedeckten Rente
- Alternativen für das gesetzliche Rentensystem
- Das Grundeinkommen nach Werner Götz
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland. Sie untersucht die Zukunftsfähigkeit des aktuellen Umlageverfahrens und beleuchtet alternative Modelle. Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des Rentensystems und der Herausforderungen, die der demografische Wandel für dessen Finanzierung und Nachhaltigkeit stellt.
- Die Entwicklung des deutschen Rentensystems im historischen Kontext
- Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Rentenversicherung
- Die Herausforderungen für die Finanzierung des Umlageverfahrens
- Mögliche Reformansätze für das Rentensystem
- Alternativen zum Umlageverfahren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas „Demografischer Wandel und gesetzliche Rentenversicherung“ dar und skizziert die Problematik der Alterssicherung im Kontext des demografischen Wandels. Kapitel 2 beleuchtet die Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung von ihren Anfängen bis zur heutigen Zeit. Kapitel 3 untersucht den demografischen Wandel und seine Auswirkungen auf das Rentensystem. Kapitel 4 analysiert verschiedene Reformvorschläge und Finanzierungsmöglichkeiten für die Rentenversicherung. Kapitel 5 betrachtet alternative Modelle zur gesetzlichen Rentenversicherung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet zentrale Themen wie demografischer Wandel, gesetzliche Rentenversicherung, Umlageverfahren, kapitalgedeckte Rente, Generationenvertrag, Reformansätze, und alternative Modelle. Die Analyse basiert auf empirischen Daten und Forschungsarbeiten zu den genannten Themenfeldern.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kernproblem der gesetzlichen Rentenversicherung?
Durch den demografischen Wandel (niedrige Geburtenrate, höhere Lebenserwartung) müssen immer weniger Erwerbstätige die Renten für immer mehr Empfänger finanzieren.
Was bedeutet der Begriff „Generationenvertrag“?
Es ist das Prinzip des Umlageverfahrens, bei dem die aktuelle arbeitende Generation die Renten der älteren Generation finanziert, in der Erwartung, später selbst unterstützt zu werden.
Welche Reformvorschläge werden diskutiert?
Diskutiert werden die Erhöhung des Renteneintrittsalters, höhere Beiträge der Versicherten sowie der Ausbau der privaten, kapitalgedeckten Vorsorge (z.B. Riester-Rente).
Gibt es Alternativen zum aktuellen Rentensystem?
Die Arbeit betrachtet alternative Modelle wie das bedingungslose Grundeinkommen nach Werner Götz als möglichen Ausweg aus der Rentenkrise.
Seit wann besteht die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland?
Das System hat seine Wurzeln in der Sozialpolitik unter Bismarck in der Kaiserzeit und wurde über die Jahrzehnte kontinuierlich angepasst.
- Quote paper
- Rubens R. (Author), 2010, Welche Auswirkung stellt der demografische Wandel für die gesetzliche Rentenversicherung dar?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412857