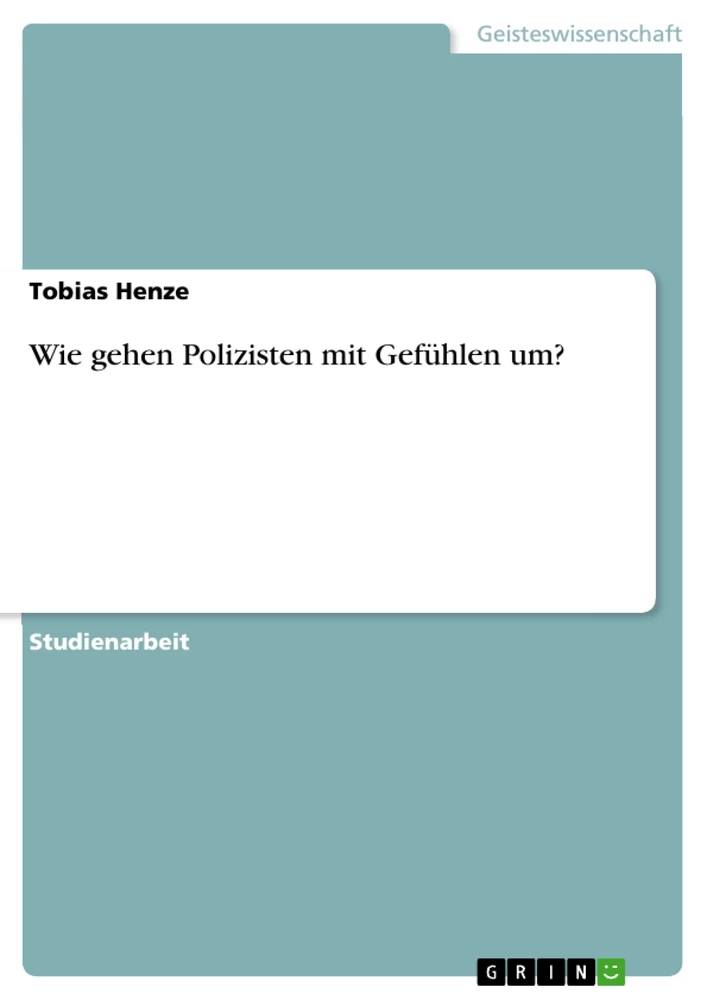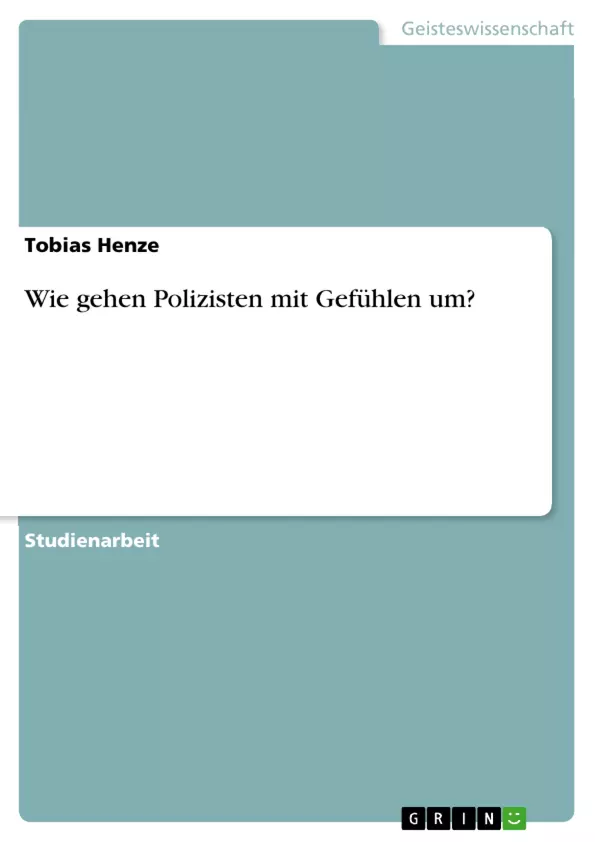Im Jahr 2016 betrug die Anzahl der Polizistinnen und Polizisten in Deutschland 220.813. Die Polizeiliche Kriminalstatistik erfasste im gleichen Jahr 71.795 Straftaten zum Nachteil von Polizeivollzugsbeamten und Polizeivollzugsbeamtinnen, davon 45.075 Widerstandshandlungen, 16.705 vorsätzliche Körperverletzungen, 4.431 gefährliche und schwere Körperverletzungen, 3.977 Bedrohungen sowie 98 versuchte Tötungsdelikte. Statistisch betrachtet ist jeder Polizist und jede Polizistin alle 3 Jahre Opfer einer Straftat. Gewalttaten gegen Polizisten sind in den letzten 6 Jahren signifikant angestiegen.
2007 betrug die Anzahl der Polizistinnen und Polizisten in Deutschland noch 250.353. Vor dem Hintergrund des nicht unerheblichen Stellenabbaus, der angehäuften Überstunden, wegfallenden Fort- und Weiterbildungen und neuen Herausforderungen in der polizeilichen Aufgabenbewältigung im Zusammenhang mit der Terrorabwehr, der Grenzkriminalität, den Großeinsätzen wie dem G20-Gipfel, aber auch hinblickend auf die Thematik Cybercrime, in die Jahre gekommene Bürotechnik ist bei nicht wenigen Polizistinnen und Polizisten die Belastungsgrenze erreicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gefühle
- Basisgefühle
- Anforderungen an Polizistinnen und Polizisten
- Emotionale Belastungen im Polizeidienst
- Gefühlsarbeit
- Polizeiliche Gefühlsarbeit und damit verbundene Probleme
- Typen des Umgangs mit situativen Gefühlsanforderungen und genutzte Gefühlsarbeitspraktiken
- Verlagerer
- Abwehrer
- Oszillierer
- Stoiker
- Diffus Reagierende
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die spezifischen Herausforderungen, denen sich Polizistinnen und Polizisten im Zuge ihrer beruflichen Tätigkeit stellen müssen. Sie beleuchtet die Bedeutung von Gefühlsarbeit in diesem Berufsfeld und analysiert, wie Polizeibedienstete mit den emotionalen Belastungen ihres Arbeitsalltags umgehen.
- Emotionale Belastungen im Polizeidienst
- Gefühlsarbeit als Bewältigungsstrategie
- Typen des Umgangs mit situativen Gefühlsanforderungen
- Die Rolle von Basisgefühlen in der Polizeiarbeit
- Herausforderungen und Probleme im Zusammenhang mit der Gefühlsarbeit im Polizeidienst
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die aktuelle Situation der Polizei in Deutschland, beleuchtet die steigende Anzahl von Gewalttaten gegen Polizistinnen und Polizisten und stellt die Herausforderungen in der polizeilichen Aufgabenbewältigung dar.
- Gefühle: Hier wird die Bedeutung von Gefühlen in der Polizeiarbeit beleuchtet und der Begriff der „Basisgefühle“ eingeführt.
- Anforderungen an Polizistinnen und Polizisten: Dieses Kapitel widmet sich den vielseitigen Aufgaben und Anforderungen des Polizeiberufes. Besondere Aufmerksamkeit wird den emotionalen Belastungen im Polizeidienst gewidmet, wobei die Auswirkungen von Einsatzsituationen mit schwerverletzten oder getöteten Menschen hervorgehoben werden.
- Gefühlsarbeit: In diesem Kapitel wird die Bedeutung von Gefühlsarbeit als Bewältigungsstrategie für die komplexen Belastungen im Polizeidienst erläutert.
- Typen des Umgangs mit situativen Gefühlsanforderungen und genutzte Gefühlsarbeitspraktiken: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Typen des Umgangs mit emotionalen Herausforderungen in der Polizeiarbeit und stellt unterschiedliche Gefühlsarbeitspraktiken vor.
Schlüsselwörter
Polizeiarbeit, Emotionen, Gefühlsarbeit, Belastungen, Einsatzsituationen, Basisgefühle, Typen des Umgangs, Emotionale Regulation, Berufsalltag.
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die statistische Belastung durch Straftaten für Polizisten in Deutschland?
Statistisch gesehen ist jeder Polizist und jede Polizistin in Deutschland alle drei Jahre Opfer einer Straftat, wobei die Gewalt gegen Beamte in den letzten Jahren signifikant angestiegen ist.
Was versteht man unter „Gefühlsarbeit“ im Polizeidienst?
Gefühlsarbeit bezeichnet die bewusste Regulation der eigenen Emotionen, um den beruflichen Anforderungen und Belastungen in Einsatzsituationen gerecht zu werden.
Welche Typen des Umgangs mit Gefühlen werden in der Arbeit unterschieden?
Die Arbeit analysiert verschiedene Typen wie Verlagerer, Abwehrer, Oszillierer, Stoiker und Diffus Reagierende.
Welche Faktoren führen zur Erreichung der Belastungsgrenze bei der Polizei?
Hauptfaktoren sind Stellenabbau, angehäufte Überstunden, neue Herausforderungen wie Terrorabwehr und Cybercrime sowie veraltete Technik.
Welche Rolle spielen Basisgefühle in der Polizeiarbeit?
Basisgefühle sind zentral für die Analyse, wie Beamte situative Anforderungen bewältigen und welche emotionalen Praktiken sie im Alltag anwenden.
- Quote paper
- Tobias Henze (Author), 2017, Wie gehen Polizisten mit Gefühlen um?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412866