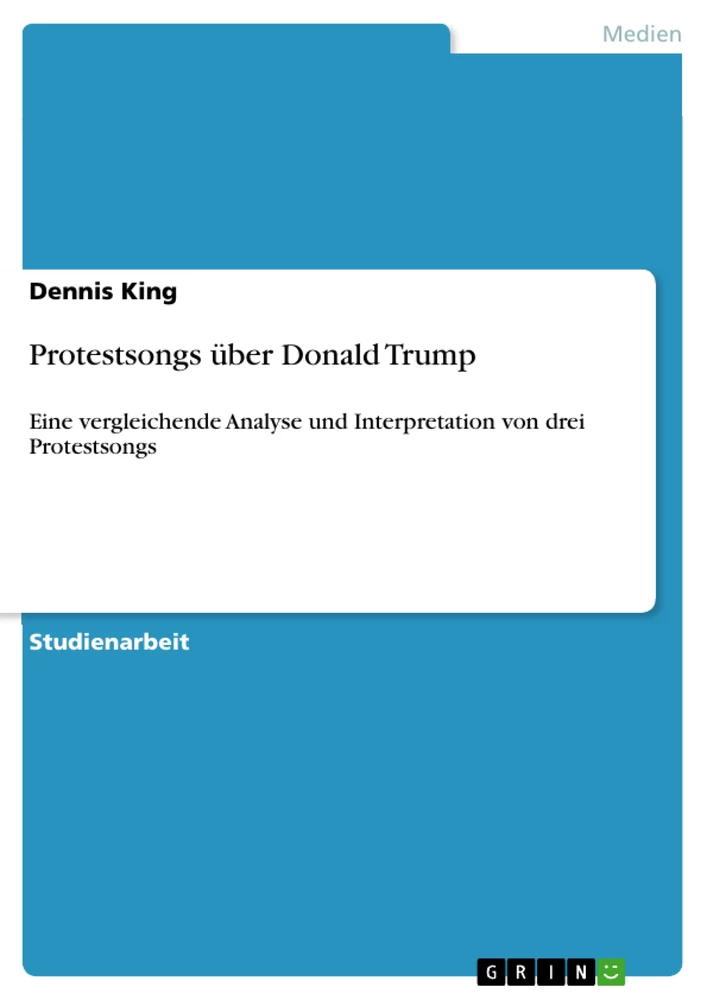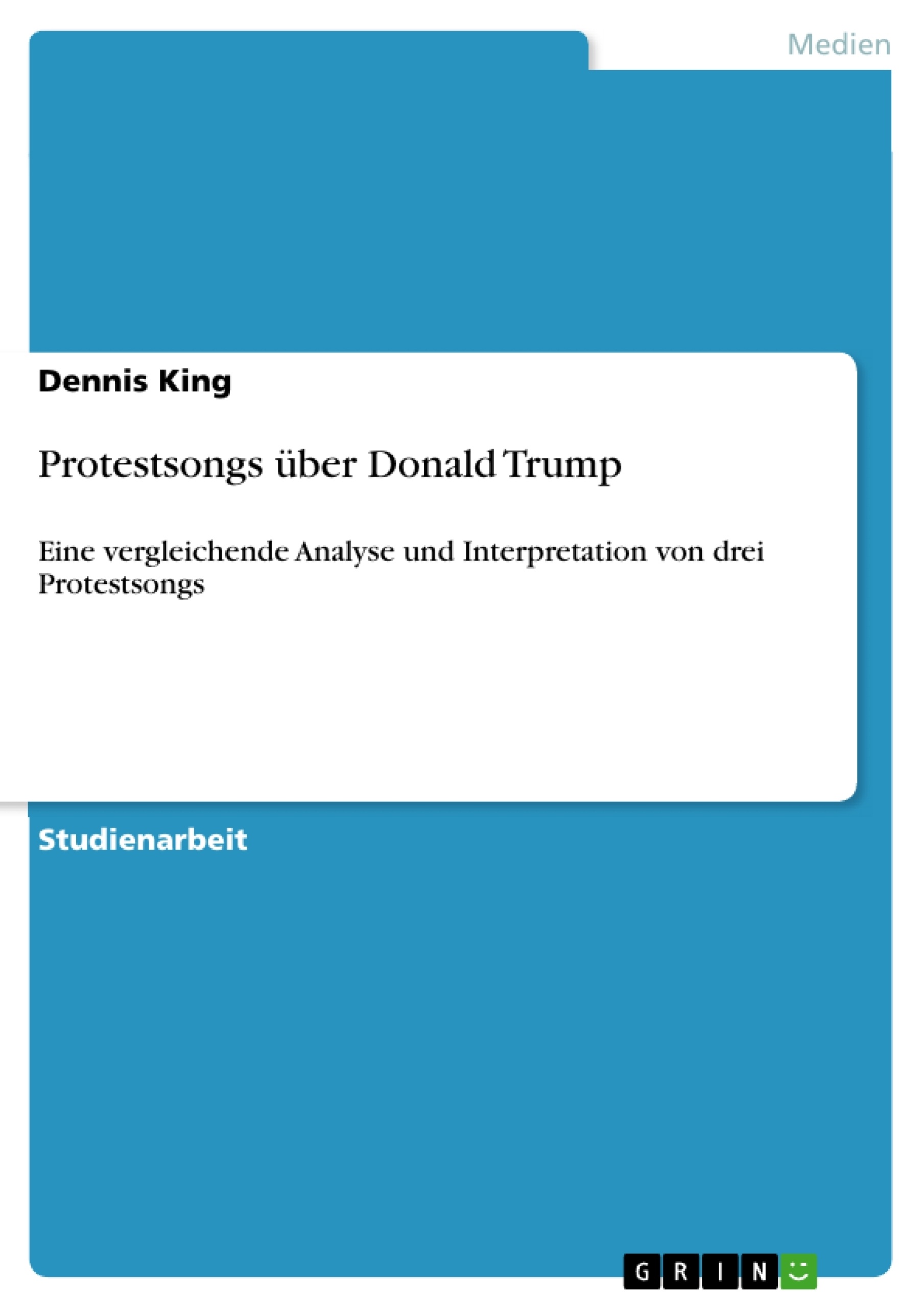In der Hausarbeit werden drei Lieder, die im Protest gegen den US-Amerikanischen Präsidenten Donald Trump geschrieben wurden, analysiert und interpretiert. Die Fragestellung lautet: "Mit welchen musikalischen Mitteln wird der Protest in den Songs ausgedrückt und wie unterscheiden sich die Songs diesbezüglich?".
Nach einem kurzen theoretischen Hintergrund zu Donald Trump, Protestsongs und der Analyse von populärer Musik werden die drei Protestsongs "Million Dollar Loan" von Death Cab for Cutie, "Trump Is on Your Side" von Moby und "Tiny Hands" von Michael Whalen und Fiona Apple bezüglich ihrer Harmonik, Melodik, Rhythmik, Instrumentalisierung und Songtexte analysiert und interpretiert, wobei nicht immer auf alle Aspekte eingegangen wird. In einem abschließenden Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Donald Trump
- 3. Protestmusik
- 4. Analyse und Interpretation
- 4.1 Million Dollar Loan
- 4.2 Trump Is on Your Side
- 4.3 Tiny Hands
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert und interpretiert drei Protestsongs über Donald Trump, um zu untersuchen, wie musikalische Mittel den Protest ausdrücken und wie sich die Songs diesbezüglich unterscheiden. Der Fokus liegt auf der Analyse der Harmonik, Melodik, Rhythmik, Instrumentalisierung und Songtexte. Der Kontext der Wahl Trumps und die Rolle von Protestmusik im Allgemeinen werden ebenfalls beleuchtet.
- Analyse der musikalischen Gestaltung von Protestsongs
- Vergleichende Betrachtung unterschiedlicher Protestlieder
- Der Einfluss von Songtexten auf die musikalische Interpretation
- Die Rolle von Protestmusik im Kontext des Trump-Präsidentschaftswahlkampfs
- Die Wirkung von Protestmusik auf die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein. Sie beschreibt den Kontext des Protests gegen Donald Trump und die damit verbundene Entstehung von Protestsongs. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie werden in den Songs musikalische Mittel eingesetzt, um Protest auszudrücken, und wie unterscheiden sich die Songs diesbezüglich? Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der die Analyse von Harmonik, Melodik, Rhythmik, Instrumentalisierung und Songtexten umfasst. Der Kontextualisierung der Analyse wird als wichtig hervorgehoben, um die Gestaltung der Musik und mögliche Handlungen zu erklären. Die Analyse der Songtexte wird als wichtig dargestellt, da sie beim Interpretieren der musikalischen Strukturen hilfreich ist.
2. Donald Trump: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über Donald Trumps Präsidentschaftswahlkampf und seinen Amtsantritt. Es hebt seine ungewöhnliche politische Karriere und seine geringe Zustimmung in der Bevölkerung hervor. Es wird auf negative Schlagzeilen über frauenverachtende und rassistische Äußerungen, Beleidigungen und umstrittene Behauptungen eingegangen. Der Kontext von Protesten gegen Trump und die damit einhergehende Entstehung zahlreicher Protestsongs wird ebenfalls beschrieben, inklusive dem Women's March als größter Demonstration in der US-Geschichte.
3. Protestmusik: Dieses Kapitel definiert Protestmusik als einen Teil der politischen Musik, bei dem Textautor, Komponist oder Interpret bewusst auf politische und soziale Missstände hinweisen oder gesellschaftliche Veränderungen anstreben. Es beschreibt die historische Rolle von Protestmusik und ihre gegenwärtige Bedeutung für politische Bewegungen. Die Funktionen von Protestmusik, einschließlich der Stärkung von Gruppenidentität, Verbundenheit und Mut, werden erläutert. Unterschiedliche Aufführungsformen (teilnehmend und präsentierend) werden unterschieden, ebenso wie der variierende Grad der Direktheit im Ausdruck von Protest. Kritische Anmerkungen zur Trennung zwischen künstlerischem Protest und aktivem Handeln werden einbezogen.
Schlüsselwörter
Protestsongs, Donald Trump, Protestmusik, Musikalische Analyse, Interpretation, Harmonik, Melodik, Rhythmik, Instrumentalisierung, Songtexte, Politische Musik, Soziale Bewegungen, USA, Women's March.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Protestsongs über Donald Trump
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert und interpretiert drei Protestsongs über Donald Trump. Der Fokus liegt auf der Untersuchung, wie musikalische Mittel (Harmonik, Melodik, Rhythmik, Instrumentalisierung und Songtexte) den Protest ausdrücken und wie sich die untersuchten Songs diesbezüglich unterscheiden. Die Arbeit betrachtet auch den Kontext der Wahl Trumps und die allgemeine Rolle von Protestmusik.
Welche Songs werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Songs "Million Dollar Loan", "Trump Is on Your Side" und "Tiny Hands". Die genauen Details zu den Songs sind im Haupttext der Arbeit zu finden.
Welche Aspekte der Musik werden analysiert?
Die Analyse umfasst die Harmonik, Melodik, Rhythmik, Instrumentalisierung und die Songtexte der drei Protestsongs. Der Fokus liegt darauf, wie diese musikalischen Elemente den Ausdruck des Protests unterstützen und wie sie sich zwischen den Songs unterscheiden.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die musikalische Gestaltung von Protestsongs zu analysieren, unterschiedliche Protestlieder vergleichend zu betrachten, den Einfluss von Songtexten auf die musikalische Interpretation zu untersuchen, die Rolle von Protestmusik im Kontext des Trump-Wahlkampfs zu beleuchten und die Wirkung von Protestmusik auf die Gesellschaft zu erörtern.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema und die Forschungsfrage einführt. Es folgt ein Kapitel über Donald Trump und seinen Wahlkampf, ein Kapitel über Protestmusik im Allgemeinen und schließlich die Kapitel zur Analyse und Interpretation der drei ausgewählten Songs. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie werden in den Songs musikalische Mittel eingesetzt, um Protest auszudrücken, und wie unterscheiden sich die Songs diesbezüglich?
Welche Rolle spielt der Kontext der Trump-Präsidentschaft?
Der Kontext von Donald Trumps Präsidentschaftswahlkampf und Amtsantritt ist entscheidend für das Verständnis der Protestsongs. Die Arbeit beleuchtet Trumps politische Karriere, seine öffentliche Wahrnehmung und die Proteste, die gegen ihn gerichtet waren.
Was wird unter Protestmusik verstanden?
Protestmusik wird definiert als ein Teil der politischen Musik, bei dem Textautor, Komponist oder Interpret bewusst auf politische und soziale Missstände hinweisen oder gesellschaftliche Veränderungen anstreben. Die Arbeit beschreibt die historische Rolle und die gegenwärtige Bedeutung von Protestmusik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Protestsongs, Donald Trump, Protestmusik, Musikalische Analyse, Interpretation, Harmonik, Melodik, Rhythmik, Instrumentalisierung, Songtexte, Politische Musik, Soziale Bewegungen, USA, Women's March.
Wo finde ich mehr Informationen über die einzelnen Kapitel?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über die jeweiligen Inhalte. Detaillierte Informationen befinden sich im Haupttext der Arbeit.
- Quote paper
- Dennis King (Author), 2017, Protestsongs über Donald Trump, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/413212