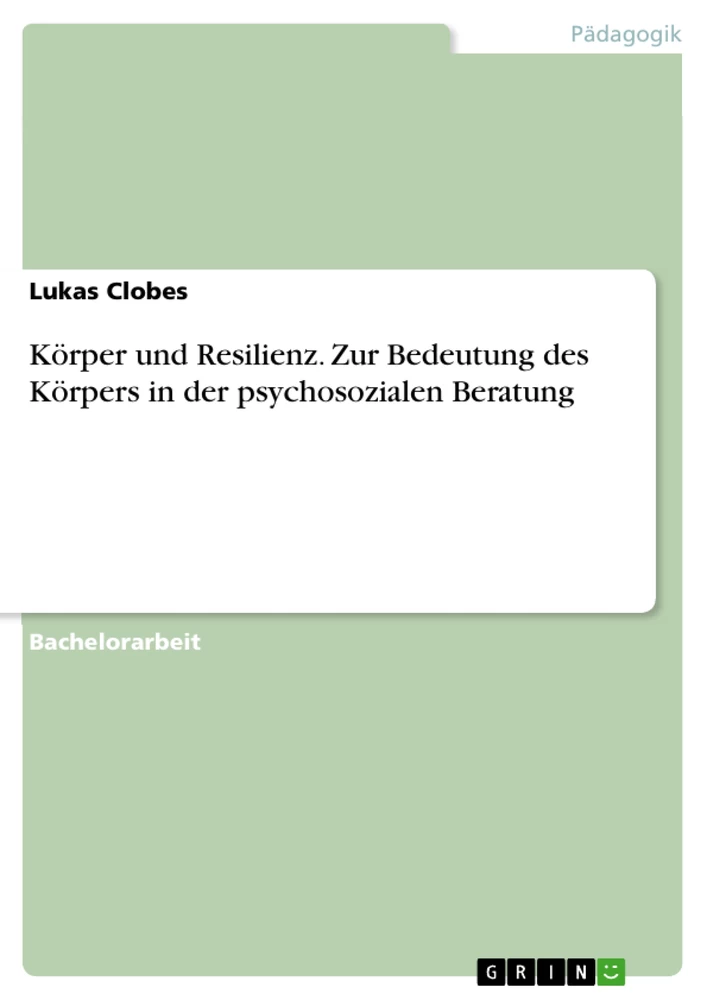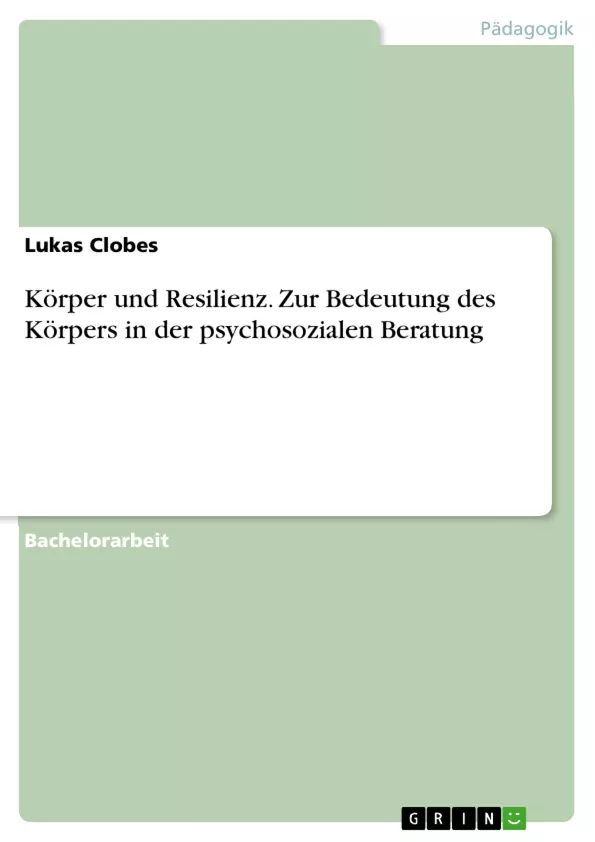Körperlichkeit und Bewegung sind Aspekte die im Kontext psychosozialer Beratung oft ausgeblendet oder übersehen werden. Dieser blinde Fleck wird in der Arbeit beleuchtet und es werden Wege aufgezeigt, wie ein ganzheitlicherer Beratungsansatz entstehen kann. Dabei wird auf folgende Fragen eingegangen:
- Was wird unter Resilienz verstanden?
- Was wird in dieser Arbeit unter Körper verstanden?
- In welchem Verhältnis stehen Resilienz und Körper?
- Was wird unter psychosoziale Beratung verstanden?
- Welche Bedeutung hat der Körper in und für die psychosoziale Beratung?
- In welchem Verhältnis stehen psychosoziale Beratung und Resilienz?
- Welche Möglichkeiten bietet der Körper als Ansatzpunkt in der Beratung für die Stärkung von Resilienz?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erschließung des Resilienzbegriffes
- Allgemeine Bedeutung und Gebrauch
- Exkurs: Resilenz in der Ökologie und Humangeographie
- Resilienz in der psychosozialen Literatur
- Exkurs soziologische Kritik der psychosozialen Resilienzdebatte
- Zum Verständnis des Körperbegriffs
- Schnittstellen von Resilienz und Körper
- Resilienz und körperliche Aspekte in renommierten Studien
- Perspektivwechsel auf Resilienz
- Der Körper und das Erfahren der (krisenhaften) Situation
- Resilienzfaktor „Problemlösen“ und die Bedeutung von Emotion und Körper
- Resilienz und Erfahrung
- Resilienz und der Körper an einem Beispiel
- Zwischenfazit zum Verhältnis von Körper und Resilienz
- Die Bedeutung des Körpers in der psychosozialen Beratung
- Psychosoziale Beratung
- Was will Beratung?
- Was verbindet und was unterscheidet Therapie und Beratung?
- Der Körper in der psychosozialen Beratung
- Begegnung in therapeutischen und Beratungs-Settings
- Der Körper als Ansatzpunkt des Verständnisses des Klienten
- Der Körper als Ansatzpunkt zur Gestaltung der Beratung
- Bewältigung durch Haltungsziele
- Entspannungs- und Besinnungsübungen
- Reise durch den Körper
- Atementspannung
- Reise zu den Stärken
- Psychosoziale Beratung
- Beratung und Resilienz
- Zusammenführung von Resilienz, Körper und psychosozialer Beratung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Bedeutung des Körpers in der psychosozialen Beratung im Kontext von Resilienz. Ziel ist es, die Schnittmengen von Resilienz und Körper aufzuzeigen und die Bedeutung des Körpers als Ansatzpunkt in der Beratung zu beleuchten.
- Das Verständnis von Resilienz als psychische Widerstandsfähigkeit und seine Erweiterung um körperliche Aspekte.
- Die Rolle des Körpers in der Erfahrung und Verarbeitung von Krisen.
- Der Körper als Mittel zur Stärkung von Resilienz in der psychosozialen Beratung.
- Die Bedeutung des Körpers als Ansatzpunkt für ein tieferes Verständnis des Klienten in der Beratung.
- Die Anwendung von körperorientierten Methoden zur Förderung von Resilienz in der Beratung.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beschäftigt sich mit der Einführung und der Bedeutung des Körpers als Quelle der Erfahrung und Verankerung in der Welt. Es wird die Relevanz des Körpers für die Resilienzdebatte beleuchtet und die Forschungsfrage der Arbeit vorgestellt.
Das zweite Kapitel widmet sich der umfassenden Erläuterung des Resilienzbegriffes, wobei verschiedene Facetten, wie die Herkunft des Begriffs, seine Anwendung in verschiedenen Disziplinen und die soziologische Kritik an der psychosozialen Resilienzdebatte, behandelt werden.
Im dritten Kapitel wird ein tiefergehendes Verständnis des Körperbegriffs vermittelt und der Fokus auf seine Bedeutung für die Erfahrung, Verarbeitung und Bewertung von Krisen gelegt.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den Schnittstellen von Resilienz und Körper. Es werden die Ergebnisse renommierter Studien zur Verbindung von Resilienz und körperlichen Aspekten analysiert und verschiedene Perspektiven auf das Verhältnis von Resilienz und Körper diskutiert. Zudem wird die Bedeutung von Emotionen und Körper für das Problemlösen im Kontext von Resilienz beleuchtet.
Das fünfte Kapitel widmet sich der Bedeutung des Körpers in der psychosozialen Beratung. Zunächst wird das Konzept der psychosozialen Beratung und ihre Ziele sowie ihre Abgrenzung zur Therapie erörtert. Anschließend werden die Möglichkeiten des Körpers als Ansatzpunkt für ein besseres Verständnis des Klienten in der Beratung und als Mittel zur Gestaltung der Beratungsprozesse untersucht.
Das sechste Kapitel behandelt das Verhältnis zwischen psychosozialer Beratung und Resilienz, indem es die Bedeutung der Beratung für die Förderung von Resilienz beleuchtet.
Schlüsselwörter
Resilienz, Körper, psychosoziale Beratung, Bewältigung, Erfahrung, Krisen, Embodiment, Neurobiologie, körperorientierte Methoden, Haltungsziele, Entspannungsübungen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt der Körper in der psychosozialen Beratung?
Der Körper dient als Quelle der Erfahrung und Verankerung in der Welt. Er kann als Ansatzpunkt genutzt werden, um Krisen besser zu verstehen und zu verarbeiten.
Wie hängen Resilienz und Körper zusammen?
Resilienz ist nicht nur psychisch, sondern hat auch körperliche Aspekte (Embodiment). Körperliche Entspannung und das Bewusstsein für körperliche Signale können die psychische Widerstandsfähigkeit stärken.
Was sind körperorientierte Methoden in der Beratung?
Dazu gehören Übungen wie Atementspannung, Körperreisen oder die Arbeit mit Haltungszielen, um Emotionen zu regulieren und das Selbstbewusstsein zu fördern.
Wie hilft der Körper beim Problemlösen?
Da Emotionen körperlich erlebt werden, ermöglicht die Einbeziehung des Körpers einen tieferen Zugang zu blockierten Gefühlen und fördert dadurch neue Perspektiven bei der Krisenbewältigung.
Was ist der Unterschied zwischen psychosozialer Beratung und Therapie?
Beratung fokussiert oft auf konkrete Lebensprobleme und die Stärkung vorhandener Ressourcen, während Therapie tiefergehende psychische Störungen behandelt, wobei beide den Körper einbeziehen können.
- Quote paper
- Lukas Clobes (Author), 2014, Körper und Resilienz. Zur Bedeutung des Körpers in der psychosozialen Beratung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/413326