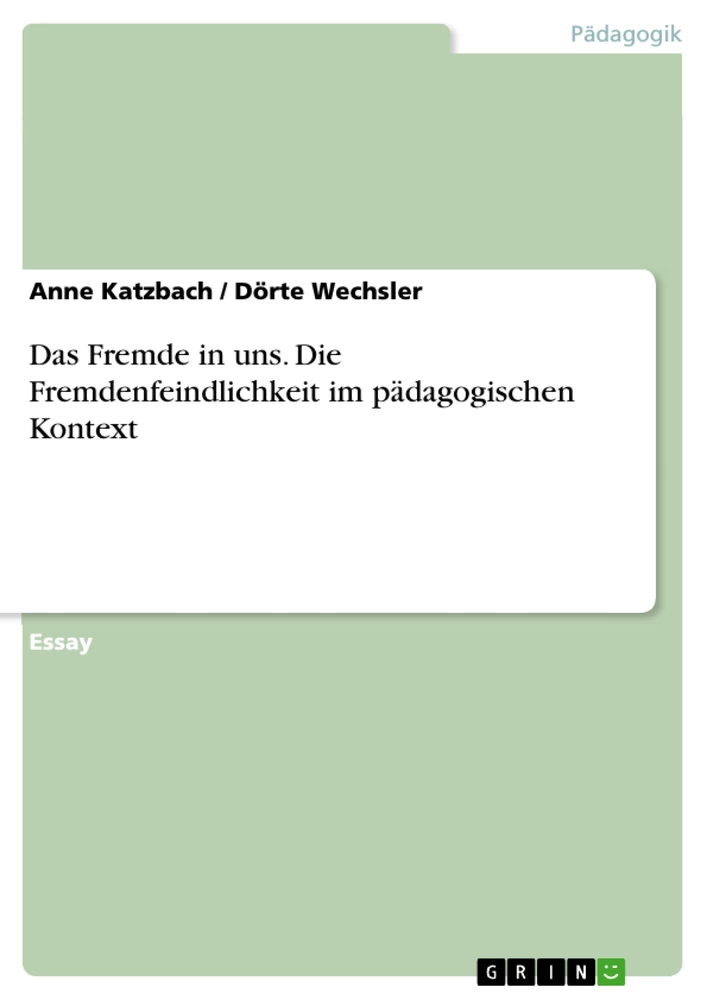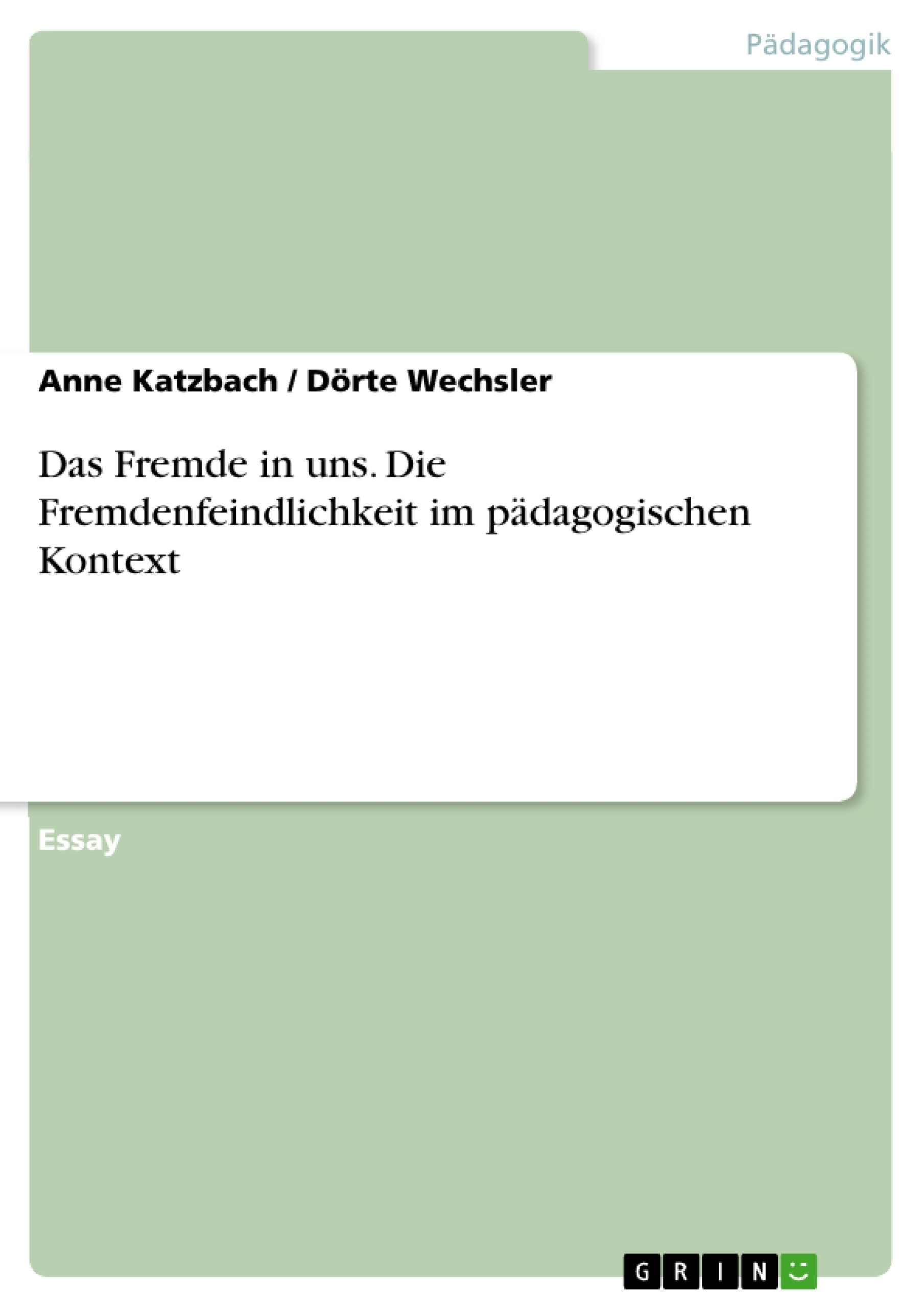Wir alle begegnen dem Fremden oft zurückhaltend oder gar ängstlich. Doch macht uns das gleich fremdenfeindlich und können wir eventuell gar nichts dafür, weil es in unseren Genen verankert ist?
Diese Frage könnte aktuell nicht besser in den gesellschaftlichen Kontext passen: In Zeiten der Flüchtlingskrise werden die Diskussionen um die Integration von Flüchtlingen immer lauter und extremer, Menschen versammeln sich zu Organisationen wie „PEGIDA“ oder „LEGIDA“ und auch die Frage, ob sich unser Bildungssystem an diese neuen Umstände anpassen muss, wird debattiert. Auf Grund dessen soll im folgenden Essay diskutiert werden, ob Fremdenfeindlichkeit genetisch bedingt ist und warum es wichtig ist, dieses Thema auch in der Pädagogik zu berücksichtigen. Schon der Autor Wolfgang Klafki setzte sich in seiner didaktischen Analyse unter anderem damit auseinander, welchen Gegenwarts- und Zukunftsbezug der Stoff, der im Unterricht vermittelt werden soll, für Schülerinnen und Schüler haben kann. Daraus ergibt sich auch für uns als angehende Lehrkräfte die Frage, ob wir davon ausgehen können, dass die Angst vor etwas Fremdem beeinflussbar ist, oder durch genetische Vorprogrammierung sowieso nicht verhindert werden kann, denn gerade als Lehrer/in darf man nicht blind für die menschliche Natur sein.
Inhaltsverzeichnis
- Fremdenfeindlichkeit: Ein Blick auf die gesellschaftliche Debatte
- Die Entstehung von Fremdenfeindlichkeit: Genetik vs. Sozialisation
- Die genetische Prädisposition: Argumente und Kritik
- Die Rolle der Sozialisation: Lernen und Erfahrungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Essay befasst sich mit der Frage, ob Fremdenfeindlichkeit genetisch bedingt ist und inwieweit pädagogische Maßnahmen zur Vermeidung und Bekämpfung dieser Haltung beitragen können. Im Fokus steht die aktuelle gesellschaftliche Debatte um Flucht und Integration, die die Relevanz dieser Thematik deutlich macht.
- Definition und Entstehung von Fremdenfeindlichkeit
- Genetische Prädisposition: Argumente und Kritik
- Rolle der Sozialisation und des Lernens
- Pädagogische Implikationen und Handlungsmöglichkeiten
- Bedeutung der Bewusstseinsbildung und des interkulturellen Dialogs
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel beleuchtet die aktuelle gesellschaftliche Debatte um Fremdenfeindlichkeit, insbesondere im Kontext der Flüchtlingskrise. Es werden verschiedene Akteure und deren Positionen im Diskurs vorgestellt.
- Kapitel 2: Hier werden zwei grundlegende Theorien zur Entstehung von Fremdenfeindlichkeit vorgestellt und gegenübergestellt: die genetische Prädisposition und die Theorie der Sozialisation. Es wird aufgezeigt, welche Argumente für und gegen jede Theorie sprechen.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel analysiert die Argumente für eine genetische Prädisposition für Fremdenfeindlichkeit. Dabei werden Studien und Theorien von Eibl-Eibesfeldt und Wöhl, die für diese Annahme sprechen, kritisch betrachtet.
- Kapitel 4: Hier wird die Rolle der Sozialisation und des Lernens in Bezug auf die Entstehung von Fremdenfeindlichkeit beleuchtet. Es werden Studien und Theorien, die den Einfluss des sozialen Umfelds und individueller Erfahrungen auf die Entwicklung von Vorurteilen und abgrenzender Verhaltensweisen hervorheben, vorgestellt.
Schlüsselwörter
Fremdenfeindlichkeit, Xenophobie, Genetik, Sozialisation, Bildung, Interkulturelle Kompetenz, Flüchtlingskrise, Integration, Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen
Ist Fremdenfeindlichkeit genetisch bedingt?
Es gibt Theorien (z.B. von Eibl-Eibesfeldt), die eine biologische Neigung zur Skepsis gegenüber Fremden als Schutzmechanismus sehen. Die moderne Forschung betont jedoch, dass das Ausmaß und die Bewertung von Fremdenfeindlichkeit stark durch Sozialisation und Lernen geprägt sind.
Welche Rolle spielt die Pädagogik bei der Bekämpfung von Xenophobie?
Pädagogik kann durch interkulturelle Bildung, Aufklärung und die Förderung von Empathie dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und die Angst vor dem "Fremden" durch Wissen zu ersetzen.
Was bedeutet "interkulturelle Kompetenz"?
Es ist die Fähigkeit, effektiv und angemessen mit Menschen aus anderen Kulturen zu kommunizieren und dabei die eigenen sowie fremden kulturellen Prägungen zu reflektieren.
Wie beeinflusst die aktuelle Flüchtlingskrise die gesellschaftliche Debatte?
Die Krise hat die Diskussionen um Integration und nationale Identität verschärft. Bewegungen wie PEGIDA zeigen, wie Ängste politisch instrumentalisiert werden können, was die Relevanz pädagogischer Gegenarbeit erhöht.
Kann man Vorurteile durch Erziehung verhindern?
Erziehung kann Vorurteile zwar nicht komplett ausschließen, aber sie kann kritisches Denken fördern und Begegnungsräume schaffen, die eine differenzierte Wahrnehmung von Individuen jenseits von Stereotypen ermöglichen.
- Citar trabajo
- Anne Katzbach (Autor), Dörte Wechsler (Autor), 2016, Das Fremde in uns. Die Fremdenfeindlichkeit im pädagogischen Kontext, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/413429