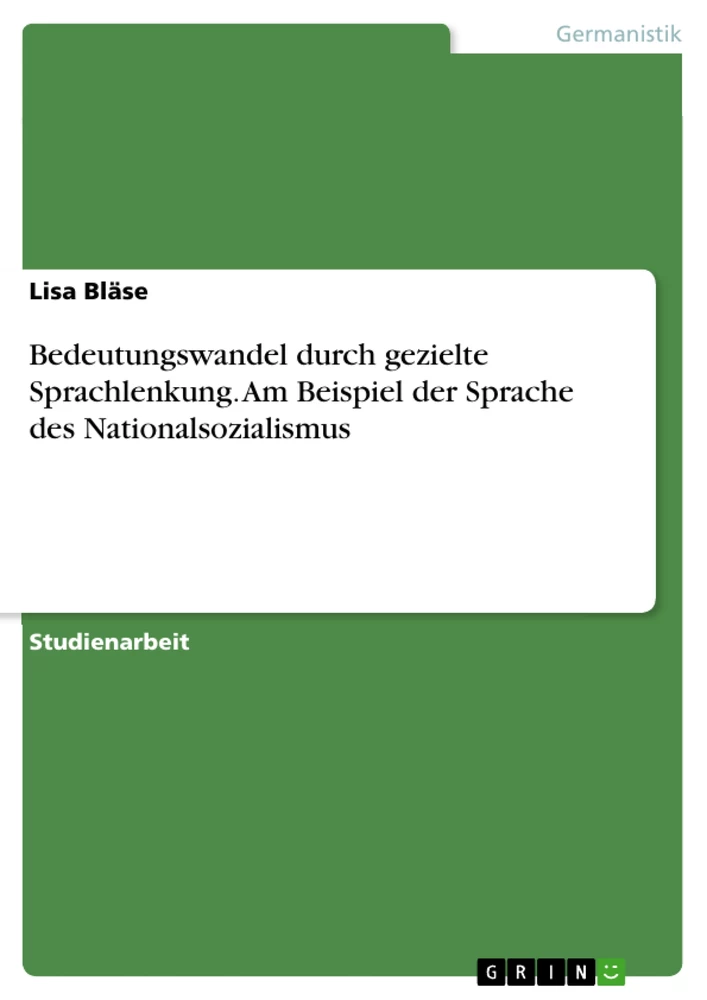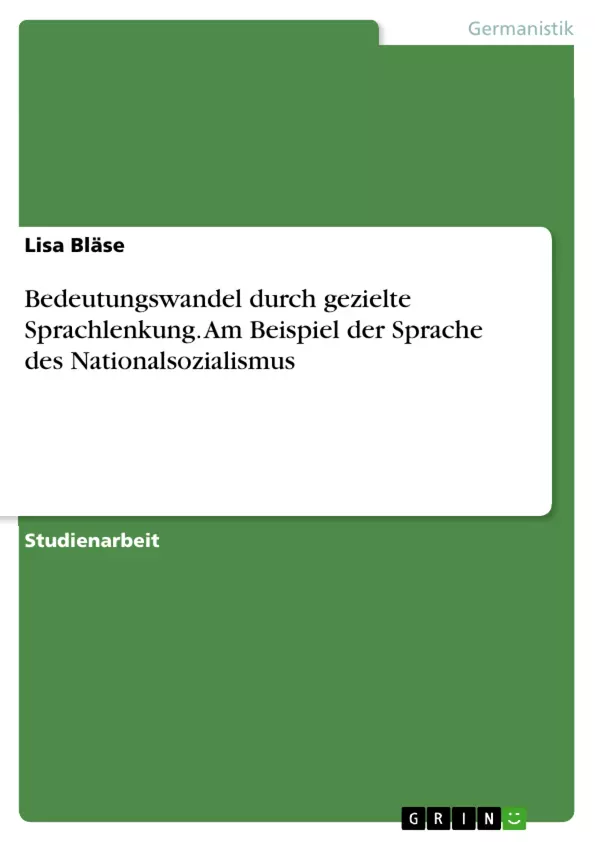Sprache befindet sich zu keiner Zeit in einem fertigem Zustand und ist durch verschiedenste Einflüsse ständiger Veränderung ausgeliefert. Das liegt zum einen natürlich daran, dass eine Sprachgemeinschaft aus vielen einzelnen Individuen besteht und diese verschiedene Einflüsse zu der jeweiligen Sprache beitragen, zum anderen liegt es daran, dass Sprache durch verschiedenste Trends und sich daraus entwickelnden Konventionen beeinflusst wird. Solche Entwicklungen geschehen meist auf relativ natürliche und unbewusste Art und Weise, doch es gibt immer wieder Versuche, Sprache gezielt zu beeinflussen.
Es gibt beispielsweise immer wieder Institutionen und Vereine, die sich für eine Veränderung der Sprache einsetzen, zum Beispiel gegen die Verwendung von Anglizismen im deutschen Sprachraum. Solch eine Beeinflussung von Sprache kann auch durchaus politisch motiviert sein. Besonders in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland war Sprache ein wichtiges Mittel der Propaganda, um die Leute durch Propaganda von den Zielen der NSDAP zu überzeugen.
Das Ziel dieser Arbeit soll es sein, bestimmte Begriffe aus ebendieser Zeit, die einen kompletten Bedeutungswandel oder eine Bedeutungserweiterung erfahren haben, zu untersuchen und die Frage zu klären, ob eine Rückkehr zur ursprünglichen Bedeutung stattgefunden hat. Dazu ist es zunächst wichtig, näher auf die Begriffe 'Sprachwandel' und 'Sprachsteuerung' einzugehen. Anschließend sollen auf allgemeiner Ebene Besonderheiten der Sprache im Nationalsozialismus herausgearbeitet werden. Im Folgenden soll dann auf einige Beispiele näher eingegangen werden, es wird ein kleiner Überblick über den historischen Wandel der Bedeutung gegeben, eine Erläuterung zur gezielten Steuerung der Bedeutung im Nationalsozialismus und es soll die Frage geklärt werden, ob dieser veränderte Bedeutung bis heute bestehen konnte. Daraufhin soll auf die Gegenbewegung zur Sprache es Nationalsozialismus eingegangen werden, es folgt eine Erläuterung zu dem Versuch, die Sprache zu „Entnazifizieren“, also Begriffe, die durch den Nationalsozialismus geprägt wurden, aus dem Sprachgebrauch zu streichen. Dazu werden beispielhaft zwei Wörterbücher, die genau zu diesem Zweck entstanden sind, vorgestellt und kurz diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Sprachwandel
- 2.1 Bedeutungswandel
- 3 Sprachsteuerung
- 3.1 Sprachsteuerung im Nationalsozialismus
- 3.2 Bedeutungswandel und Konnotation in der Sprache des NS-Regimes
- 3.2.1 Beispiel 1: Wortfeld 'Fanatismus'
- 3.2.2 Beispiel 2: Wortfeld 'Helden'
- 3.2.3 Beispiel 3: 'Propaganda'
- 3.2.4 Fremd- und Lehnwörter im Nationalsozialismus
- 3.3 Entnazifizierung der Sprache
- 3.3.1 Aus dem Wörterbuch des Unmenschen
- 3.3.2 Das Wörterbuch der „Vergangenheitsbewältigung“
- 4 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Bedeutungswandel von Begriffen aus der Zeit des Nationalsozialismus, die durch gezielte Sprachlenkung beeinflusst wurden. Ziel ist es, herauszufinden, ob eine Rückkehr zur ursprünglichen Bedeutung dieser Begriffe stattgefunden hat.
- Sprachwandel und seine Einflussfaktoren
- Sprachsteuerung im Nationalsozialismus
- Bedeutungswandel und Konnotation in der Sprache des NS-Regimes
- Entnazifizierung der Sprache
- Vergleichende Analyse von Wörterbüchern zur Entnazifizierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des Bedeutungswandels durch Sprachlenkung am Beispiel der Sprache des Nationalsozialismus ein. Kapitel 2 beleuchtet den Sprachwandel im Allgemeinen, wobei insbesondere der Bedeutungswandel im Fokus steht. Kapitel 3 untersucht die gezielte Steuerung der Sprache im Nationalsozialismus. Es werden anhand von Beispielen wie 'Fanatismus', 'Helden' und 'Propaganda' die Veränderungen in der Bedeutung und Konnotation von Wörtern analysiert. Außerdem wird der Einfluss von Fremd- und Lehnwörtern auf die Sprache des Nationalsozialismus beleuchtet. Kapitel 3.3 befasst sich mit der Gegenbewegung zur Sprache des Nationalsozialismus, der „Entnazifizierung“ der Sprache. Es werden zwei Wörterbücher vorgestellt, die den Versuch unternehmen, Begriffe, die durch den Nationalsozialismus geprägt wurden, aus dem Sprachgebrauch zu streichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Sprachwandel, Bedeutungswandel, Sprachsteuerung, Nationalsozialismus, Propaganda, Entnazifizierung, Wörterbücher, Konnotation.
Häufig gestellte Fragen
Wie nutzten die Nationalsozialisten die Sprache für ihre Zwecke?
Durch gezielte Sprachlenkung wurden Begriffe umgedeutet oder emotional aufgeladen, um die Ideologie der NSDAP im Alltag zu verankern und Propaganda zu betreiben.
Was versteht man unter dem Bedeutungswandel des Begriffs "fanatisch"?
Vor der NS-Zeit negativ besetzt (besessen/unkritisch), wurde "fanatisch" im Nationalsozialismus zu einer positiven Tugend für bedingungslose Treue umgedeutet.
Was ist die "Entnazifizierung der Sprache"?
Der Versuch nach 1945, belastete Begriffe aus dem Sprachgebrauch zu tilgen oder deren ursprüngliche Bedeutung wiederherzustellen.
Was ist das "Wörterbuch des Unmenschen"?
Ein kritisches Werk von Sternberger, Storz und Süskind, das Wörter analysiert, die durch den NS-Gebrauch unmenschlich oder ideologisch vergiftet wurden.
Warum ist Sprachsteuerung in der Politik so effektiv?
Weil Sprache das Denken beeinflusst. Durch die ständige Wiederholung bestimmter Begriffe werden Weltbilder unbewusst übernommen und normalisiert.
- Citation du texte
- Lisa Bläse (Auteur), 2014, Bedeutungswandel durch gezielte Sprachlenkung. Am Beispiel der Sprache des Nationalsozialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/413574