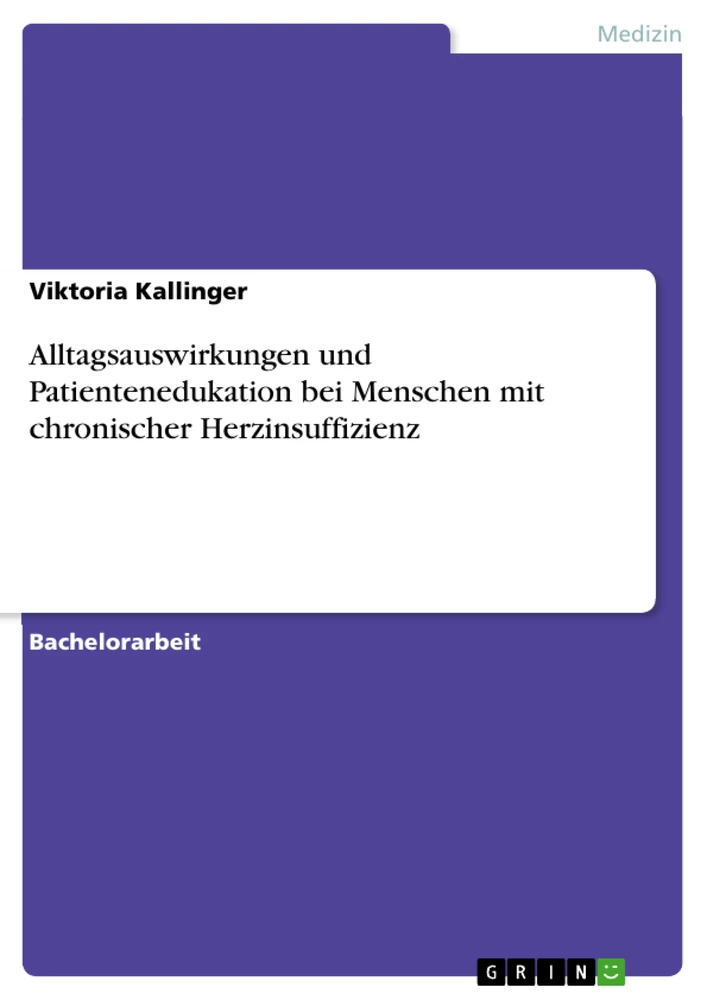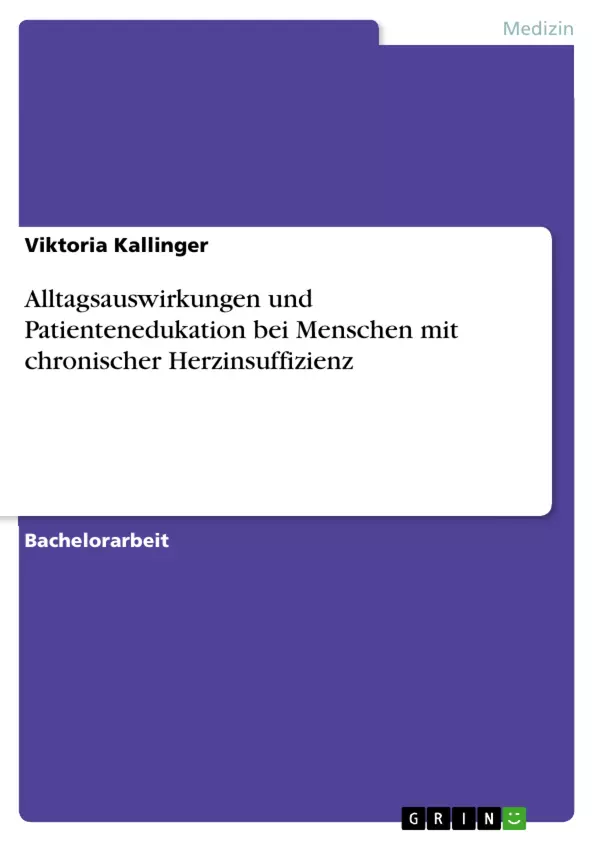Das Krankheitsbild der chronischen Herzinsuffizienz schränkt den Alltag von betroffenen Patientinnen und Patienten stark ein. Eine ausführliche Patientenschulung ist in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung. Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die Krankheitsauswirkungen der chronischen Herzinsuffizienz zu erfassen und den Einfluss einer umfangreichen professionellen Patientenedukation auf das Selbstmanagement der Betroffenen zu ermitteln.
Es wurde eine systematische Literaturrecherche in Onlinedatenbanken und Suchmaschinen durchgeführt. Die gewonnene Literatur wurde anschließend hinsichtlich ihrer Qualität überprüft und in die Arbeit miteinbezogen. In Studien wurden überwiegend emotionale Auswirkungen durch soziale und berufliche Einschränkungen ersichtlich. Der positive Einfluss von professionellen Schulungsprogrammen auf das Selbstmanagement der Erkrankten wurde bestätigt, vor allem in den Bereichen Wissen, Selbstmonitoring und Bewegung. Die Patientenedukation ist ein wesentlicher Teil der Rehabilitation bei chronischer Herzinsuffizienz, in denen Pflegepersonen eine sehr wichtige Rolle spielen.
Um eine umfangreiche Patientenedukation im Stationsalltag zu ermöglichen, erfordert es zeitliche und organisatorische Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems, sowie speziell ausgebildetes Pflegepersonal.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Ziel
- Methodik
- Forschungsfrage
- Literaturrecherche
- Ergebnisse
- Grundlagen der Herzinsuffizienz
- Definition
- Formen
- Ätiologie chronischer Herzinsuffizienz
- Klassifikation
- Klinik
- Diagnostisches Vorgehen
- Therapie
- Modifikation des Lebensstils
- Medikamentöse Therapie
- Apparative und operative Therapie
- Krankheitsauswirkungen
- Allgemeine Gesundheit
- Psychisches Wohlbefinden
- Auswirkungen auf die Familie
- Sozialleben und Arbeitswelt
- Auswirkungen auf die Lebensqualität
- Aufgabe der kardialen Rehabilitation
- Patientenedukation
- Definition und Bedeutung
- Grundlagen
- Die Wittener Werkzeuge
- Gesetzliche Regelung
- Auswirkungen chronischer Herzinsuffizienz auf die Lebensqualität
- Rolle der Patientenedukation im Selbstmanagement der Erkrankung
- Analyse von Studien zur Wirksamkeit von Patientenedukationsprogrammen
- Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit im Kontext der Herzinsuffizienz
- Herausforderungen und Chancen der Patientenedukation in der Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit den Auswirkungen chronischer Herzinsuffizienz auf den Alltag von Betroffenen und untersucht den Einfluss professioneller Patientenedukation auf das Selbstmanagement der Erkrankung. Die Arbeit soll dazu beitragen, das Verständnis für die Herausforderungen und Möglichkeiten der Patientenedukation im Bereich der Herzinsuffizienz zu verbessern.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und die Zielsetzung der Bachelorarbeit dar. Im Kapitel Methodik werden die Forschungsfrage und die Vorgehensweise der Literaturrecherche erläutert. Die Ergebnisse präsentieren einen Überblick über die Grundlagen der Herzinsuffizienz, die Auswirkungen der Erkrankung auf das Alltagsleben von Betroffenen und die Bedeutung der kardialen Rehabilitation. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Patientenedukation, ihrer Definition, Bedeutung, den zugrundeliegenden Grundlagen sowie den relevanten gesetzlichen Regelungen.
Schlüsselwörter
Die Bachelorarbeit konzentriert sich auf die Themenfelder chronische Herzinsuffizienz, Alltag, Patientenedukation und Selbstmanagement. Sie untersucht den Einfluss von Patientenedukation auf die Bewältigung der Erkrankung durch Betroffene und analysiert relevante Studien sowie gesetzliche Rahmenbedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie schränkt chronische Herzinsuffizienz den Alltag ein?
Die Erkrankung führt zu physischer Schwäche, sozialen und beruflichen Einschränkungen sowie emotionalen Belastungen, die die allgemeine Lebensqualität stark mindern.
Was ist das Ziel der Patientenedukation bei Herzinsuffizienz?
Ziel ist es, das Selbstmanagement der Betroffenen zu fördern, insbesondere in den Bereichen Krankheitswissen, Selbstmonitoring (z.B. Gewichtskontrolle) und Anpassung des Lebensstils.
Welche Rolle spielen Pflegepersonen in der kardialen Rehabilitation?
Pflegepersonen sind zentrale Akteure in der Schulung. Sie vermitteln Wissen, unterstützen bei der Therapieeinhaltung und sind wichtige Ansprechpartner für psychosoziale Herausforderungen.
Was sind die „Wittener Werkzeuge“?
Dies sind spezifische Instrumente und Methoden, die im Rahmen der Patientenedukation eingesetzt werden, um Schulungsprozesse professionell zu strukturieren und zu evaluieren.
Wie wirkt sich Herzinsuffizienz auf das Familienleben aus?
Die chronische Erkrankung belastet oft das gesamte familiäre Gefüge, da Rollenbilder sich ändern und Angehörige häufig in die Pflege und das tägliche Management einbezogen werden.
Welche Rahmenbedingungen sind für erfolgreiche Patientenschulung nötig?
Es bedarf zeitlicher und organisatorischer Ressourcen im Gesundheitssystem sowie speziell ausgebildeten Pflegepersonals, um Edukation effektiv in den Stationsalltag zu integrieren.
- Quote paper
- Viktoria Kallinger (Author), 2017, Alltagsauswirkungen und Patientenedukation bei Menschen mit chronischer Herzinsuffizienz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/413584