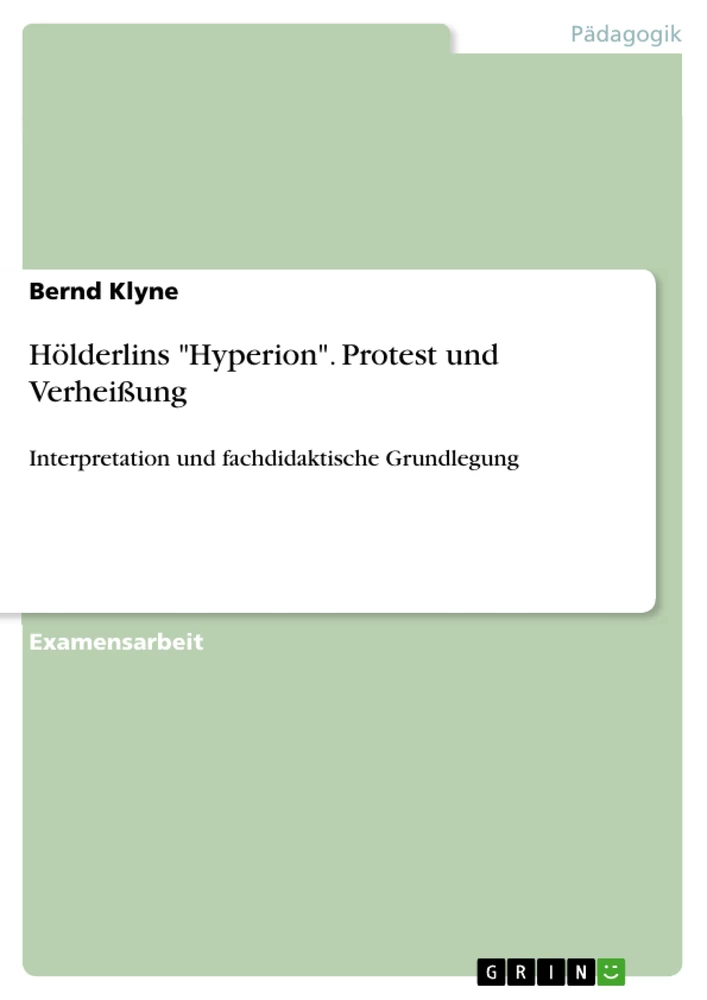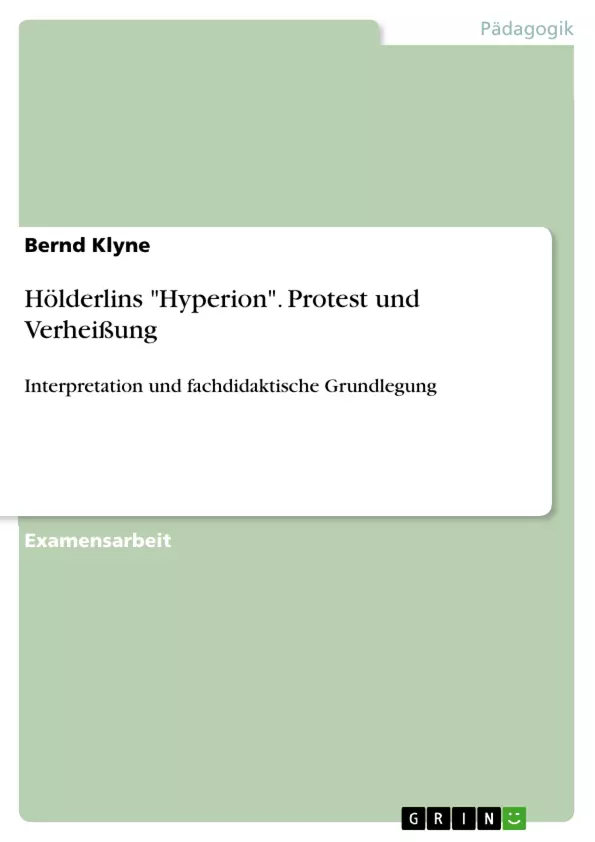Die vorgelegte Interpretation von Hölderlins „Hyperion“ zeigt, wie der Roman explizit und in scharfer Form bestehende gesellschaftliche und politische Verhältnisse auf der Basis einer ausgearbeiteten geschichtsphilosophischen Theorie Hölderlins kritisiert, dabei aber nicht stehenbleibt, sondern in einer Fülle von „Gegenbildern“ eine utopische Perspektive entwickelt.
Damit qualifiziert sich der Roman im besonderem Maße zur exemplarischen Demonstration des gewählten fachdidaktischen Ansatzes, literarische Werke gesellschaftlich unter den Aspekten „Protest“ und „Verheißung“ zu untersuchen.
Hölderlin bestimmt übrigens selbst die Dichtung und ihre Aufgabe von den Polen „Verheißung“ und „Protest“ her: Dichtung soll die „Mythologie der Vernunft“ in „dürftiger Zeit“ sein. Der „Hyperion“-Roman zeichnet durch die Darstellung der Entwicklung der – selbst mythologischen – Gestalt des Hyperion den Werdensprozess, die Geschichte jener „Mythologie der Vernunft“ nach. Mit den Briefen, die Hyperion an Bellarmin schreibt, macht er sich selbst zum Dichter und beschreibt den Weg, den er bis zu seinen „dichterischen Tagen“ durchlaufen musste.
Der Text bietet die Interpretation des Romans und die fachdidaktische Grundlegung.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen
- A. Interpretation
- 1. Die Philosophie des Absoluten
- 2. Die Philosophie der Geschichte
- a) Die ,,Trefflichkeit des alten Athenervolks“.
- b) Die „Unheilbarkeit des Jahrhunderts“.
- c) Der politische Gegenentwurf ……………..\n
- 3. Bilder der Versöhnung.
- a) Die „göttliche Natur“ und das Programm einer Erlösung der Natur\ndurch die Geschichte............
- b) Dichtung als „Mythologie der Vernunft“
- c) Der Diotima-Mythos....
- 4. Die Struktur des Romans…....
- 5. Hyperions Leben
- B. Fachdidaktische Grundlegung...
- 1. Ableitung und Begründung des fachdidaktischen Ansatzes
- 2. Verhältnis zur Fachdidaktik Rolf Geißlers
- 3. Folgerungen für den Literaturunterricht...
- 4. Begründung der Wahl des Unterrichtsgegenstandes und der\nZielsetzung der Unterrichtsreihe
- 5. Didaktische Reduktion
- 6. Strukturplan zur Unterrichtsreihe: „Hyperion“.
- 7. Überblicksgraphik: Aspekte der Interpretation ....
- 8. Erläuterungen zur Überblicksgraphik.….……………….….….……..\n
- C. Materialien.......
- 1 Inhaltsübersicht zu den einzelnen Briefen des Romans.
- 2. Hyperions wichtigste Lebensstationen......
- 3. Die Zeitstruktur des Romans: Leben Hyperions und Romanzeit\n
- Literaturverzeichnis......
- 1. Textausgaben „Hyperion“.
- 2. Literatur zur Interpretation......
- 3. Literatur zur fachdidaktischen Grundlegung..\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Examensarbeit „HÖLDERLINS „HYPERION“: PROTEST UND VERHEIBUNG“ von Bernd Klyne zielt darauf ab, eine Interpretation des Romans „Hyperion“ zu liefern und eine fachdidaktische Grundlegung für den Einsatz des Werks im Deutschunterricht zu erarbeiten.
- Hölderlins Philosophie des Absoluten
- Die Rolle der Geschichte und des Politischen in Hölderlins Werk
- Dichtung als Mittel der Versöhnung und Erlösung
- Die Struktur und das Leben des Protagonisten Hyperion
- Fachdidaktische Implikationen für den Einsatz des Romans im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer ausführlichen Analyse der Philosophie des Absoluten, die als das zentrale Element von Hölderlins Werk betrachtet wird. Anschließend wird die Philosophie der Geschichte untersucht, wobei die „Trefflichkeit des alten Athenervolks“, die „Unheilbarkeit des Jahrhunderts“ und die Bedeutung des politischen Gegenentwurfs beleuchtet werden. Es folgen Kapitel über die „Bilder der Versöhnung“, in denen Hölderlins Vision einer „göttlichen Natur“ und die Rolle der Dichtung als „Mythologie der Vernunft“ untersucht werden. Die Analyse umfasst auch eine Erörterung des Diotima-Mythos und der Struktur des Romans.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen des Romans „Hyperion“, darunter „Protest“, „Verheißung“, „Philosophie des Absoluten“, „Geschichte“, „Politik“, „Versöhnung“, „Natur“, „Dichtung“ und „Mythos“. Sie untersucht auch die fachdidaktischen Aspekte des Romans, wie die didaktische Reduktion, die Bedeutung für den Literaturunterricht und die Auswahl des Unterrichtsgegenstandes.
- Quote paper
- Bernd Klyne (Author), 1985, Hölderlins "Hyperion". Protest und Verheißung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/413588