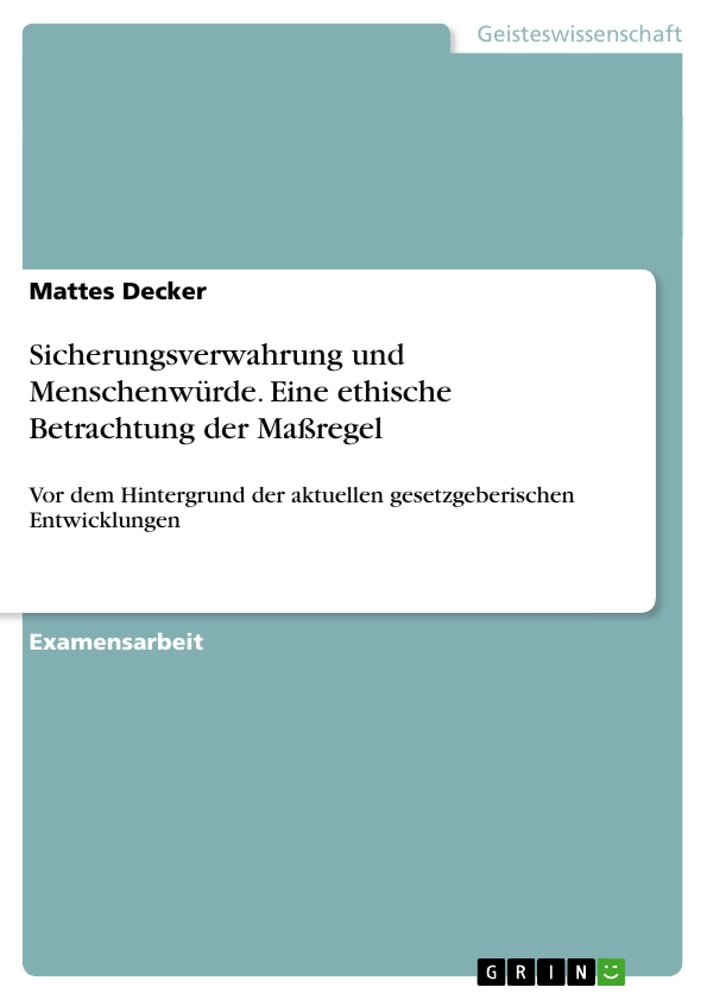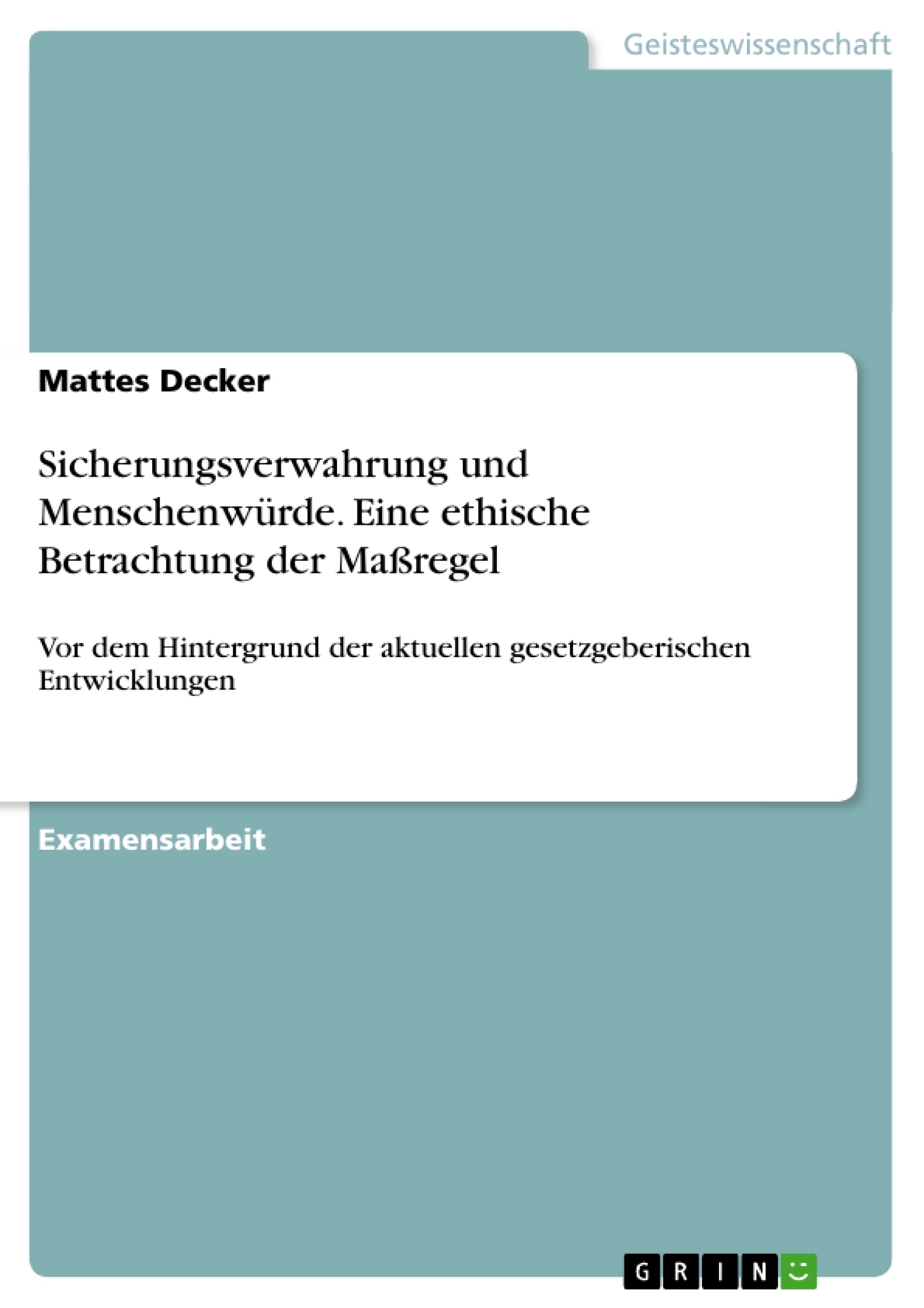Im Jahr 2004 sind durch das Bundesverfassungsgericht die landesrechtlichen Regelungen zur nachträglichen Sicherungsverwahrung von Straftätern wegen mangelnder Gesetzgebungskompetenz für verfassungswidrig erklärt worden. Der Bundesgesetzgeber hat es daraufhin für nötig befunden, die landesrechtlichen Bemühungen in das Strafgesetzbuch (StGB) aufzunehmen. Die Tendenz zur Verschärfung der strafrechtlichen Sanktionen erreicht damit vorerst ihren Höhepunkt in einem schuldunabhängigen Eingriff in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger, der rechtsdogmatisch keinen strafenden Charakter tragen soll. Schon die Sicherungsverwahrung in ihrer Grundform sieht sich seit ihrer Einführung harter Kritik ausgesetzt, die bis heute nicht verstummt ist. Im Gegenteil, im Zuge der Ausweitung dieser Maßregel ist mehr und mehr von einer Verfassungswidrigkeit der bundesgesetzgeberischen Neuregelungen die Rede. Es wird bezweifelt, dass überhaupt ein sicherheitspolitischer Bedarf besteht. Statistisch konnte dieser jedenfalls nicht nachgewiesen werden. Weiterhin wird vermutet, dass die aktuellen Entwicklungen aus der massenmedial aufgepeitschten Stimmung erwachsen. Fälle, wie die des Marc Dutroux, lassen eine als Moralpanik bezeichnete Diskrepanz zwischen der registrierten und der medial vermittelten Gefährdung entstehen. Einigen Autoren sehen einen Zusammenhang zwischen diesbezüglicher Gesetzgebung und Wahlkampfphasen. Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten geht Deutschland mit der Ausweitung der Sicherungsverwahrung einen Alleinweg. In Spanien sind Sanktionen wie die Sicherungsverwahrung seit geraumer Zeit verfassungswidrig. Österreich schließt die Maßregel für gewaltfreie Eigentums- und Vermögensdelikte aus.6In Deutschland versäumt das Bundesverfassungsgericht durch seine juristisch nicht stringente Vorgehensweise,7einen Gegenpol zur landesrechtlichen Gesetzgebung zu bilden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Grundlagen und Voraussetzungen der Problemstellung
- 2.1 Der Achtungsanspruch des einzelnen Menschen
- 2.1.1 Zum Grundverständnis von Freiheit und Recht.
- 2.1.2 Grundgesetz und Menschenwürde
- 2.1.3 Einschränkung der Grundrechte von Rechtsbrechern ..
- 2.2 Die Sicherungsverwahrung im staatlichen Sanktionensystem........
- 2.2.1 Straftheorien.
- 2.2.2 Die Maßregel in Abgrenzung zur Strafe.
- 2.2.3 Die aktuellen Entwicklungen in der Gesetzgebung
- 2.2.4 Voraussetzungen für die Anordnung der Sicherungsverwahrung…..\n
- 2.2.5 Anordnungsverfahren....
- 3. Zur Verletzung der Menschenwürde durch die Sicherungsverwahrung
- 3.1 Die Rechtfertigung der Verwahrung zwischen Theorie und Praxis..\n
- 3.1.1 Ansätze zur Legitimation der Sicherungsverwahrung
- 3.1.2 Die Grenzen der aktuellen Legitimation.
- 3.1.3 Die Prognosepraxis
- 3.1.4 Der „Hang zu erheblichen Straftaten“ in der juristischen Anwendung\n
- 3.1.5 Kein strafender Charakter oder Doppelbestrafung ………………………..\n
- 3.1.6 Zusammenfassung..\n
- 3.2 Zur Kritik an den aktuellen Entwicklungen
- 3.2.1 Übereiltes Gesetzgebungsverfahren.\n
- 3.2.2 Rückwirkungsverbot.
- 4. Ist eine menschenwürdige Sicherungsverwahrung möglich?
- 5. Zusammenfassung..\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die ethischen Implikationen der Sicherungsverwahrung im deutschen Rechtssystem vor dem Hintergrund der aktuellen Gesetzgebungs-entwicklungen. Sie fokussiert auf die Frage, ob diese Maßregel mit der Menschenwürde vereinbar ist.
- Grundlagen des Achtungsanspruchs der Menschenwürde im Grundgesetz
- Ethische und rechtliche Aspekte der Sicherungsverwahrung als Sanktionsmaßnahme
- Kritik an der aktuellen Gesetzgebung zur Sicherungsverwahrung und deren Auswirkungen
- Mögliche Ansätze für eine menschenwürdige Gestaltung der Sicherungsverwahrung
- Vergleichende Betrachtung mit anderen europäischen Rechtsordnungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den aktuellen Kontext der Sicherungsverwahrung im deutschen Recht dar, indem sie auf die rechtlichen Änderungen im Jahr 2004 und die dazugehörige Kritik eingeht. Anschließend führt sie die wesentlichen Themen und den Aufbau der Arbeit aus.
Kapitel 2 erörtert die Grundlagen und Voraussetzungen der Problemstellung. Unterkapitel 2.1 analysiert den Schutzanspruch der Menschenwürde im deutschen Grundgesetz und beleuchtet die Verbindung von Freiheit und Recht. Unterkapitel 2.2 widmet sich dem staatlichen Sanktionensystem, wobei es die Sicherungsverwahrung als Maßregel im Vergleich zur Strafe betrachtet.
Kapitel 3 untersucht die Verletzung der Menschenwürde durch die Sicherungsverwahrung. Das erste Unterkapitel befasst sich mit der Legitimation der Maßregel in Theorie und Praxis und beleuchtet die Grenzen der aktuellen Rechtfertigung. Das zweite Unterkapitel fokussiert auf Kritikpunkte an den neueren gesetzlichen Regelungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Sicherungsverwahrung, Menschenwürde, Freiheit, Recht, Strafrecht, Sanktionssystem, Grundrechte, Gesetzgebung, Kritik und ethische Betrachtung. Sie befasst sich mit dem grundgesetzlichen Menschenbild und den Herausforderungen, die sich aus der Sicherungsverwahrung für den Schutz der Würde des Einzelnen ergeben.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Sicherungsverwahrung?
Es handelt sich um eine schuldunabhängige Maßregel der Besserung und Sicherung, die dazu dient, gefährliche Straftäter nach Verbüßung ihrer Haftstrafe zum Schutz der Allgemeinheit weiter festzuhalten.
Ist die Sicherungsverwahrung mit der Menschenwürde vereinbar?
Dies ist ethisch und rechtlich umstritten. Kritiker sehen darin einen Verstoß gegen die Menschenwürde, wenn die Verwahrung faktisch wie eine Strafe wirkt und keine echte Therapie- oder Entlassungsperspektive bietet.
Was bedeutet das Abstandsgebot?
Das Bundesverfassungsgericht fordert, dass sich die Sicherungsverwahrung deutlich vom Strafvollzug unterscheiden muss (z.B. durch bessere Unterbringung und intensive Therapieangebote), um verfassungsgemäß zu sein.
Warum wird die Prognosepraxis kritisiert?
Die Vorhersage künftiger Gefährlichkeit ist wissenschaftlich schwierig. Kritiker bemängeln, dass oft vorsorglich verwahrt wird, was zu einer hohen Zahl an „falsch-positiven“ Entscheidungen führen kann.
Wie gehen andere europäische Staaten mit der Sicherungsverwahrung um?
Deutschland geht mit der Ausweitung der Maßregel einen Sonderweg. In Spanien ist sie verfassungswidrig, in Österreich ist sie für gewaltfreie Eigentumsdelikte ausgeschlossen.
- Arbeit zitieren
- Mattes Decker (Autor:in), 2005, Sicherungsverwahrung und Menschenwürde. Eine ethische Betrachtung der Maßregel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41390