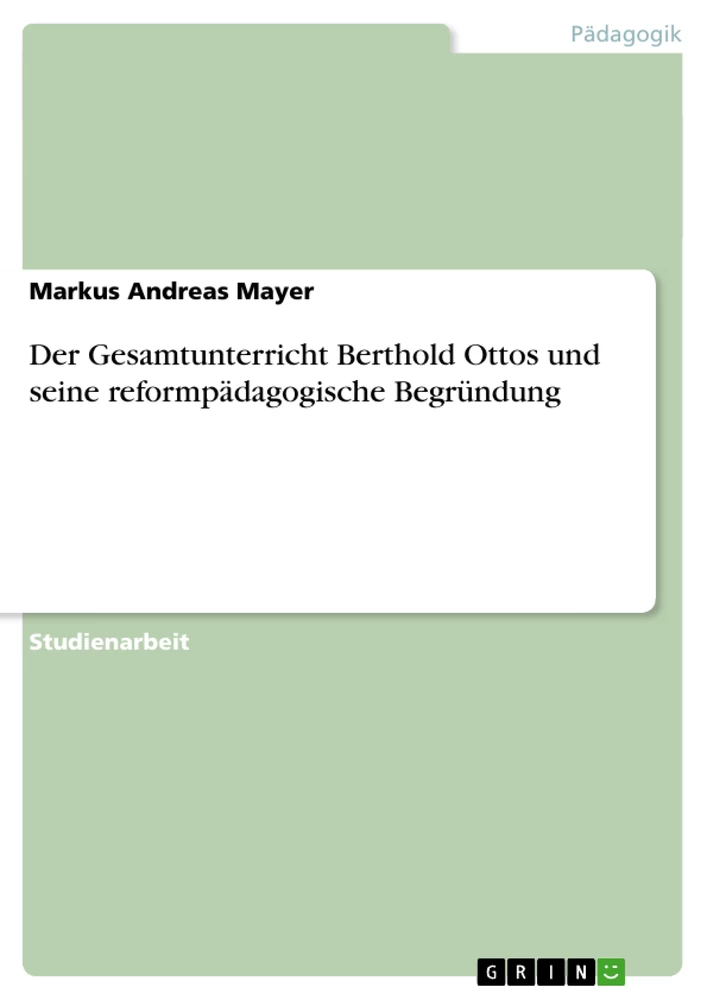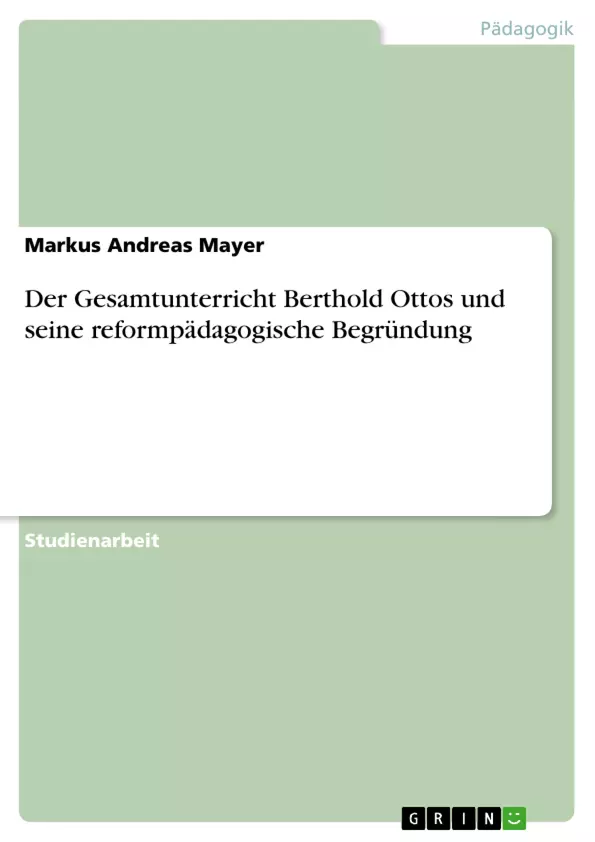Diese Arbeit befasst sich mit Berthold Otto, einem der herausragenden Vertreter der Reformpädagogik. Nach der Vorstellung der wichtigsten biographischen Daten Ottos sollen wichtige Merkmale und Neuerungen seiner Pädagogik, speziell der Gesamtunterricht, betrachtet werden. Danach erfolgt eine Analyse der Ziele des Gesamtunterrichts und die Frage soll beantwortet werden, was das Reformpädagogische an diesen Zielen ist, bzw. ob überhaupt Gemeinsamkeiten mit den verschiedenen Vertretern der Reformpädagogik festgestellt werden können. Dabei soll auch auf die philosophischen Voraussetzungen des Gesamtunterrichts Ottos eingegangen werden und sein Verhältnis zur Moderne geklärt werden. Dies kann zum einen unter dem Gesichtspunkt des Verhältnisses der Reformpädagogik, hier speziell Ottos, zum Nationalsozialismus geschehen und zum anderen zur Analyse der Brauchbarkeit reformpädagogischer Vorschläge für die heute gewünschten Reformen im gesamten Bildungsbereich (nicht nur veranlasst durch die Veröffentlichung der „Pisa-Ergebnisse“ bzw. das schlechte Abschneiden deutscher Schüler) verwendet werden.
Die Untersuchung ist dabei wie folgt gegliedert: Dieser Einleitung schließt sich ein Abschnitt über Berthold Otto als Person an (Ziffer 2). Danach werden die wichtigen Elemente und Merkmale der Ottoschen Pädagogik angeführt. Dies geschieht in Ziffer 3 mit einer Untersuchung des Gesamtunterrichts. Dabei wird in den Unterpunkten eine allgemeine Vorstellung des Gesamtunterrichts gegeben, und genauer auf die Rolle des Erziehers im Gesamtunterricht, das Spannungsfeld zwischen der Förderung Intelligenz oder Charakter und die Ausbildung und Bezahlung der Lehrer eingegangen. Da die Mutter- und Jugendsprache einen besonderen Stellenwert bei der Schulreform Ottos einnimmt, werden diese Punkte in einem gesonderten Abschnitt genauer behandelt (Ziffer 4). Danach wird der Versuch unternommen, Elemente von Ottos Pädagogik der Reformpädagogik zuzuordnen und sein Verhältnis zur Moderne zu klären (Ziffer 5). Das volksorganische Denken Ottos wird aus methodischen Gründen erst dort näher beleuchtet. Die Frage, inwieweit Ottos Pädagogik für Reformen unseres aktuellen Bildungssystems zu gebrauchen ist, bzw. welche Elemente schon von Otto übernommen wurden, wird, wie sein Verhältnis zum Nationalsozialismus, hier nur prinzipiell mit Blick auf ihre geisteswissenschaftlichen Grundlagen diskutiert. In einem Ausblick werden daraus Schlussfolgerungen gezogen und Ottos Werk kritisch gewürdigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Zweck und Anlage der Arbeit
- Biographische Daten zu Berthold Otto
- Der Gesamtunterricht
- Allgemeine Merkmale des Gesamtunterrichts
- Besondere Merkmale des Gesamtunterrichts
- Die Rolle des Erziehers im Gesamtunterricht
- Das Spannungsfeld von Wissensvermittlung und Charakterbildung
- Ausbildung und Bezahlung der (Gymnasial-)Lehrer
- Weitere Merkmale des Gesamtunterrichts
- Ottos Position zu Autorität und Disziplin
- Der Toleranzgedanke im Gesamtunterricht
- Demokratische Selbstverwaltung der Schüler
- Die Reform der Schule und die Rolle der Sprache als konstitutive Elemente der Ottoschen Pädagogik
- Die Notwendigkeit einer Reform der Schule und der Anschauungsunterricht
- Die Rolle der Sprache bei Otto
- Die Rolle der Muttersprache
- Die Rolle der Jugendsprache
- Die reformpädagogische Begründung des Gesamtunterrichts
- Die Einordnung Ottos in die Reformpädagogik
- Ottos ,,volksorganisches Denken“
- Ottos Verhältnis zur Moderne
- Das Pädagogisch-Eigentliche bei Otto
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich dem Leben und Wirken von Berthold Otto, einem bedeutenden Vertreter der Reformpädagogik. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des Gesamtunterrichts, seiner Ziele und seiner Einordnung in die Reformpädagogik. Dabei werden Ottos philosophische Grundannahmen und sein Verhältnis zur Moderne beleuchtet. Schließlich wird diskutiert, inwieweit Ottos Ideen für Reformen im heutigen Bildungssystem relevant sind.
- Der Gesamtunterricht als pädagogisches Konzept von Berthold Otto
- Die Rolle des Erziehers und die Bedeutung von Charakterbildung im Gesamtunterricht
- Die Reformpädagogischen Wurzeln des Gesamtunterrichts
- Ottos „volksorganisches Denken“ und sein Verhältnis zur Moderne
- Die Aktualität von Ottos Ideen für das heutige Bildungswesen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt Berthold Otto als Vertreter der Reformpädagogik vor und skizziert die zentralen Themen, die im weiteren Verlauf untersucht werden.
- Biographische Daten: Dieses Kapitel präsentiert die wichtigsten Stationen im Leben von Berthold Otto, von seiner Kindheit bis zu seinem Tod. Dabei wird seine Leidenschaft für Pädagogik und seine frühen Schriften hervorgehoben.
- Der Gesamtunterricht: Dieser Abschnitt beleuchtet die Merkmale des Gesamtunterrichts, der von Berthold Otto als Gegenentwurf zum gefächerten Unterricht konzipiert wurde. Besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle des Erziehers, dem Spannungsfeld zwischen Wissensvermittlung und Charakterbildung sowie der Bedeutung der Mutter- und Jugendsprache.
- Die Reform der Schule und die Rolle der Sprache: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung der Schulreform für Berthold Otto und die zentrale Rolle, die die Sprache in seinem pädagogischen Konzept spielt. Die Bedeutung der Muttersprache und der Jugendsprache für das Lernen und die Persönlichkeitsentwicklung werden erläutert.
- Die reformpädagogische Begründung des Gesamtunterrichts: In diesem Abschnitt wird untersucht, wie sich Berthold Ottos Pädagogik in die Reformpädagogik einordnen lässt. Es werden seine philosophischen Grundannahmen und seine „volksorganische“ Denkweise analysiert, sowie sein Verhältnis zur Moderne untersucht. Die zentralen pädagogischen Prinzipien von Ottos Gesamtunterricht werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Der Gesamtunterricht, Berthold Otto, Reformpädagogik, Charakterbildung, Wissensvermittlung, Muttersprache, Jugendsprache, Volksorganisches Denken, Moderne, Bildungsreform.
- Quote paper
- Markus Andreas Mayer (Author), 2004, Der Gesamtunterricht Berthold Ottos und seine reformpädagogische Begründung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41398